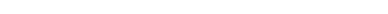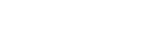Aussetzer
Es musste vor ihrer Wohnung passiert sein,
nur einen dumpfen Aufprall hat sie gespürt,
nicht einmal schmerzhaft, doch jetzt,
wie sie in den Spiegel schaut, zerschlagen, blutüberströmt:
Ist sie das?
Der Briefkasten quillt über
mit Rechnungen und Mahnungen,
das Bett seit Monaten nicht frisch angezogen,
durch das Fenster trübes Licht, Brandflecken im Teppich.
Genug! Sie hört auf zu trinken.
Im stickigen Grau schleppen sich die Tage dahin:
einkaufen gehen, an den Regalen mit Alkohol vorbei
weiter zu den Reihen dahinter
mit Futter für die Katze.
Die andere Seite
Eine Frau, alleinerziehend und vom Sozialamt abhängig, sinniert in einer Fortsetzungsreihe über das Leben in der Schweiz.
Unser Land, die Schweiz: Wunderschön mit ihren Bergen, Seen und Wäldern, kleinen Dörfern sowie riesigen, pulsierenden Städten. Circa 8,081 Millionen Menschen haben in der Schweiz ihre Heimat gefunden, leben und arbeiten in diesem Land. Dabei sind die Möglichkeiten so vielseitig wie das Land selbst. Vom Kaufmann über den Firmenchef in einer grösseren Stadt bis hin zum Bergbauern in einem kleinen Dorf in den Alpen. Man könnte denken, eigentlich sei in diesem Land alles perfekt. Jedoch ist nicht alles wie es scheint. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt eher klein, aber die Schlucht zwischen den zwei Seiten der Gesellschaft ist riesig. Jeder achte Mensch in der Schweiz ist Millionär, d.h. circa 330‘000 Menschen in der Schweiz. Sie leben wo und wie sie wollen. Sei es in einem schönen Haus am Seeufer von Zürich oder in einer grossen Villa in Zug. An den schönsten Orten der Schweiz, denn sie können es sich ja selbst aussuchen. Ohne Angst und Sorgen, was die Zukunft wohl bringt, denn ihre Zukunft ist sicher. Entweder diese Menschen hatten einfach Glück und sind so zu ihrem Vermögen gekommen oder aber sie haben es sich ihr Leben lang hart erarbeitet. Allein die Möglichkeit, sich ein Vermögen zu erarbeiten oder die Chance, sich ein Vermögen erarbeiten zu können, bedeutet für die andere Seite schon Luxus, denn die andere Seite, das sind ca 250‘000 Menschen in der Schweiz, die von Sozialhilfe leben. Jeder Dritte unter ihnen ist noch nicht einmal 18 Jahre alt.
C.
Unser Land, die Schweiz: Wunderschön mit ihren Bergen, Seen und Wäldern, kleinen Dörfern sowie riesigen, pulsierenden Städten. Circa 8,081 Millionen Menschen haben in der Schweiz ihre Heimat gefunden, leben und arbeiten in diesem Land. Dabei sind die Möglichkeiten so vielseitig wie das Land selbst. Vom Kaufmann über den Firmenchef in einer grösseren Stadt bis hin zum Bergbauern in einem kleinen Dorf in den Alpen. Man könnte denken, eigentlich sei in diesem Land alles perfekt. Jedoch ist nicht alles wie es scheint. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt eher klein, aber die Schlucht zwischen den zwei Seiten der Gesellschaft ist riesig. Jeder achte Mensch in der Schweiz ist Millionär, d.h. circa 330‘000 Menschen in der Schweiz. Sie leben wo und wie sie wollen. Sei es in einem schönen Haus am Seeufer von Zürich oder in einer grossen Villa in Zug. An den schönsten Orten der Schweiz, denn sie können es sich ja selbst aussuchen. Ohne Angst und Sorgen, was die Zukunft wohl bringt, denn ihre Zukunft ist sicher. Entweder diese Menschen hatten einfach Glück und sind so zu ihrem Vermögen gekommen oder aber sie haben es sich ihr Leben lang hart erarbeitet. Allein die Möglichkeit, sich ein Vermögen zu erarbeiten oder die Chance, sich ein Vermögen erarbeiten zu können, bedeutet für die andere Seite schon Luxus, denn die andere Seite, das sind ca 250‘000 Menschen in der Schweiz, die von Sozialhilfe leben. Jeder Dritte unter ihnen ist noch nicht einmal 18 Jahre alt.
C.
Der Mensch - der Unterschied
Eine Klientin thematisiert in einem Essay aktuelle Weltgeschehnisse bezüglich Krieg und Terror. Mit poetischen Bildern sucht sie nach einem Weg, die Unterschiede zu überbrücken.
Seit Anbeginn der Menschheit führt sie Kriege gegen sich selbst. Warum? Krieg, Krieg bleibt immer gleich! Er beginnt ganz klein. Er kann mit nur zwei Menschen beginnen, die sich nicht mögen und später hassen. Warum? Ein Mensch hasst einen anderen Menschen aus verschiedenen Gründen. Sie sehen an sich oft nur den Unterschied. Du hast eine andere Hautfarbe, kommst aus einem anderen Land, sprichst eine andere Sprache, hast mehr Geld als ich, bist blond, nicht dunkelhaarig, bist grösser, kleiner, dicker oder dünner als ich oder du hast eine andere Religion als ich. Dann entsteht Streit und mit Streit wächst Hass. Menschen mit selben Ansichten und Werten schliessen sich zusammen und kämpfen gegen die anderen. Weil sie die anderen nicht tolerieren oder aber weil sie wollen, dass diese ihre Ansichten und ihr Denken teilen. Es ist Krieg. Warum? Grundsätzlich wollen sie also, dass die anderen gleich werden wie sie selbst sind. Menschen unterscheidet so viel und doch sind sie auch ohne Krieg zu führen so gleich?! Das verstehst du nicht?
Pass auf, ich zeige es dir. Siehst du die Sonne? Wie hell sie strahlt und mit ihrer ganzen Pracht die Erde wärmt? Sie scheint für uns alle! Kannst du den Wind spüren, der dich sanft berührt? Der Wind macht keinen Unterschied! Bevor er dich berührt, hat er jemanden anderen berührt und nach dir wieder jemand anderen. So zieht er durch die Welt. Sieh hoch zu den Sternen, siehst du, wie sie leuchten? Weisst du auch, dass wir dieselben Sterne sehen? Wir sehen dieselben! Du und ich. Wir. Wir sind doch Wir?! Oder erkennst du einen Unterschied? Wir Menschen sind in unserer Art, in unserem Glauben, Aussehen, Wohlstand, Gedanken, Weltansichten und in unserer Art auf dieser Welt zu leben so unterschiedlich wie gleich.
Wir alle sind eins- Menschen! Und…
Wir alle teilen uns etwas untereinander - unsere Welt. Alle gemeinsam.
C.
Seit Anbeginn der Menschheit führt sie Kriege gegen sich selbst. Warum? Krieg, Krieg bleibt immer gleich! Er beginnt ganz klein. Er kann mit nur zwei Menschen beginnen, die sich nicht mögen und später hassen. Warum? Ein Mensch hasst einen anderen Menschen aus verschiedenen Gründen. Sie sehen an sich oft nur den Unterschied. Du hast eine andere Hautfarbe, kommst aus einem anderen Land, sprichst eine andere Sprache, hast mehr Geld als ich, bist blond, nicht dunkelhaarig, bist grösser, kleiner, dicker oder dünner als ich oder du hast eine andere Religion als ich. Dann entsteht Streit und mit Streit wächst Hass. Menschen mit selben Ansichten und Werten schliessen sich zusammen und kämpfen gegen die anderen. Weil sie die anderen nicht tolerieren oder aber weil sie wollen, dass diese ihre Ansichten und ihr Denken teilen. Es ist Krieg. Warum? Grundsätzlich wollen sie also, dass die anderen gleich werden wie sie selbst sind. Menschen unterscheidet so viel und doch sind sie auch ohne Krieg zu führen so gleich?! Das verstehst du nicht?
Pass auf, ich zeige es dir. Siehst du die Sonne? Wie hell sie strahlt und mit ihrer ganzen Pracht die Erde wärmt? Sie scheint für uns alle! Kannst du den Wind spüren, der dich sanft berührt? Der Wind macht keinen Unterschied! Bevor er dich berührt, hat er jemanden anderen berührt und nach dir wieder jemand anderen. So zieht er durch die Welt. Sieh hoch zu den Sternen, siehst du, wie sie leuchten? Weisst du auch, dass wir dieselben Sterne sehen? Wir sehen dieselben! Du und ich. Wir. Wir sind doch Wir?! Oder erkennst du einen Unterschied? Wir Menschen sind in unserer Art, in unserem Glauben, Aussehen, Wohlstand, Gedanken, Weltansichten und in unserer Art auf dieser Welt zu leben so unterschiedlich wie gleich.
Wir alle sind eins- Menschen! Und…
Wir alle teilen uns etwas untereinander - unsere Welt. Alle gemeinsam.
C.
The first cut is the deepest (erster Teil)
Herr B. erzählt, welches Ereignis bei ihm eine anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere ausgelöst hat.
Frühsommer 1996. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, damals in einem Behindertenheim in Teufen. Noch etwas müde, aber sonst guter Dinge, wollte ich am Kiosk noch Kaffee und Zigaretten kaufen.
Dann, wie ein Hammerschlag von hinten, war die Welt eine andere. Die normale Metapher war ungültig, meine Knie waren nicht wie Pudding. Mein ganzer Körper war kochender Pudding, sodass ich nur noch auf die nächste Bank sinken konnte.
Der Verstand ausgeschaltet, der einzige Gedanke: Du stirbst, in den nächsten Sekunden, Minuten, vielleicht Sunden, aber DU STIRBST.
Die Anzeichen dafür waren klar. Mein Herz schlug nicht mehr oder aber so schnell, dass Sys- und Diastole nicht mehr unterscheidbar waren. Ich atmete nicht mehr oder aber so schnell, dass ich trotzdem keine Luft bekam.
Der einfahrende Zug sah aus wie immer, die Passanten (starrten sie mich nicht alle an) sahen aus wie immer, mein Gefühl sagte mir, dass sie alle aus der Hölle kamen, um mich zu holen.
Ich kannte zwar irrationale Angst seit meiner Jugend, aber das hier war nicht vergleichbar. Ich kam mir vor wie ein 100 m-Läufer, der plötzlich auf dem 41. Kilometer der Marathonstrecke ist, das Laufen ist gleich, die Belastung unendlich anders.
Plötzlich der Gedanke: DU LEBST NOCH.
Damit kam ganz langsam ein Teil meines logischen Denkens zurück.
Ein Check-up hatte ergeben, dass mein Körper erstaunlich gesund war, es gab also keinen Grund zu sterben. Somit musste also die Panik für alle somatischen Reaktionen verantwortlich sein, und, wie jeder Angstpatient bestätigen wird, gibt es nur ein frei erhältliches Medikament gegen Angst: Alkohol.
Nach einiger Zeit traute ich mir zu aufzustehen und ging zum Kiosk. Der Verkäufer starrte mich komisch an, entweder weil ich morgens um sechs drei Underberg kaufte, oder weil mein schweissüberströmtes Gesicht verdächtig wirkte.
Nachdem ich die Schnäpse schnell gekippt hatte, liessen die körperlichen Symptome etwas nach, vor allem aber konnte ich wieder klarer denken. Wenn wenig wenig hilft, hilft viel viel. Also begab ich mich, um besser nachdenken zu können, in die nächste Kneipe und orderte Wodka. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Erstens musste ich am Arbeitsplatz anrufen und mich krankmelden, was einige Zeit später auch möglich war, obwohl meine Angst eigentlich gar keine Handlung erlaubte. Das Zweite war wesentlich schwerer. Ich musste sofort etwas unternehmen, denn das wollte ich nie wieder erleben (ein unerfüllbarer Wunsch, wie ich später noch sehr oft feststellen musste). Das hiess Notfallstation. Ich stärkte mich also – und das ist nicht ironisch gemeint – noch etwa eine Stunde und machte mich auf den Weg. Sobald ich die „sichere“ Beiz verlassen hatte, nahm die Angst wieder zu und als ich beim Spital ankam, war sie wieder so stark, dass ich am liebsten wieder gegangen wäre.
Zu meinem Glück musste ich nicht warten – im Notfall normalerweise unmöglich – und ich muss so mies ausgesehen haben, dass ich nach kurzer Erklärung sofort Valium gespritzt bekam.
Oh segensreiches Benzodiazepin, in kürzester Zeit war ich ein neuer Mensch.
Da ich nie zuvor Benzos bekommen hatte, war die Wirkung verblüffend, mein vorheriger Zustand war nicht mehr spür-, noch nicht einmal nachvollziehbar. Dennoch überredeten mich die Ärzte stationär zu bleiben, was sich auch als sinnvoll erwies, denn sobald das Valium nachliess, musste ich nachschieben.
Und so begann eine bis heute anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere.
anonym
Frühsommer 1996. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, damals in einem Behindertenheim in Teufen. Noch etwas müde, aber sonst guter Dinge, wollte ich am Kiosk noch Kaffee und Zigaretten kaufen.
Dann, wie ein Hammerschlag von hinten, war die Welt eine andere. Die normale Metapher war ungültig, meine Knie waren nicht wie Pudding. Mein ganzer Körper war kochender Pudding, sodass ich nur noch auf die nächste Bank sinken konnte.
Der Verstand ausgeschaltet, der einzige Gedanke: Du stirbst, in den nächsten Sekunden, Minuten, vielleicht Sunden, aber DU STIRBST.
Die Anzeichen dafür waren klar. Mein Herz schlug nicht mehr oder aber so schnell, dass Sys- und Diastole nicht mehr unterscheidbar waren. Ich atmete nicht mehr oder aber so schnell, dass ich trotzdem keine Luft bekam.
Der einfahrende Zug sah aus wie immer, die Passanten (starrten sie mich nicht alle an) sahen aus wie immer, mein Gefühl sagte mir, dass sie alle aus der Hölle kamen, um mich zu holen.
Ich kannte zwar irrationale Angst seit meiner Jugend, aber das hier war nicht vergleichbar. Ich kam mir vor wie ein 100 m-Läufer, der plötzlich auf dem 41. Kilometer der Marathonstrecke ist, das Laufen ist gleich, die Belastung unendlich anders.
Plötzlich der Gedanke: DU LEBST NOCH.
Damit kam ganz langsam ein Teil meines logischen Denkens zurück.
Ein Check-up hatte ergeben, dass mein Körper erstaunlich gesund war, es gab also keinen Grund zu sterben. Somit musste also die Panik für alle somatischen Reaktionen verantwortlich sein, und, wie jeder Angstpatient bestätigen wird, gibt es nur ein frei erhältliches Medikament gegen Angst: Alkohol.
Nach einiger Zeit traute ich mir zu aufzustehen und ging zum Kiosk. Der Verkäufer starrte mich komisch an, entweder weil ich morgens um sechs drei Underberg kaufte, oder weil mein schweissüberströmtes Gesicht verdächtig wirkte.
Nachdem ich die Schnäpse schnell gekippt hatte, liessen die körperlichen Symptome etwas nach, vor allem aber konnte ich wieder klarer denken. Wenn wenig wenig hilft, hilft viel viel. Also begab ich mich, um besser nachdenken zu können, in die nächste Kneipe und orderte Wodka. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Erstens musste ich am Arbeitsplatz anrufen und mich krankmelden, was einige Zeit später auch möglich war, obwohl meine Angst eigentlich gar keine Handlung erlaubte. Das Zweite war wesentlich schwerer. Ich musste sofort etwas unternehmen, denn das wollte ich nie wieder erleben (ein unerfüllbarer Wunsch, wie ich später noch sehr oft feststellen musste). Das hiess Notfallstation. Ich stärkte mich also – und das ist nicht ironisch gemeint – noch etwa eine Stunde und machte mich auf den Weg. Sobald ich die „sichere“ Beiz verlassen hatte, nahm die Angst wieder zu und als ich beim Spital ankam, war sie wieder so stark, dass ich am liebsten wieder gegangen wäre.
Zu meinem Glück musste ich nicht warten – im Notfall normalerweise unmöglich – und ich muss so mies ausgesehen haben, dass ich nach kurzer Erklärung sofort Valium gespritzt bekam.
Oh segensreiches Benzodiazepin, in kürzester Zeit war ich ein neuer Mensch.
Da ich nie zuvor Benzos bekommen hatte, war die Wirkung verblüffend, mein vorheriger Zustand war nicht mehr spür-, noch nicht einmal nachvollziehbar. Dennoch überredeten mich die Ärzte stationär zu bleiben, was sich auch als sinnvoll erwies, denn sobald das Valium nachliess, musste ich nachschieben.
Und so begann eine bis heute anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere.
anonym
Geteilte Angst ist doppelte Angst (zweiter Teil)
Was in Herrn B. vorgeht während jener Zeit, als er Dreh- und Angelpatient der psychiatrischen Klinik war, erzählt er anhand eines Traumes, dem er den Titel „sinnloser Kampf“ gibt.
Ich bin zu Besuch im Haus meiner Kindheit und Jugend. Beim Ausräumen meiner alten Sachen entdecke ich ein Stofftier. Ich beschliesse, es bei einem in der Nähe stattfindenden Flohmarkt zu verschenken. Doch jeder, dem ich es anbiete, sagt, dass es nicht zu ihm passe. Plötzlich merke ich, dass sich das Stoffding in etwas Lebendiges verwandelt. Ich versuche, es loszulassen, aber es klebt an meinen Händen. Spreize ich die Arme auseinander, dehnt es sich entsprechend.
Ich gehe nach Hause in mein Zimmer. Dort wickle ich es um die Türklinke und trete weit zurück, aber das Tierding bleibt kleben. Ab einer gewissen Dehnung reisst es auseinander. Nun stehe ich mit den Füssen auf die herabhängenden Enden, die anderen sind immer noch fest an meinen Händen. Auch hier gibt es wieder einen Riss, manche Teile des noch immer lebenden Wesens kleben nun an anderen Orten meines Körpers, zudem fallen nun kleine Fetzen während des Reissens zu Boden. Dort verwandeln sie sich in eine Art automatisierter Insekten. Da ich sowieso unter einer gut ausgeprägten Entomophobie (Angst vor Insekten) leide, wird die Lage zusehends bedrohlicher.
Immer noch versuchend, mich von den an meinem Körper klebenden, sich windenden Teilen dieses Dinges zu befreien, trete ich nun auf die am Boden befindlichen Stücke. Diese sehen nun aus wie plattbedrückte Kaugummi, teilen sich und wölben sich zu einem neuen Wesen. Voller Ekel und Panik stampfe ich nun hintereinander auf die neu entstandenen Dinger; der Vorgang wiederholt sich und erinnert an die Köpfe der Hydra. Ohne zu überlegen zerre und trete ich weiter. Die Insektendinger werden immer mehr.
Plötzlich merke ich, zu was das alles führen wird. Ich bin in einem geschlossenen Raum, kann mein Tun nicht kontrollieren und mache immer weiter. Da der Boden inzwischen in mehreren Lagen von diesem Zeug bedeckt ist, wird sich das ganze Zimmer in absehbarer Zeit damit füllen und ich werde ersticken. Als mir die Insektenwesen im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Hals stehen, wache ich auf, muss aufstehen, eine rauchen und fernsehen, da ich weiss, wenn ich wieder einschlafe, werden mich die Bilder weiter verfolgen.
Ich bin zu Besuch im Haus meiner Kindheit und Jugend. Beim Ausräumen meiner alten Sachen entdecke ich ein Stofftier. Ich beschliesse, es bei einem in der Nähe stattfindenden Flohmarkt zu verschenken. Doch jeder, dem ich es anbiete, sagt, dass es nicht zu ihm passe. Plötzlich merke ich, dass sich das Stoffding in etwas Lebendiges verwandelt. Ich versuche, es loszulassen, aber es klebt an meinen Händen. Spreize ich die Arme auseinander, dehnt es sich entsprechend.
Ich gehe nach Hause in mein Zimmer. Dort wickle ich es um die Türklinke und trete weit zurück, aber das Tierding bleibt kleben. Ab einer gewissen Dehnung reisst es auseinander. Nun stehe ich mit den Füssen auf die herabhängenden Enden, die anderen sind immer noch fest an meinen Händen. Auch hier gibt es wieder einen Riss, manche Teile des noch immer lebenden Wesens kleben nun an anderen Orten meines Körpers, zudem fallen nun kleine Fetzen während des Reissens zu Boden. Dort verwandeln sie sich in eine Art automatisierter Insekten. Da ich sowieso unter einer gut ausgeprägten Entomophobie (Angst vor Insekten) leide, wird die Lage zusehends bedrohlicher.
Immer noch versuchend, mich von den an meinem Körper klebenden, sich windenden Teilen dieses Dinges zu befreien, trete ich nun auf die am Boden befindlichen Stücke. Diese sehen nun aus wie plattbedrückte Kaugummi, teilen sich und wölben sich zu einem neuen Wesen. Voller Ekel und Panik stampfe ich nun hintereinander auf die neu entstandenen Dinger; der Vorgang wiederholt sich und erinnert an die Köpfe der Hydra. Ohne zu überlegen zerre und trete ich weiter. Die Insektendinger werden immer mehr.
Plötzlich merke ich, zu was das alles führen wird. Ich bin in einem geschlossenen Raum, kann mein Tun nicht kontrollieren und mache immer weiter. Da der Boden inzwischen in mehreren Lagen von diesem Zeug bedeckt ist, wird sich das ganze Zimmer in absehbarer Zeit damit füllen und ich werde ersticken. Als mir die Insektenwesen im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Hals stehen, wache ich auf, muss aufstehen, eine rauchen und fernsehen, da ich weiss, wenn ich wieder einschlafe, werden mich die Bilder weiter verfolgen.
Schmerzhafte Heilung (dritter Teil)
Herr B. hat einen Traum, der ihn ganz überraschend von seinen Glieder- und Rückenschmerzen befreit.
Ich wohne ihn einem riesigen Haus, das aussieht, als sei es von Escher und H.R. Giger gemeinsam konstruiert worden. Um von einem Zimmer meiner Wohnung zu einem andern zu kommen, muss ich zum Teil andere Wohnungen durchqueren.
In einer Art Gemeinschaftsraum treffe ich auf meine Oma, die sagt, dass sie in den letzten Jahren mehrere sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte. Auf meine Bemerkung, dass das mit 91 eine respektable Leistung sei, werde ich von den anderen Anwesenden als zynisch beschimpft. Erst jetzt bemerke ich, dass sich sehr viele Leute im Raum befinden. Und zwar sind es Menschen, die ich in meinem Leben mehr oder weniger gut kennengelernt habe. Alle sind der „besseren“ Gesellschaft zuzuordnen, sei es aufgrund von Status – Rechtsanwälte, Zahnärzte, Politiker etc. – oder Intellekt, z.B. viele Mitstudenten oder Dozenten von Früher. Auch Teile meiner Familie sind dabei.
Obwohl sie alle so aussehen wie früher, habe ich das Gefühl, dass sie sich auf irgendeine Art ähneln.
Als die Angriffe gegen mich immer heftiger werden, beschliesse ich, in meine Wohnung zurückzukehren. Dort ankommend stelle ich fest, dass alle meine persönlichen Sachen verschwunden sind. Ebenso wurden meine Schlösser ausgetauscht.
Als ich mit der Polizei wieder komme, ist meine Wohnung in eine Bar umgebaut, deren Besitzer und Gäste „diese Leute“ sind.
Szenenwechsel: ein Ferienort (Spanien?)
Zunächst ist alles schön, ich bin froh, mich erholen zu können. Plötzlich erkenne ich immer mehr mir bekannte Gesichter. Es stellt sich heraus, dass „diese Leute“ auch hier sind. Als sie mich allein finden, schlagen sie mich brutal zusammen, die Polizei sagt mir, sie könne nicht helfen.
In der Hoffnung, irgendwo Zuflucht zu finden, entdecke ich beim Gang durch die Stadt das Haus einer religiösen Gemeinschaft und die netten Menschen dort versichern mir, dass sie mich schützen werden. Mit der Zeit fällt mir auf, dass sich die Mitglieder auf irgendeine Weise ähnlich sind.
In dem Moment entpuppen sie sich m wahrsten Sinne des Wortes als „diese Laute“. Sie brechen mir mit Baseballschlägern die Glieder, stechen mit Messern auf mich ein und prügeln mich schliesslich zu Tode.
In diesem Moment erwache ich (es wäre mir lieber gewesen, dies wäre früher geschehen).
Epilog
Normalerweise würde jeder – inklusive mir – das Ganze als Ausdruck meiner paranoiden Persönlichkeitsstruktur werten. Das Lustige am Ganzen ist Folgendes: Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich am ganzen Körper solche Schmerzen, dass ich zur Beruhigungszigarette in die Stube kriechen musste. Als ich schliesslich doch noch auf dem Sofa einschlief und wieder erwachte, waren die starken Glieder- und Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, vollkommen verschwunden.
Ich wohne ihn einem riesigen Haus, das aussieht, als sei es von Escher und H.R. Giger gemeinsam konstruiert worden. Um von einem Zimmer meiner Wohnung zu einem andern zu kommen, muss ich zum Teil andere Wohnungen durchqueren.
In einer Art Gemeinschaftsraum treffe ich auf meine Oma, die sagt, dass sie in den letzten Jahren mehrere sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte. Auf meine Bemerkung, dass das mit 91 eine respektable Leistung sei, werde ich von den anderen Anwesenden als zynisch beschimpft. Erst jetzt bemerke ich, dass sich sehr viele Leute im Raum befinden. Und zwar sind es Menschen, die ich in meinem Leben mehr oder weniger gut kennengelernt habe. Alle sind der „besseren“ Gesellschaft zuzuordnen, sei es aufgrund von Status – Rechtsanwälte, Zahnärzte, Politiker etc. – oder Intellekt, z.B. viele Mitstudenten oder Dozenten von Früher. Auch Teile meiner Familie sind dabei.
Obwohl sie alle so aussehen wie früher, habe ich das Gefühl, dass sie sich auf irgendeine Art ähneln.
Als die Angriffe gegen mich immer heftiger werden, beschliesse ich, in meine Wohnung zurückzukehren. Dort ankommend stelle ich fest, dass alle meine persönlichen Sachen verschwunden sind. Ebenso wurden meine Schlösser ausgetauscht.
Als ich mit der Polizei wieder komme, ist meine Wohnung in eine Bar umgebaut, deren Besitzer und Gäste „diese Leute“ sind.
Szenenwechsel: ein Ferienort (Spanien?)
Zunächst ist alles schön, ich bin froh, mich erholen zu können. Plötzlich erkenne ich immer mehr mir bekannte Gesichter. Es stellt sich heraus, dass „diese Leute“ auch hier sind. Als sie mich allein finden, schlagen sie mich brutal zusammen, die Polizei sagt mir, sie könne nicht helfen.
In der Hoffnung, irgendwo Zuflucht zu finden, entdecke ich beim Gang durch die Stadt das Haus einer religiösen Gemeinschaft und die netten Menschen dort versichern mir, dass sie mich schützen werden. Mit der Zeit fällt mir auf, dass sich die Mitglieder auf irgendeine Weise ähnlich sind.
In dem Moment entpuppen sie sich m wahrsten Sinne des Wortes als „diese Laute“. Sie brechen mir mit Baseballschlägern die Glieder, stechen mit Messern auf mich ein und prügeln mich schliesslich zu Tode.
In diesem Moment erwache ich (es wäre mir lieber gewesen, dies wäre früher geschehen).
Epilog
Normalerweise würde jeder – inklusive mir – das Ganze als Ausdruck meiner paranoiden Persönlichkeitsstruktur werten. Das Lustige am Ganzen ist Folgendes: Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich am ganzen Körper solche Schmerzen, dass ich zur Beruhigungszigarette in die Stube kriechen musste. Als ich schliesslich doch noch auf dem Sofa einschlief und wieder erwachte, waren die starken Glieder- und Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, vollkommen verschwunden.
Yamabushi (vierter Teil)
Der Mann, der auf dieser Webseite das Pilgertagebuch geschrieben hat, hielt das Leben als Sozialhilfebezüger in der Stadt nicht mehr aus und fand eine günstige Wohnung in einem abgelegenen Tal. Dort lebte er über Monate sehr zurückgezogen und einsam. Dann begann er wieder zu schreiben.
Vor Jahren habe ich in irgendeinem Roman den Begriff Hauptbuch das erste Mal gelesen. Ich vermutete kontextmässig, dass es sich um etwas aus dem Geschäftsleben handelte. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, sollte es vermutlich mal googlen, aber das Wort ging mir nicht aus dem Kopf. Zudem habe ich es irgendwie mit Jungs Rotem Buch assoziiert und gedenke nun jetzt und hiermit etwas Ähnliches für mich und posthum vielleicht für andere zu verfassen.
Es soll Gedanken über grundsätzliche Probleme vor allem meines Lebens, aber auch über einfach alles enthalten.
Bevor ich aber eine ausführliche Vorrede verfasse, was ich in Abständen stückweise auch noch vorhabe, gehe ich direkt zu einem sehr aktuellen und dennoch für mich prinzipiellen Thema.
Die grundlegende Problematik ist, dass ich bei den meisten Dingen weiss, was richtig ist und was ich tun sollte. Aber mir stehen mein Trotz (negativ) und meine Abneigung (positiv) gegen Fremdbestimmung im Weg. Zurzeit geht es um Nicht-Rauchen und Fasten. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich beides kann, dass es mir gut tut und dass ich dadurch andere Probleme besser lösen kann und die Freiheit habe, das zu tun, was ich wirklich will.
Im Moment hält mich Geldmangel ab von meinem Ideal des Yamabushi (japanischer Eremit, der sich der Askese widmet), der ich nach meinem Umzug in die Berge gerne wäre, aber Askese ist nur dann möglich, wenn sie freiwillig geschieht, nicht, wenn ich durch Staatsbürokratie in die Armut gepresst werde.
Dies waren seine letzten Sätze. Der Vermieter fand ihn tot in seiner Wohnung. Die Ärzte vermuteten, dass er an übermässigem Konsum von Medikamenten und Alkohol gestorben war.
Vor Jahren habe ich in irgendeinem Roman den Begriff Hauptbuch das erste Mal gelesen. Ich vermutete kontextmässig, dass es sich um etwas aus dem Geschäftsleben handelte. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, sollte es vermutlich mal googlen, aber das Wort ging mir nicht aus dem Kopf. Zudem habe ich es irgendwie mit Jungs Rotem Buch assoziiert und gedenke nun jetzt und hiermit etwas Ähnliches für mich und posthum vielleicht für andere zu verfassen.
Es soll Gedanken über grundsätzliche Probleme vor allem meines Lebens, aber auch über einfach alles enthalten.
Bevor ich aber eine ausführliche Vorrede verfasse, was ich in Abständen stückweise auch noch vorhabe, gehe ich direkt zu einem sehr aktuellen und dennoch für mich prinzipiellen Thema.
Die grundlegende Problematik ist, dass ich bei den meisten Dingen weiss, was richtig ist und was ich tun sollte. Aber mir stehen mein Trotz (negativ) und meine Abneigung (positiv) gegen Fremdbestimmung im Weg. Zurzeit geht es um Nicht-Rauchen und Fasten. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich beides kann, dass es mir gut tut und dass ich dadurch andere Probleme besser lösen kann und die Freiheit habe, das zu tun, was ich wirklich will.
Im Moment hält mich Geldmangel ab von meinem Ideal des Yamabushi (japanischer Eremit, der sich der Askese widmet), der ich nach meinem Umzug in die Berge gerne wäre, aber Askese ist nur dann möglich, wenn sie freiwillig geschieht, nicht, wenn ich durch Staatsbürokratie in die Armut gepresst werde.
Dies waren seine letzten Sätze. Der Vermieter fand ihn tot in seiner Wohnung. Die Ärzte vermuteten, dass er an übermässigem Konsum von Medikamenten und Alkohol gestorben war.
Wunderwelt
Den Worten einer alten Frau nachlauschen - und verzaubert sein.
Mitten im Schwarm schaute
ich zu wie die Flocken
Landeten auf dem Teer
Ihre weissen Augen
Die mich in schlingerndem
Flug betrachten hatten
Schmolzen und erloschen –
Lauschte den Worten
Der Alten nach: Niemand
Interessanter lebe hier
Im Altersheim, die meisten
Seien beim Mann geblieben
Bis dieser gestorben sei
Sie aber sei weit gereist
Ob sie denn gerne von
Ihren Reisen erzählen würde?
Nein! Sie wisse ja nicht mehr
Wo sie überall gewesen sei.
Lange hält sie inne: Alles
Geht einmal zu Ende wohin
Kommen wir dann? Nach
Nirgendshausen? Bleiben
Wir dann immer dort?
Wieder hält sie lange inne:
Wir können denken, riechen
Schauen, schmecken, das
Ist doch wie ein Wunder –
Wir leben in einer Wunderwelt
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Mitten im Schwarm schaute
ich zu wie die Flocken
Landeten auf dem Teer
Ihre weissen Augen
Die mich in schlingerndem
Flug betrachten hatten
Schmolzen und erloschen –
Lauschte den Worten
Der Alten nach: Niemand
Interessanter lebe hier
Im Altersheim, die meisten
Seien beim Mann geblieben
Bis dieser gestorben sei
Sie aber sei weit gereist
Ob sie denn gerne von
Ihren Reisen erzählen würde?
Nein! Sie wisse ja nicht mehr
Wo sie überall gewesen sei.
Lange hält sie inne: Alles
Geht einmal zu Ende wohin
Kommen wir dann? Nach
Nirgendshausen? Bleiben
Wir dann immer dort?
Wieder hält sie lange inne:
Wir können denken, riechen
Schauen, schmecken, das
Ist doch wie ein Wunder –
Wir leben in einer Wunderwelt
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Not mit Nachtschicht
Eine Frau meldet sich bei unserer Beratungsstelle, sie brauche dringend neue Möbel, sie habe schon seit mehr als zehn Jahren nichts Neues mehr angeschafft. Ich schlug ihr vor, sie bei ihr zuhause zu besuchen, um ihre Lebenslage besser verstehen zu können.
Sofa abgewetzt
Matratze mit Rissen
Die verstaubte Fahne
Im Zimmer des Sohnes:
Galatasaray
So sei er vor ihr gestanden
Sagt sie und wankt mit
Hängenden Armen hin und her
Und weint sich zurück
Vom Besuch in der Klinik
Sein Vater habe sich
Nie um ihn gekümmert
Die Tochter mit acht
Monaten gestorben
Und noch immer
Sieht sie den Sarg
Im Bauch des
Flugzeugs verschwinden
Zeigt auf den
Kaputten Staubsauger
Auch das noch
Auch der versagt
Seinen Dienst
Und in der Luft ein Staub
In dem das Licht erstickt
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Sofa abgewetzt
Matratze mit Rissen
Die verstaubte Fahne
Im Zimmer des Sohnes:
Galatasaray
So sei er vor ihr gestanden
Sagt sie und wankt mit
Hängenden Armen hin und her
Und weint sich zurück
Vom Besuch in der Klinik
Sein Vater habe sich
Nie um ihn gekümmert
Die Tochter mit acht
Monaten gestorben
Und noch immer
Sieht sie den Sarg
Im Bauch des
Flugzeugs verschwinden
Zeigt auf den
Kaputten Staubsauger
Auch das noch
Auch der versagt
Seinen Dienst
Und in der Luft ein Staub
In dem das Licht erstickt
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Zwei Engel in einem zerbrechlichen Leben
In einem modernen Märchen schildert eine Frau, wie sie, verloren und allein, trotzdem Halt gefunden hat.
Als das kleine mädchen aus der schweiz acht jahre alt wurde, freute es sich auf ihren baldigen geburstag. Denn es wusste vom vater, dass es etwas besonderes geben wird. Die freude war gross bei der kleinen. Die bescherung war nah.
Nun das geschenk war niemals so schön, wie die kleine sich das dachte. Der vater nahm sie in die arme und flüsterte ihr ins ohr, was das geschenk war. Das mädchen verstand nicht, was daran schön sein sollte.
Ab diesem tag geschah es regelmässig und intensiv: das mädchen begann für sich Engel vorzustellen. Die sollten über ihr sein und sie wünschte sich, dass die Engel sie einmal für immer mitnehmen würden. Denn fliegen sollte doch nicht so schwierig sein. Sie gab niemals den wunsch auf zu fliegen. Ihre seele hungerte nach liebe, geborgenheit und normalität. Doch sie bekam schläge und schmerz. Jahre um jahre vergingen und das mädchen wurde älter und dabei waren stets ihre Engel mit dabei. Ihr leben war schmerzvoll und traurig. Es gab immer wieder tage, an denen sie am boden war und aufgeben wollte. Es klingt ein wenig abergläubisch, aber es waren die Engel die sie immer daran hinderten. Niemals dachte sie, dass Engel auch menschen sein könnten. Doch es gab sie wirklich und das gab dem mädchen einen schub kraft. Erst jetzt nach vielen jahren, dachte sie im bett, beginnt mein leben. Ein lachen huschte über ihr zartes gesicht.
Auch wenn das leben schmerzvoll begann, gab es ein happy end. Denn ihr wurden vom himmel Engel geschickt, nicht zum fliegen, sondern sie zu begleiten und ihr die schönen seiten des lebens zu präsentieren. Die Engel sind immer noch alleine für sie da. Und das mädchen will nicht mehr davon-fliegen, denn es will noch mehr schöne dinge sehen und erleben, und das mit der sicherheit der Engel. Das leben des mädchens war zerstört worden, doch dank der zwei wunderbaren Engel hat sie den weg neu ins leben gefunden.
Engel kann man nicht immer sehen,
aber fühlen.
Rosa Todesco
Als das kleine mädchen aus der schweiz acht jahre alt wurde, freute es sich auf ihren baldigen geburstag. Denn es wusste vom vater, dass es etwas besonderes geben wird. Die freude war gross bei der kleinen. Die bescherung war nah.
Nun das geschenk war niemals so schön, wie die kleine sich das dachte. Der vater nahm sie in die arme und flüsterte ihr ins ohr, was das geschenk war. Das mädchen verstand nicht, was daran schön sein sollte.
Ab diesem tag geschah es regelmässig und intensiv: das mädchen begann für sich Engel vorzustellen. Die sollten über ihr sein und sie wünschte sich, dass die Engel sie einmal für immer mitnehmen würden. Denn fliegen sollte doch nicht so schwierig sein. Sie gab niemals den wunsch auf zu fliegen. Ihre seele hungerte nach liebe, geborgenheit und normalität. Doch sie bekam schläge und schmerz. Jahre um jahre vergingen und das mädchen wurde älter und dabei waren stets ihre Engel mit dabei. Ihr leben war schmerzvoll und traurig. Es gab immer wieder tage, an denen sie am boden war und aufgeben wollte. Es klingt ein wenig abergläubisch, aber es waren die Engel die sie immer daran hinderten. Niemals dachte sie, dass Engel auch menschen sein könnten. Doch es gab sie wirklich und das gab dem mädchen einen schub kraft. Erst jetzt nach vielen jahren, dachte sie im bett, beginnt mein leben. Ein lachen huschte über ihr zartes gesicht.
Auch wenn das leben schmerzvoll begann, gab es ein happy end. Denn ihr wurden vom himmel Engel geschickt, nicht zum fliegen, sondern sie zu begleiten und ihr die schönen seiten des lebens zu präsentieren. Die Engel sind immer noch alleine für sie da. Und das mädchen will nicht mehr davon-fliegen, denn es will noch mehr schöne dinge sehen und erleben, und das mit der sicherheit der Engel. Das leben des mädchens war zerstört worden, doch dank der zwei wunderbaren Engel hat sie den weg neu ins leben gefunden.
Engel kann man nicht immer sehen,
aber fühlen.
Rosa Todesco
Die Doppelgängerin
Seit Jahren erledige ich für eine 79-jährige Frau ihre finanziellen Angelegenheiten. Sie lebt in einem Altersheim. Wegen eines schizophrenen Schubes musste sie in die Klinik eingewiesen werden.
„Ich habe eine Doppelgängerin“, sagt sie. „Sie hat mir die Tasche gestohlen mit all meinen Bankkärtchen drin und hebt jetzt von meinem Konto ab.“
„Niemand kann von ihrem Konto Geld abheben. Ihr Geld ist sicher auf der Bank.“
„Nein, sie hat schon letzten Monat Geld von meinem Konto abgehoben.“
„Niemand hebt Geld von ihrem Konto ab. Ich würde das auf den Bankauszügen sofort erkennen. Ihr Geld ist sicher auf der Bank.“
„Nein … Und jetzt holt mich bald ein Mann ab. Ich möchte nicht auf das Schiff! Himmelsternen! Jetzt bin ich doch schon 79 und sollte noch auf einem Schiff arbeiten. Das ist streng! Kann man nicht dafür sorgen, dass ich hier bleiben darf?“
„Sie dürfen hier bleiben.“
„Nein.“
„Ganz bestimmt, sie dürfen hier bleiben. Auch ihre Betreuerin sagt, dass sie hier bleiben dürfen.“
„Haben Sie mit ihr gesprochen?“
„Ja“, lüge ich, um ihr Sicherheit zu geben. Wenn alle um sie herum bestätigen, dass sie hier bleiben darf, wird sie sich vielleicht beruhigen.
„Woher haben Sie denn gewusst, dass ich abgeholt werde?“
„Ich habe eine Doppelgängerin“, sagt sie. „Sie hat mir die Tasche gestohlen mit all meinen Bankkärtchen drin und hebt jetzt von meinem Konto ab.“
„Niemand kann von ihrem Konto Geld abheben. Ihr Geld ist sicher auf der Bank.“
„Nein, sie hat schon letzten Monat Geld von meinem Konto abgehoben.“
„Niemand hebt Geld von ihrem Konto ab. Ich würde das auf den Bankauszügen sofort erkennen. Ihr Geld ist sicher auf der Bank.“
„Nein … Und jetzt holt mich bald ein Mann ab. Ich möchte nicht auf das Schiff! Himmelsternen! Jetzt bin ich doch schon 79 und sollte noch auf einem Schiff arbeiten. Das ist streng! Kann man nicht dafür sorgen, dass ich hier bleiben darf?“
„Sie dürfen hier bleiben.“
„Nein.“
„Ganz bestimmt, sie dürfen hier bleiben. Auch ihre Betreuerin sagt, dass sie hier bleiben dürfen.“
„Haben Sie mit ihr gesprochen?“
„Ja“, lüge ich, um ihr Sicherheit zu geben. Wenn alle um sie herum bestätigen, dass sie hier bleiben darf, wird sie sich vielleicht beruhigen.
„Woher haben Sie denn gewusst, dass ich abgeholt werde?“
Ohne dich
Ein Mann schreibt Gedichte, nicht leicht zu verstehen und doch bewegen, in denen man sich selbst wiederfindet und zeitgleich verliert...
Ich fragte den jungen Mann, was er denn gerne mache, richtig gerne, mit Leidenschaft.
Er schreibe Gedichte.
Gedichte?
„Ja.“
„Wir freuen uns über Gedichte, wir können sie auch veröffentlichen unter www.ueberlebenskunst.org.“
„Meine Gedichte versteht hier niemand. Ich schreibe in Portugiesisch.“
„Wir finden jemanden, der es übersetzt.“
Zur nächsten Beratungsstunde brachte er ein Gedicht mit:
Ohne dich
Diese Einsamkeit verfolgt mich
Diese Leere, niemanden zu haben.
Aus meiner Lebenserfahrung der Wunsch
mich zu sehr abschirmen zu wollen.
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Angst, weil die Welt beängstigend ist
Angst vor der Einsamkeit
Angst vor der Liebe
Angst vor allem und jedem
Angst ein Wesen aus Nichts zu werden
Angst vor dem Leiden
Angst jemanden zu verletzen
und meine grösste Angst: Dich zu verlieren!
Für seine Gedichte hatte er nie einen Verleger gefunden. Ich kann mir vorstellen warum. Zu wenig Formbewusstsein, könnte der eine Lektor gesagt haben. Keine eigene Sprache, der andere.
Ich lese das Gedicht, zweimal, dreimal:
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Und tauche ein in ein Lebensgefühl, das ich nicht präziser hätte beschreiben können: Verloren in einem Horizont ohne Ende. Wo beginnen, welchen Standpunkt einnehmen, wo dieser doch mit der Zeit fliesst, schon jetzt wieder ein anderer ist? Dieses Lebensgefühl, das auf der anderen Seite auch Offenheit beinhaltet, hat gelitten während jener Zeit, da ich genau zu wissen glaubte, wer ich bin.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Ich sehe mich zielstrebig durch die Stadt laufen, zielstrebig meine Karriere planen. Sehe mich unterrichten mit modernen Methoden-Tools. Grandios, was ich mit meinem Willen erreicht habe, erreichen kann.
die Unendlichkeit von Nichts.
So lese ich das Gedicht, stolpere voran, glaube zu verstehen und verstehe wieder nicht.
Nach einem halben Jahr kommt er überraschend wieder zu unserer Beratungsstelle. Er wolle nur einen Essensgutschein. Seine Situation hat sich kaum verändert. Er hängt rum in den Dreiweihern, lebt vom Sozialamt und muss massive Kürzungen hinnehmen, weil er Termine nicht einhält.
„Ich habe ihr Gedicht aufgehängt, hier im Pfarreiheim.“
„Ehrlich?“
Wir gehen das Treppenhaus hinunter bis zu seinem Gedicht. Lange bleibt er davor stehen, lächelt und sagt:
„Ich sollte wieder schreiben.“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter und Geschichtensammler
Januar 2013
Ich fragte den jungen Mann, was er denn gerne mache, richtig gerne, mit Leidenschaft.
Er schreibe Gedichte.
Gedichte?
„Ja.“
„Wir freuen uns über Gedichte, wir können sie auch veröffentlichen unter www.ueberlebenskunst.org.“
„Meine Gedichte versteht hier niemand. Ich schreibe in Portugiesisch.“
„Wir finden jemanden, der es übersetzt.“
Zur nächsten Beratungsstunde brachte er ein Gedicht mit:
Ohne dich
Diese Einsamkeit verfolgt mich
Diese Leere, niemanden zu haben.
Aus meiner Lebenserfahrung der Wunsch
mich zu sehr abschirmen zu wollen.
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Angst, weil die Welt beängstigend ist
Angst vor der Einsamkeit
Angst vor der Liebe
Angst vor allem und jedem
Angst ein Wesen aus Nichts zu werden
Angst vor dem Leiden
Angst jemanden zu verletzen
und meine grösste Angst: Dich zu verlieren!
Für seine Gedichte hatte er nie einen Verleger gefunden. Ich kann mir vorstellen warum. Zu wenig Formbewusstsein, könnte der eine Lektor gesagt haben. Keine eigene Sprache, der andere.
Ich lese das Gedicht, zweimal, dreimal:
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Und tauche ein in ein Lebensgefühl, das ich nicht präziser hätte beschreiben können: Verloren in einem Horizont ohne Ende. Wo beginnen, welchen Standpunkt einnehmen, wo dieser doch mit der Zeit fliesst, schon jetzt wieder ein anderer ist? Dieses Lebensgefühl, das auf der anderen Seite auch Offenheit beinhaltet, hat gelitten während jener Zeit, da ich genau zu wissen glaubte, wer ich bin.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Ich sehe mich zielstrebig durch die Stadt laufen, zielstrebig meine Karriere planen. Sehe mich unterrichten mit modernen Methoden-Tools. Grandios, was ich mit meinem Willen erreicht habe, erreichen kann.
die Unendlichkeit von Nichts.
So lese ich das Gedicht, stolpere voran, glaube zu verstehen und verstehe wieder nicht.
Nach einem halben Jahr kommt er überraschend wieder zu unserer Beratungsstelle. Er wolle nur einen Essensgutschein. Seine Situation hat sich kaum verändert. Er hängt rum in den Dreiweihern, lebt vom Sozialamt und muss massive Kürzungen hinnehmen, weil er Termine nicht einhält.
„Ich habe ihr Gedicht aufgehängt, hier im Pfarreiheim.“
„Ehrlich?“
Wir gehen das Treppenhaus hinunter bis zu seinem Gedicht. Lange bleibt er davor stehen, lächelt und sagt:
„Ich sollte wieder schreiben.“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter und Geschichtensammler
Januar 2013
Ohne Dich
Beim Abschied von einer Geliebten Person, fällt es schwer, seine Emotionen zu zeigen. Rui Afonso zieht sich lieber zurück und schreibt...
Esta solidão persegue-me
Este vazio, sem ter ninguém
Talvez por me refugiar demais
Pela própria experência de vida
É um porquê de muitas perguntas
É um ser de poucas respostas
É um querer infinito,
É um infinito sem ter nada
É medo porque o mundo mete medo
É o medo da solidão
Medo do amor
Medo de tudo e de todos
Medo de me tornar um ser sem nada
Medo de sofrer
Ou talvez de fazer sofrer
Mas o meu maior medo
É o de te perder
Rui Afonso
Esta solidão persegue-me
Este vazio, sem ter ninguém
Talvez por me refugiar demais
Pela própria experência de vida
É um porquê de muitas perguntas
É um ser de poucas respostas
É um querer infinito,
É um infinito sem ter nada
É medo porque o mundo mete medo
É o medo da solidão
Medo do amor
Medo de tudo e de todos
Medo de me tornar um ser sem nada
Medo de sofrer
Ou talvez de fazer sofrer
Mas o meu maior medo
É o de te perder
Rui Afonso
Ohne Dich
Diese Einsamkeit verfolgt mich
Diese Leere, niemanden zu haben.
Aus meiner Lebenserfahrung der Wunsch
mich zu sehr abschirmen zu wollen.
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Angst, weil die Welt beängstigend ist
Angst vor der Einsamkeit
Angst vor der Liebe
Angst vor allem und jedem
Angst ein Wesen aus Nichts zu werden
Angst vor dem Leiden
Angst jemanden zu verletzen
und meine grösste Angst: Dich zu verlieren!
Rui Afonso
Diese Einsamkeit verfolgt mich
Diese Leere, niemanden zu haben.
Aus meiner Lebenserfahrung der Wunsch
mich zu sehr abschirmen zu wollen.
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Angst, weil die Welt beängstigend ist
Angst vor der Einsamkeit
Angst vor der Liebe
Angst vor allem und jedem
Angst ein Wesen aus Nichts zu werden
Angst vor dem Leiden
Angst jemanden zu verletzen
und meine grösste Angst: Dich zu verlieren!
Rui Afonso
Ist das Schicksal kooperativ
Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben. Und was bedeutet Kooperation für Leute die eine Heimkarriere hinter sich haben? Wären sie dann karrieren-los oder heimat-los?
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine Heimkarriere. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen bei unserer Mutter auf. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an:
„Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du wirst, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsenen Personen zu und fragte: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen ein. Bei einem grösseren Coup sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich wieder, Menschen zu begegnen, ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige es ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet.
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, allein zu sein.
Letzte Weihnachten feiern wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe – und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihm kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich wie ein Vater war, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob die Klippe meines 25-sten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und etwas zu essen reicht es. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld. Aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder ausstellen und den Leuten von Blut und abgeschlagenen Köpfen erzählen. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
Anonym
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine Heimkarriere. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen bei unserer Mutter auf. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an:
„Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du wirst, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsenen Personen zu und fragte: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen ein. Bei einem grösseren Coup sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich wieder, Menschen zu begegnen, ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige es ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet.
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, allein zu sein.
Letzte Weihnachten feiern wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe – und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihm kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich wie ein Vater war, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob die Klippe meines 25-sten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und etwas zu essen reicht es. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld. Aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder ausstellen und den Leuten von Blut und abgeschlagenen Köpfen erzählen. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
Anonym
Neulich an der Tür
Freitag, kurz vor 17 Uhr. Ich freue mich auf das Wochenende, da klingelt es unerwartet an der Tür zum Sozialdienst.
„Guten Tag, meine Name ist M. K., bevor ich weiterspreche, lesen Sie bitte diese Karte.“ Sie überreicht mir eine laminierte Karte, darauf steht in einigen Sätzen, dass sie keine Bettlerin ist, eine seelische Krankheit hat und Karten verkauft. Auch wenn ich in den letzten Wochen etwas bedrängt worden war und an jedem Arbeitstag mit weiteren unerfüllbaren Wünschen von Menschen an der Türe zu rechnen habe, bin ich interessiert und frage die Frau, die etwa Mitte dreissig schien, wie sie zum Kartenverkauf gekommen ist. Ich merke bald, dass sie Mühe mit Sprechen hat. Sie stottert und wiederholt immer wieder einige Wörter. Trotzdem bemüht sie sich sehr und beantwortet bereitwillig meine Fragen:
„Ich war einige Male in einer psychiatrischen Klinik. Da ich mit meiner Krankheit keine Arbeitsstelle finde, habe ich mich mit 5 anderen Kollegen zusammengetan. Wir gestalten Karten, lassen sie drucken und verkaufen sie täglich in einer anderen Stadt. Morgens wirft jeweils mein Kollege einen Pfeil auf eine Landkarte an der Wand. Und dorthin fahren wir dann. Jeder für sich. Ausser einem, der hat Epilepsie, er trifft sich alle zwei Stunden mit jemanden von uns. Heute war ich mit St. Gallen dran. Wohnen tue ich übrigens in Kreuzlingen.“
„Und verkaufen sie viele Karten? Und was passiert mit dem Geld, das sie verdienen?“
"Ich und meine Mitarbeiter versuchen mit den Einnahmen zu leben. Ich wäre sonst von der Fürsorge abhängig und das möchte ich nicht. Unsere Karten kommen bei den Leuten gut an, weil sie in keinem Geschäft zu kaufen und günstiger sind. Zudem schätzen sie es, dass wir einen Weg gefunden haben, um Geld zu verdienen. Der Aufwand ist sehr gross. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht bis ich den Mut zusammen hatte, an den Wohnungstüren zu läuten und meine Geschichte zu erzählen. Auch die Lauferei den ganzen Tag macht mich sehr müde.“
Ich begann zu realisieren, dass Frau K. und ihre MitstreiterInnen eine enorme Leistung vollbringen. Anstatt auf irgendwelche Unterstützung vom Staat oder von Institutionen zu hoffen, nutzen diese Menschen ihre Ressourcen.
„Wir unterstützen solche Projekte und den Durchhaltewillen, den sie haben. Ich nehme gerne einige Karten“, sage ich mit grossem Respekt.
Ich bitte sie ins Büro herein und wähle 9 Karten mit Scherenschnitt-motiven aus. Frau K. ist sichtlich erleichtert, dass sie sich einen Moment hinsetzen kann. Ich stelle mir vor, wie es wohl ist, die ganze Woche durch an den Türen zu klingeln und immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Die Spannung auszuhalten, ob die Person an der anderen Seite der Türe einem freundlich begegnen wird oder nicht.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
„Guten Tag, meine Name ist M. K., bevor ich weiterspreche, lesen Sie bitte diese Karte.“ Sie überreicht mir eine laminierte Karte, darauf steht in einigen Sätzen, dass sie keine Bettlerin ist, eine seelische Krankheit hat und Karten verkauft. Auch wenn ich in den letzten Wochen etwas bedrängt worden war und an jedem Arbeitstag mit weiteren unerfüllbaren Wünschen von Menschen an der Türe zu rechnen habe, bin ich interessiert und frage die Frau, die etwa Mitte dreissig schien, wie sie zum Kartenverkauf gekommen ist. Ich merke bald, dass sie Mühe mit Sprechen hat. Sie stottert und wiederholt immer wieder einige Wörter. Trotzdem bemüht sie sich sehr und beantwortet bereitwillig meine Fragen:
„Ich war einige Male in einer psychiatrischen Klinik. Da ich mit meiner Krankheit keine Arbeitsstelle finde, habe ich mich mit 5 anderen Kollegen zusammengetan. Wir gestalten Karten, lassen sie drucken und verkaufen sie täglich in einer anderen Stadt. Morgens wirft jeweils mein Kollege einen Pfeil auf eine Landkarte an der Wand. Und dorthin fahren wir dann. Jeder für sich. Ausser einem, der hat Epilepsie, er trifft sich alle zwei Stunden mit jemanden von uns. Heute war ich mit St. Gallen dran. Wohnen tue ich übrigens in Kreuzlingen.“
„Und verkaufen sie viele Karten? Und was passiert mit dem Geld, das sie verdienen?“
"Ich und meine Mitarbeiter versuchen mit den Einnahmen zu leben. Ich wäre sonst von der Fürsorge abhängig und das möchte ich nicht. Unsere Karten kommen bei den Leuten gut an, weil sie in keinem Geschäft zu kaufen und günstiger sind. Zudem schätzen sie es, dass wir einen Weg gefunden haben, um Geld zu verdienen. Der Aufwand ist sehr gross. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht bis ich den Mut zusammen hatte, an den Wohnungstüren zu läuten und meine Geschichte zu erzählen. Auch die Lauferei den ganzen Tag macht mich sehr müde.“
Ich begann zu realisieren, dass Frau K. und ihre MitstreiterInnen eine enorme Leistung vollbringen. Anstatt auf irgendwelche Unterstützung vom Staat oder von Institutionen zu hoffen, nutzen diese Menschen ihre Ressourcen.
„Wir unterstützen solche Projekte und den Durchhaltewillen, den sie haben. Ich nehme gerne einige Karten“, sage ich mit grossem Respekt.
Ich bitte sie ins Büro herein und wähle 9 Karten mit Scherenschnitt-motiven aus. Frau K. ist sichtlich erleichtert, dass sie sich einen Moment hinsetzen kann. Ich stelle mir vor, wie es wohl ist, die ganze Woche durch an den Türen zu klingeln und immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Die Spannung auszuhalten, ob die Person an der anderen Seite der Türe einem freundlich begegnen wird oder nicht.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Öffned euri Auge
Die Gesellschaft isch i Unterschicht und Premium-Etage ufteilt
Me sitzed im gliche Boot, wie bim Tauzieh risse mo am gliche Seil
I bi nöd guet betuecht, doch für de Kampf bereit
Wie mo üs unterscheidet… de Life-Style
Vo une isch schwer zum ufe cho, bis d’Cheffi bricht
Nennet üs asozial, Parasite oder Terrorist
Ihr zahlet Stüre, reget eu uuf, i zeig eu e andri Weltsicht
Tusche mo üsi schueh, denn weisch wie s isch
Ide Schwiiz herrscht Demokratie, da cha nöd eure Ernst si
Seg dini Meinig, du wirsch wie z’Arabie gsteinigt
Machet vo eurer Bürokratie besser e Kopie
Sie wörfet sie in Papierchorb, scheisset uf di
Eifach isch es Frust wegsuufe
Wiil es schiint so als wär i i de Welt nöd z bruche
Jede isch sin Glückes Schmied, i kei 20x uf de Bode
Stoh uf und chum nöd as Ziil
Da isch lebe, da isch real, e Nummere i dem System
Jede het Problem, lueg d lüüt id Auge du wirsch gseh
Isch es verwunderlich dass es Überfäll giit und lüüt sich wönds lebe neh
I cha nöd vo Luft-Liebi lebe, schaff nöd für en Hungerlohn
I ha e bitz Asprüch und Fick die Nation
I bi im Chopf es Chind
Es cha nöd si dass me über ein bestimmt
I ha kei Motivation wenns heisst mach dies mach das
Öffned euri Auge und werdet wach.
anonym
Me sitzed im gliche Boot, wie bim Tauzieh risse mo am gliche Seil
I bi nöd guet betuecht, doch für de Kampf bereit
Wie mo üs unterscheidet… de Life-Style
Vo une isch schwer zum ufe cho, bis d’Cheffi bricht
Nennet üs asozial, Parasite oder Terrorist
Ihr zahlet Stüre, reget eu uuf, i zeig eu e andri Weltsicht
Tusche mo üsi schueh, denn weisch wie s isch
Ide Schwiiz herrscht Demokratie, da cha nöd eure Ernst si
Seg dini Meinig, du wirsch wie z’Arabie gsteinigt
Machet vo eurer Bürokratie besser e Kopie
Sie wörfet sie in Papierchorb, scheisset uf di
Eifach isch es Frust wegsuufe
Wiil es schiint so als wär i i de Welt nöd z bruche
Jede isch sin Glückes Schmied, i kei 20x uf de Bode
Stoh uf und chum nöd as Ziil
Da isch lebe, da isch real, e Nummere i dem System
Jede het Problem, lueg d lüüt id Auge du wirsch gseh
Isch es verwunderlich dass es Überfäll giit und lüüt sich wönds lebe neh
I cha nöd vo Luft-Liebi lebe, schaff nöd für en Hungerlohn
I ha e bitz Asprüch und Fick die Nation
I bi im Chopf es Chind
Es cha nöd si dass me über ein bestimmt
I ha kei Motivation wenns heisst mach dies mach das
Öffned euri Auge und werdet wach.
anonym
Kleine Wunder oder grossartige Zufälle
Auf einer langen Reise in Südamerika erlebte ein Mann unvergessliche Momente. Lassen Sie sich in die folgende eindrückliche Geschichte ein.
Iquitos, Peru - die grösste Stadt der Welt, die nicht über eine Strasse zu erreichen ist. Ein 500'000 - Einwohner - Moloch, einst von einer gierigen Ölindustrie und einer korrupten Regierung mitten in den Amazonas-Urwald geschlagen. Laut, heiss, feucht, verdreckt, hässlich. Kurz, das genaue Gegenteil des wunderbaren Waldes, der die Stadt umgibt.
Hier bin ich nun, habe mich noch nicht ganz von meiner Cholerainfektion erholt, die ich mir durch das Trinken von Flusswasser zugezogen habe. Trotzdem mache ich mich mit zwei peruanischen Freunden auf den Weg nach Kolumbien. Vier Tage flussabwärts auf einem Amazonasboot. Nach schweizer Massstäben passen ca. 50 Personen auf ein Boot dieser Grösse.
Aber die Schweiz ist weit weg. Also sind wir ca. 300. Man bringt seine eigene Hängematte mit und KÄMPFT! Nur am Heck gibt es ein bisschen Platz, um sich mal die Beine zu vertreten. Die meiste Zeit jedoch verbringt man in seiner Hängematte. Links ein Hintern, rechts Füsse im Gesicht. Am Morgen von Tag 3 unserer Reise bin ich fertig. Ich will nur noch RUNTER von dem Kutter. So stehe ich am Heck, rauche eine Zigarette und frage mich, warum ich, oder irgendjemand, um die ganze Welt fliege, um mir so was anzutun.
Genau in diesem Moment tauchen 5 rosa Flussdelphine (eine sehr seltene Spezie wurde mir gesagt) auf und schwimmen für Minuten mit dem Kahn mit. Als ob sie nur gekommen wären, um mich aus meinem Anschiss zu erretten. Unglaublich. Heute erinnere ich mich an diese (Horror-) Fahrt als eines der schönsten, unvergesslichsten Erlebnisse überhaupt.
Solche kleine Wunder, wunderbare Zufälle gab es in meinem Leben zuhauf. Und schon bald, da bin ich mir sicher, wird mir das nächste begegnen.
C. B.
Iquitos, Peru - die grösste Stadt der Welt, die nicht über eine Strasse zu erreichen ist. Ein 500'000 - Einwohner - Moloch, einst von einer gierigen Ölindustrie und einer korrupten Regierung mitten in den Amazonas-Urwald geschlagen. Laut, heiss, feucht, verdreckt, hässlich. Kurz, das genaue Gegenteil des wunderbaren Waldes, der die Stadt umgibt.
Hier bin ich nun, habe mich noch nicht ganz von meiner Cholerainfektion erholt, die ich mir durch das Trinken von Flusswasser zugezogen habe. Trotzdem mache ich mich mit zwei peruanischen Freunden auf den Weg nach Kolumbien. Vier Tage flussabwärts auf einem Amazonasboot. Nach schweizer Massstäben passen ca. 50 Personen auf ein Boot dieser Grösse.
Aber die Schweiz ist weit weg. Also sind wir ca. 300. Man bringt seine eigene Hängematte mit und KÄMPFT! Nur am Heck gibt es ein bisschen Platz, um sich mal die Beine zu vertreten. Die meiste Zeit jedoch verbringt man in seiner Hängematte. Links ein Hintern, rechts Füsse im Gesicht. Am Morgen von Tag 3 unserer Reise bin ich fertig. Ich will nur noch RUNTER von dem Kutter. So stehe ich am Heck, rauche eine Zigarette und frage mich, warum ich, oder irgendjemand, um die ganze Welt fliege, um mir so was anzutun.
Genau in diesem Moment tauchen 5 rosa Flussdelphine (eine sehr seltene Spezie wurde mir gesagt) auf und schwimmen für Minuten mit dem Kahn mit. Als ob sie nur gekommen wären, um mich aus meinem Anschiss zu erretten. Unglaublich. Heute erinnere ich mich an diese (Horror-) Fahrt als eines der schönsten, unvergesslichsten Erlebnisse überhaupt.
Solche kleine Wunder, wunderbare Zufälle gab es in meinem Leben zuhauf. Und schon bald, da bin ich mir sicher, wird mir das nächste begegnen.
C. B.
Ich danke Gott
Ein junger Mann erlebte die Zeit in einem Heim als ein Wechselbad der Gefühle: Liebe und Entäuschung, Hoffnung und Zorn. Seine Erfahrungen beschreibt er in einem Rap.
Manchmal gab es Zeiten, wo mir alles sinnlos vorkam
und ich nicht mehr die Sonne sah an jenem Tag
Mir ging es schlecht
Ich dachte mich verfolgt das Pech
Aber ich war selbst schuld an meiner Situation
doch ich checkte nicht, dass das Gras daran schuld war
ich wusste gar nicht mehr, was ich tat
Mein Glauben war verloren
Ich wollte niemanden mehr lieben, mein Herz war gefroren!
Doch der Vater gab mir immer wieder Zeichen
langsam begriff ich und fing an zu beichten
Er führte mich zu einem Mädchen, das ich liebte
Und ich spürte Wärme und wie das Gute in mir siegte.
Sie ist seit langem gegangen
Es war schade, denn mir war, als ob wir uns schon ewig kannten!
Ich glaube wieder an Gott, und dass es ihn gibt
und ich weiss, dass er herunterschaut und jeden von uns liebt
Er hilft mir immer wenn ich ihn brauche
Aber er gibt dir nichts umsonst
Es ist, als ob man ein Kind für schlechtes Benehmen lobt
Keine schlechte Stimmung mehr
Doch bis dahin ertrag ich den Schmerz
den mir die Erzieher zufügen
Irgendwann werden sie auch dafür büssen
Und dann lache ich mich kaputt
Ich schaffe meinen Durchbruch
Während ihr nur Jüngere quält
Fliege ich um die grosse weite Welt
Verliere niemals die Hoffnung und bete
Das ist der beste aller Wege
Sie sagen, sie haben uns gern und bestrafen uns ungern
Aber in Wirklichkeit werden sie sich um keinen Dreck scheren
Sie können wieder nach Hause gehen
und nach einem Monat in der Bank ihr Konto sehn
Sie machen sich keine Bedenken
Wenn ihr uns schon anlügt
und von vorne bis hinten betrügt.
Dann habt zumindest ein schlechtes Gewissen am Abend
ihr kleinen hässlichen Dreckschaben
Kommt auf die Strasse, dann machen wirs nach meiner
Masche.
M.B.
Manchmal gab es Zeiten, wo mir alles sinnlos vorkam
und ich nicht mehr die Sonne sah an jenem Tag
Mir ging es schlecht
Ich dachte mich verfolgt das Pech
Aber ich war selbst schuld an meiner Situation
doch ich checkte nicht, dass das Gras daran schuld war
ich wusste gar nicht mehr, was ich tat
Mein Glauben war verloren
Ich wollte niemanden mehr lieben, mein Herz war gefroren!
Doch der Vater gab mir immer wieder Zeichen
langsam begriff ich und fing an zu beichten
Er führte mich zu einem Mädchen, das ich liebte
Und ich spürte Wärme und wie das Gute in mir siegte.
Sie ist seit langem gegangen
Es war schade, denn mir war, als ob wir uns schon ewig kannten!
Ich glaube wieder an Gott, und dass es ihn gibt
und ich weiss, dass er herunterschaut und jeden von uns liebt
Er hilft mir immer wenn ich ihn brauche
Aber er gibt dir nichts umsonst
Es ist, als ob man ein Kind für schlechtes Benehmen lobt
Keine schlechte Stimmung mehr
Doch bis dahin ertrag ich den Schmerz
den mir die Erzieher zufügen
Irgendwann werden sie auch dafür büssen
Und dann lache ich mich kaputt
Ich schaffe meinen Durchbruch
Während ihr nur Jüngere quält
Fliege ich um die grosse weite Welt
Verliere niemals die Hoffnung und bete
Das ist der beste aller Wege
Sie sagen, sie haben uns gern und bestrafen uns ungern
Aber in Wirklichkeit werden sie sich um keinen Dreck scheren
Sie können wieder nach Hause gehen
und nach einem Monat in der Bank ihr Konto sehn
Sie machen sich keine Bedenken
Wenn ihr uns schon anlügt
und von vorne bis hinten betrügt.
Dann habt zumindest ein schlechtes Gewissen am Abend
ihr kleinen hässlichen Dreckschaben
Kommt auf die Strasse, dann machen wirs nach meiner
Masche.
M.B.
Zurück nach Hause
Der Alltag beim Sozialdienst bietet oft Überraschungen. Menschen mit unterschiedlichsten Lebenswegen und Anliegen treten mit uns in Kontakt. Die folgende Geschichte handelt von einer solchen spannenden Begegnung.
Ein junger Mann, mit einem grossen Rucksack auf dem Rücken, steht vor der Türe und sagt, dass er kein Geld habe und zurück nach Hause will. Ich blicke in ein aufgewühltes und verängstigtes Gesicht, glaube ihm sofort und bitte ihn herein.
"Woher kommen Sie?"
"Aus Nürnberg. Mein Freund hat mich im Stich gelassen und ist abgehauen. Da er als Schwerstbehinderter eine Bahnkarte besitzt, die es erlaubt eine Begleitperson umsonst mitzuführen, bat er mich mit nach Zürich zu fahren. Ich fand das sei eine gute Idee, da ich noch nie in der Schweiz war. Ich wusste nicht mal, dass das Land nicht zur EU gehört. Wir übernachteten in Zürich unter dem Dach eines Schulhauses, und als ich erwachte, war mein Freund verschwunden. Ich wollte zurück nach Hause, erzählte am Bahnhof den Schaffnern von drei verschiedenen Zügen meine Geschichte und fragte, ob ich umsonst mitfahren kann. Der dritte Angefragte sagte okay und liess mich einsteigen. In St. Gallen fragte ich die Passanten, ob sie mir helfen können. Eine Frau gab mir 5 Franken. Eine andere Person sagte mir, ich solle zum Dom gehen. Dort schickte man mich zu Ihnen. Mir geht es gar nicht gut. Ich will wieder nach Hause."
"Wovon leben Sie in Nürnberg?"
"Ich bin momentan arbeitslos, lebe von der Sozialhilfe und wohne in einer betreuten Wohngemeinschaft."
Ich betrachte ihn und merke, dass er zuversichtlicher wirkt. Er zeigt mir seinen Schwerstbehinderten-Ausweis, der 2003 ausgestellt wurde. Ungläubig schaue ich ihn an und frage:"Ja, aber wo ist denn Ihre schwere Behinderung?"
"Die ist psychisch."
Noch immer ganz erstaunt denke ich darüber nach, wie es der Mann schaffen konnte, sich nach St. Gallen durchzuschlagen und wie ihm die Leute geholfen haben. Ich verspüre ein wenig Stolz und bin dankbar, dass es Menschen gibt, die bereit sind, spontan zu helfen.
Wir rechnen den Preis für die Heimfahrt aus, die ab Bregenz dank einer Tageskarte für ganz Bayern überraschend günstig ausfällt. Der junge Mann entspannt sich sichtlich, da er begreift, dass er heute mit unserer Hilfe wieder nach Hause kommen wird. Ich frage ihn, ob ihn noch etwas bedrückt, oder ob er uns was erzählen möchte. Er schüttelt den Kopf und meint nur: "Es ist mir eine Lehre, nicht einfach mit einem Kollegen mitzufahren. Das werde ich nicht mehr tun. Die Schweiz gefällt mir, nur die Menschen sind anders. Wenn ich hier leben würde, müsste ich mich zuerst an die Mentalität gewöhnen. Aufgefallen ist mir auch, dass die Strassenbeschilderung in Deutschland besser ist als hier."
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Ein junger Mann, mit einem grossen Rucksack auf dem Rücken, steht vor der Türe und sagt, dass er kein Geld habe und zurück nach Hause will. Ich blicke in ein aufgewühltes und verängstigtes Gesicht, glaube ihm sofort und bitte ihn herein.
"Woher kommen Sie?"
"Aus Nürnberg. Mein Freund hat mich im Stich gelassen und ist abgehauen. Da er als Schwerstbehinderter eine Bahnkarte besitzt, die es erlaubt eine Begleitperson umsonst mitzuführen, bat er mich mit nach Zürich zu fahren. Ich fand das sei eine gute Idee, da ich noch nie in der Schweiz war. Ich wusste nicht mal, dass das Land nicht zur EU gehört. Wir übernachteten in Zürich unter dem Dach eines Schulhauses, und als ich erwachte, war mein Freund verschwunden. Ich wollte zurück nach Hause, erzählte am Bahnhof den Schaffnern von drei verschiedenen Zügen meine Geschichte und fragte, ob ich umsonst mitfahren kann. Der dritte Angefragte sagte okay und liess mich einsteigen. In St. Gallen fragte ich die Passanten, ob sie mir helfen können. Eine Frau gab mir 5 Franken. Eine andere Person sagte mir, ich solle zum Dom gehen. Dort schickte man mich zu Ihnen. Mir geht es gar nicht gut. Ich will wieder nach Hause."
"Wovon leben Sie in Nürnberg?"
"Ich bin momentan arbeitslos, lebe von der Sozialhilfe und wohne in einer betreuten Wohngemeinschaft."
Ich betrachte ihn und merke, dass er zuversichtlicher wirkt. Er zeigt mir seinen Schwerstbehinderten-Ausweis, der 2003 ausgestellt wurde. Ungläubig schaue ich ihn an und frage:"Ja, aber wo ist denn Ihre schwere Behinderung?"
"Die ist psychisch."
Noch immer ganz erstaunt denke ich darüber nach, wie es der Mann schaffen konnte, sich nach St. Gallen durchzuschlagen und wie ihm die Leute geholfen haben. Ich verspüre ein wenig Stolz und bin dankbar, dass es Menschen gibt, die bereit sind, spontan zu helfen.
Wir rechnen den Preis für die Heimfahrt aus, die ab Bregenz dank einer Tageskarte für ganz Bayern überraschend günstig ausfällt. Der junge Mann entspannt sich sichtlich, da er begreift, dass er heute mit unserer Hilfe wieder nach Hause kommen wird. Ich frage ihn, ob ihn noch etwas bedrückt, oder ob er uns was erzählen möchte. Er schüttelt den Kopf und meint nur: "Es ist mir eine Lehre, nicht einfach mit einem Kollegen mitzufahren. Das werde ich nicht mehr tun. Die Schweiz gefällt mir, nur die Menschen sind anders. Wenn ich hier leben würde, müsste ich mich zuerst an die Mentalität gewöhnen. Aufgefallen ist mir auch, dass die Strassenbeschilderung in Deutschland besser ist als hier."
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Immer unterwegs
Ein 56-jähriger Mann taucht beim Sozialdienst auf und erzählt stolz von seiner Lebensweise, die ihn kreuz und quer durch Deutschland geführt hat. Schlussendlich sucht er sein Glück in Österreich und in der Schweiz.
Ich wuchs in Oberfranken in einer Familie mit fünf Geschwistern auf. Mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt war. Als ich mit 14 aus der Schule kam, hatte meine Mutter einen Freund. Ich bekam Streit mit ihm, weil ich fand, dass er mir nichts zu sagen habe. Darauf warf mich meine Mutter aus der Wohnung. Ich konnte mir den Keller zum Schlafen einrichten. Strom zapfte ich von der Wohnung oben ab, so hatte ich wenigstens Licht.
Ich fing dann eine Lehre als Maler an, aber ich verdiente nur 15 Mark in der Woche. Da hörte ich wieder auf und arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Spinnerei.
Damals, als Jugendlicher, war ich ein Kämpfer. Wenn mir einer nicht passte, gab es halt eins auf die Rübe. Darum hatte ich auch 36 Vorstrafen.
Nach dem „Kindergarten“, so sage ich der Bundeswehr, wohnte ich in Männerwohnheimen. Wegen der Bevormundung dort blieb ich aber nie lange an einem Ort: Frankfurt, Stuttgart… Ich bin sowieso ein reiselustiger Mensch! Per Autostop bin ich bis nach Hamburg hoch, weil ich nach England wollte. Das klappte aber nicht, und so fuhr ich über Köln und Frankfurt wieder zurück.
In München war ich dann einmal unschuldig im Knast. Es wurde mir vorgeworfen, ein älteres Ehepaar bedroht zu haben. Als aber die Wahrheit herauskam, erhielt ich eine Wiedergutmachung. Lange Zeit brachte ich mich als Gelegenheitsarbeiter in der Gastronomie und Landwirtschaft durch. Aber da wurde ich oft ausgenutzt. Zwischendurch machte ich auch gar nichts. Doch mit Hartz IV kann man ja nicht leben: „Zu wenig zum Leben, zuviel um zu sterben.“
Zuletzt suchte ich in Bayern Arbeit, fand aber keine. Auch in Bregenz und Dornbirn hatte ich kein Glück. Per Autostop kam ich dann von Österreich in die Schweiz. Jetzt suche ich im Kanton St. Gallen eine Arbeitsstelle. Doch das ist schwierig: „Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung!“ Aber betteln tue ich nicht! Da habe ich ein Schamgefühl.
Den jungen Leuten sage ich darum auch, sie sollen etwas aus ihrem Leben machen und einen Beruf erlernen. Und dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen und nicht mit „schlechten“ Leuten abhängen. Ich selbst habe keine Zukunft mehr; ich habe meinen Lebensstil, und so mache ich weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen!
anonym
Ich wuchs in Oberfranken in einer Familie mit fünf Geschwistern auf. Mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt war. Als ich mit 14 aus der Schule kam, hatte meine Mutter einen Freund. Ich bekam Streit mit ihm, weil ich fand, dass er mir nichts zu sagen habe. Darauf warf mich meine Mutter aus der Wohnung. Ich konnte mir den Keller zum Schlafen einrichten. Strom zapfte ich von der Wohnung oben ab, so hatte ich wenigstens Licht.
Ich fing dann eine Lehre als Maler an, aber ich verdiente nur 15 Mark in der Woche. Da hörte ich wieder auf und arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Spinnerei.
Damals, als Jugendlicher, war ich ein Kämpfer. Wenn mir einer nicht passte, gab es halt eins auf die Rübe. Darum hatte ich auch 36 Vorstrafen.
Nach dem „Kindergarten“, so sage ich der Bundeswehr, wohnte ich in Männerwohnheimen. Wegen der Bevormundung dort blieb ich aber nie lange an einem Ort: Frankfurt, Stuttgart… Ich bin sowieso ein reiselustiger Mensch! Per Autostop bin ich bis nach Hamburg hoch, weil ich nach England wollte. Das klappte aber nicht, und so fuhr ich über Köln und Frankfurt wieder zurück.
In München war ich dann einmal unschuldig im Knast. Es wurde mir vorgeworfen, ein älteres Ehepaar bedroht zu haben. Als aber die Wahrheit herauskam, erhielt ich eine Wiedergutmachung. Lange Zeit brachte ich mich als Gelegenheitsarbeiter in der Gastronomie und Landwirtschaft durch. Aber da wurde ich oft ausgenutzt. Zwischendurch machte ich auch gar nichts. Doch mit Hartz IV kann man ja nicht leben: „Zu wenig zum Leben, zuviel um zu sterben.“
Zuletzt suchte ich in Bayern Arbeit, fand aber keine. Auch in Bregenz und Dornbirn hatte ich kein Glück. Per Autostop kam ich dann von Österreich in die Schweiz. Jetzt suche ich im Kanton St. Gallen eine Arbeitsstelle. Doch das ist schwierig: „Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung!“ Aber betteln tue ich nicht! Da habe ich ein Schamgefühl.
Den jungen Leuten sage ich darum auch, sie sollen etwas aus ihrem Leben machen und einen Beruf erlernen. Und dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen und nicht mit „schlechten“ Leuten abhängen. Ich selbst habe keine Zukunft mehr; ich habe meinen Lebensstil, und so mache ich weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen!
anonym
Doch es gibt immer einen Weg
Lesen Sie das Dokument einer jungen Frau, die lange alleine gelebt hat und von den Drogen weggekommen ist. Die Verbundenheit zur Natur hat ihr oft geholfen. „Egal, was du glaubst“, sagt sie, „solange du die Bäume rauschen hörst.“
Hallo. Ich bin Nathalie Petitjean und bin 28 Jahre alt. Ich bin Französin, bin aber in St. Gallen geboren und bin immer noch hier, ich hatte aber auch sehr schwere Zeiten, aber zum Glück war ich nie alleine in den schweren Zeiten, sondern meine sehr treuen Begleiter, Dingo und Fox, meine Hunde, waren immer für mich da. Für manche tönt das lächerlich, ist es aber nicht. Und das rate ich allen Menschen, egal, was andere denken, sagen oder machen, das, was ihnen wichtig ist, daran müssen sie festhalten und glauben, darauf müssen sie vertrauen. Ich dachte auch schon, dass es nicht mehr weitergeht, aber es gibt immer einen Weg und eine Lösung für den Kummer. Hilfe kann man sich auch holen, man muss sich aber auch helfen lassen.
Und noch was zum Schluss: Gib nie auf, denke positiv, auch wenn es nur einen Hauch Gutes gibt und glaube an dich. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Nathalie Petitjean
Hallo. Ich bin Nathalie Petitjean und bin 28 Jahre alt. Ich bin Französin, bin aber in St. Gallen geboren und bin immer noch hier, ich hatte aber auch sehr schwere Zeiten, aber zum Glück war ich nie alleine in den schweren Zeiten, sondern meine sehr treuen Begleiter, Dingo und Fox, meine Hunde, waren immer für mich da. Für manche tönt das lächerlich, ist es aber nicht. Und das rate ich allen Menschen, egal, was andere denken, sagen oder machen, das, was ihnen wichtig ist, daran müssen sie festhalten und glauben, darauf müssen sie vertrauen. Ich dachte auch schon, dass es nicht mehr weitergeht, aber es gibt immer einen Weg und eine Lösung für den Kummer. Hilfe kann man sich auch holen, man muss sich aber auch helfen lassen.
Und noch was zum Schluss: Gib nie auf, denke positiv, auch wenn es nur einen Hauch Gutes gibt und glaube an dich. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Nathalie Petitjean
Vom Pfarrer zum Stricher
Beim Sozialdienst melden sich Menschen mit unterschiedlichsten Anliegen und Bedürfnissen. Lesen Sie über den wundersamen Abstieg vom Pfarrer bis zum Stricher im Originalton.
Grüezi! Sind Sie der Herr Pfarrer?
Nein?
Ja gut. Mein Name ist (…) und ich verkaufe Tücher und Servietten. Sie können sicher so was gebrauchen. Ich bin eben in Not und brauche Geld. Hier, sehen Sie! Zum Beispiel dieses fünffache Frotté-Set für – sagen wir – 45 Stutz mit Tuch, Waschlappen, Bodenleger …
Bitte? Sie haben gar keine Dusche im Büro?!
Aber dann können Sie dieses Set von Handtüchern gebrauchen! Sehen Sie, drei in einem Pack für 20 Franken.
Wieso nicht? Also bitte: Hände waschen müssen auch Sie!
Was? Nein! He! Es geht nicht um meine Situation! Ich brauche Geld, weil ich Rechnungen bezahlen muss! Ich wohne auch hier im Kreis Ost.
Wo? An der (…)-Strasse. Ich wurde vorhin von (…) hierher geschickt.
Oder sind Sie an Servietten interessiert? An diesen hier?
Nein, die sind aus Stoff und nicht aus Papier.
Also: Was ist jetzt?
Woher ich diese Ware habe? Ja – ich handle einfach damit. Ich lebe davon!
Wieso Hehlerei? Goht’s no?!
Nein? Sie wollen nichts kaufen? Auch nichts dafür geben?
Was „Sie haben kein Geld!“ ?? Sie haben doch wohl noch etwas Bargeld bei sich! Am Abend gibst Du es ja auch für die Weiber aus, oder?
Wie ich das meine? Hör mal! Was?
Ja, Du Dödel, warum sagst du das nicht gleich zu Beginn und lässt mich zuerst alles auspacken?
Damminoämolä!
Dann sag doch gleich, dass du nichts willst, du Arschloch! Und jetzt geh wieder zurück hinter deine verdammte Türe und schliesse sie schön hinter deinem blöden Gesicht ab! Du Pisser, Nuttensohn, Stricher!
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
Grüezi! Sind Sie der Herr Pfarrer?
Nein?
Ja gut. Mein Name ist (…) und ich verkaufe Tücher und Servietten. Sie können sicher so was gebrauchen. Ich bin eben in Not und brauche Geld. Hier, sehen Sie! Zum Beispiel dieses fünffache Frotté-Set für – sagen wir – 45 Stutz mit Tuch, Waschlappen, Bodenleger …
Bitte? Sie haben gar keine Dusche im Büro?!
Aber dann können Sie dieses Set von Handtüchern gebrauchen! Sehen Sie, drei in einem Pack für 20 Franken.
Wieso nicht? Also bitte: Hände waschen müssen auch Sie!
Was? Nein! He! Es geht nicht um meine Situation! Ich brauche Geld, weil ich Rechnungen bezahlen muss! Ich wohne auch hier im Kreis Ost.
Wo? An der (…)-Strasse. Ich wurde vorhin von (…) hierher geschickt.
Oder sind Sie an Servietten interessiert? An diesen hier?
Nein, die sind aus Stoff und nicht aus Papier.
Also: Was ist jetzt?
Woher ich diese Ware habe? Ja – ich handle einfach damit. Ich lebe davon!
Wieso Hehlerei? Goht’s no?!
Nein? Sie wollen nichts kaufen? Auch nichts dafür geben?
Was „Sie haben kein Geld!“ ?? Sie haben doch wohl noch etwas Bargeld bei sich! Am Abend gibst Du es ja auch für die Weiber aus, oder?
Wie ich das meine? Hör mal! Was?
Ja, Du Dödel, warum sagst du das nicht gleich zu Beginn und lässt mich zuerst alles auspacken?
Damminoämolä!
Dann sag doch gleich, dass du nichts willst, du Arschloch! Und jetzt geh wieder zurück hinter deine verdammte Türe und schliesse sie schön hinter deinem blöden Gesicht ab! Du Pisser, Nuttensohn, Stricher!
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
Lebensfreude
Seit über 10 Jahren ist Frau W. im Heroinprogramm, mit dem es ihr möglich ist, ein geregeltes Leben zu führen. Wie ihr Alltag aussieht, beschreibt sie in einigen Sätzen.
Vor vielen Jahren besuchte ich oft die Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus in Wil. Dort konnte ich mit meinen Sorgen und Nöten hin, es war immer jemand da, der mir zuhörte. Über den Kaktus konnte ich zudem einige Jahre in einer WG mit anderen Frauen, oder auch gemischt, wohnen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, einmal ohne Drogen zu leben. Deshalb war ich sehr interessiert, als ich von der Heroinabgabe in St. Gallen hörte. Über die Leute vom Kaktus habe ich dann die Anmeldung gemacht, bin aufgenommen worden und fahre nun schon mehr als 10 Jahre zweimal täglich nach St. Gallen. Die Bahnstrecke kenne ich jetzt in- und auswendig, aber macht ja nichts.
Die Heroinabgabe hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu bekommen und Abstand von der Gasse zu gewinnen. Seit einigen Jahren arbeite ich auch wieder. In geschützten Werkstätten habe ich sinnvolle Beschäftigungen gefunden. Zurzeit arbeite ich in einer Werkstätte auf dem Lande. Das braucht nach der morgendlichen Heroinabgabe nochmals eine Zugfahrt. Da kenne ich bisher noch nicht alles in- und auswendig, macht auch nichts.
Ich bin nach wie vor froh, dass ich am Heroinprogramm teilnehmen kann. Es ist mir so möglich, ein geregeltes Leben zu führen. Erfreulich ist auch, dass ich seit einigen Jahren wieder guten Kontakt mit meiner Familie pflegen kann.
So kann mein Leben gerne weitergehen...
Karin W.
Vor vielen Jahren besuchte ich oft die Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus in Wil. Dort konnte ich mit meinen Sorgen und Nöten hin, es war immer jemand da, der mir zuhörte. Über den Kaktus konnte ich zudem einige Jahre in einer WG mit anderen Frauen, oder auch gemischt, wohnen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, einmal ohne Drogen zu leben. Deshalb war ich sehr interessiert, als ich von der Heroinabgabe in St. Gallen hörte. Über die Leute vom Kaktus habe ich dann die Anmeldung gemacht, bin aufgenommen worden und fahre nun schon mehr als 10 Jahre zweimal täglich nach St. Gallen. Die Bahnstrecke kenne ich jetzt in- und auswendig, aber macht ja nichts.
Die Heroinabgabe hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu bekommen und Abstand von der Gasse zu gewinnen. Seit einigen Jahren arbeite ich auch wieder. In geschützten Werkstätten habe ich sinnvolle Beschäftigungen gefunden. Zurzeit arbeite ich in einer Werkstätte auf dem Lande. Das braucht nach der morgendlichen Heroinabgabe nochmals eine Zugfahrt. Da kenne ich bisher noch nicht alles in- und auswendig, macht auch nichts.
Ich bin nach wie vor froh, dass ich am Heroinprogramm teilnehmen kann. Es ist mir so möglich, ein geregeltes Leben zu führen. Erfreulich ist auch, dass ich seit einigen Jahren wieder guten Kontakt mit meiner Familie pflegen kann.
So kann mein Leben gerne weitergehen...
Karin W.
Meine Geschichte
Ein 41-jähriger Mann erzählt, wie er von seiner Drogenabhängigkeit loszukommen versuchte. Ein eindrückliches Dokument.
Vor zirka 1,5 Jahren war ich ziemlich am Ende. Ich bin 41 Jahre alt und davon 21 Jahre heroinabhängig. Nach mehreren Entzügen, Klinikaufenthalten und Therapien sagte ich zu mir, es ist genug. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich dachte an die Vergangenheit zurück, was ich alles so erlebt habe, von Amoklauf bis zur Beschaffungskriminalität und vieles mehr. Ich dachte, soll ich vor den Zug stehen oder soll ich es nochmals versuchen loszukommen und ein normales Leben zu führen. Ich ging ins MSH2 Methadonabgabe zu meiner Bezugsperson und Ärztin. Ich bekam zuerst mal ein stärkeres Psychopharmaka, das mir sehr geholfen hat und mich vom Selbstmord abhielt, und nachdem ich mich etwas erholt hatte, ging ich in die Klinik Pfäfers und lernte dort eine Therapieangebot kennen im Tessin, das Camarco. Ich entschloss mich in diese Therapie zu gehen. Ich erkundigte mich und als alles klar war, löste ich meine Zweizimmerwohnung auf. Ich machte den Entzug im Camarco vom Methadon. Nach 1,5 Monaten war ich clean und nach ca. 3 Monaten habe ich die Therapie aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Weil es zum Beispiel Ungerechtigkeiten gab und das Konzept nicht eingehalten wurde und ein Haufen konsumiert wurde, ins Büro eingebrochen wurde und verschiedene Diebstähle begangen worden sind und trotzdem nichts Ernsthaftes passiert ist. Anschliessend ging ich vorübergehend zu meiner Mutter für ca. einen Monat. Dann entschloss ich mich weiterzumachen und ging in die Klinik Pfäfers. Da musste ich gehen, weil ich einmal nicht ins Turnen ging. Also wieder zu der Mutter. Ich meldete mich in der Klinik Wil an. Also liess ich mich von der Ärztin einweisen, dann konnte ich nach ein paar Tagen in die Klinik Wil. Dort machte ich wieder den Entzug bis auf 10mg Methadon. Bis dahin vergingen fast 1,5 Jahre. Ich hatte langsam genug von Therapien und Klinikaufenthalten und brach ab. Und wieder zu der Mutter. Nach ca. 2,5 Monaten hatte ich wieder eine Wohnung. Das war ein Stress bis ich wieder eingerichtet war und die Wohnung endlich hatte. Jetzt habe ich mich mit meiner Situation abgefunden, dass ich im MSH2 bin und halt die 40mg Methadon einfach brauche, wie andere Medikamente brauchen. Ich arbeite jetzt auch 50%, nachmittags. Ich werde bald 42 und vielleicht schaffe ich es ja mal. Das ist meine Vergangenheit.
Alfons
Vor zirka 1,5 Jahren war ich ziemlich am Ende. Ich bin 41 Jahre alt und davon 21 Jahre heroinabhängig. Nach mehreren Entzügen, Klinikaufenthalten und Therapien sagte ich zu mir, es ist genug. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich dachte an die Vergangenheit zurück, was ich alles so erlebt habe, von Amoklauf bis zur Beschaffungskriminalität und vieles mehr. Ich dachte, soll ich vor den Zug stehen oder soll ich es nochmals versuchen loszukommen und ein normales Leben zu führen. Ich ging ins MSH2 Methadonabgabe zu meiner Bezugsperson und Ärztin. Ich bekam zuerst mal ein stärkeres Psychopharmaka, das mir sehr geholfen hat und mich vom Selbstmord abhielt, und nachdem ich mich etwas erholt hatte, ging ich in die Klinik Pfäfers und lernte dort eine Therapieangebot kennen im Tessin, das Camarco. Ich entschloss mich in diese Therapie zu gehen. Ich erkundigte mich und als alles klar war, löste ich meine Zweizimmerwohnung auf. Ich machte den Entzug im Camarco vom Methadon. Nach 1,5 Monaten war ich clean und nach ca. 3 Monaten habe ich die Therapie aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Weil es zum Beispiel Ungerechtigkeiten gab und das Konzept nicht eingehalten wurde und ein Haufen konsumiert wurde, ins Büro eingebrochen wurde und verschiedene Diebstähle begangen worden sind und trotzdem nichts Ernsthaftes passiert ist. Anschliessend ging ich vorübergehend zu meiner Mutter für ca. einen Monat. Dann entschloss ich mich weiterzumachen und ging in die Klinik Pfäfers. Da musste ich gehen, weil ich einmal nicht ins Turnen ging. Also wieder zu der Mutter. Ich meldete mich in der Klinik Wil an. Also liess ich mich von der Ärztin einweisen, dann konnte ich nach ein paar Tagen in die Klinik Wil. Dort machte ich wieder den Entzug bis auf 10mg Methadon. Bis dahin vergingen fast 1,5 Jahre. Ich hatte langsam genug von Therapien und Klinikaufenthalten und brach ab. Und wieder zu der Mutter. Nach ca. 2,5 Monaten hatte ich wieder eine Wohnung. Das war ein Stress bis ich wieder eingerichtet war und die Wohnung endlich hatte. Jetzt habe ich mich mit meiner Situation abgefunden, dass ich im MSH2 bin und halt die 40mg Methadon einfach brauche, wie andere Medikamente brauchen. Ich arbeite jetzt auch 50%, nachmittags. Ich werde bald 42 und vielleicht schaffe ich es ja mal. Das ist meine Vergangenheit.
Alfons
Arbeitslos
Arbeitslos, wie fühlt sich das an? Ein Mann beschreibt seinen Alltag und seinen Umgang mit Arbeitslosigkeit. Lassen Sie sich überraschen!
Gerne stelle ich mich vor und erzähle von meiner Arbeitslosigkeit und wie ich sie bewältige: Ich heisse Roger, bin 47 Jahre alt und seit dem 1. November 2008 arbeitslos. Ich bin nicht das erste Mal arbeitslos, das letzte Mal vor 10 Jahren, allerdings war ich damals nur gerade 3 Monate ohne Stelle. Warum ich damals schneller einen Job gefunden habe? Ganz einfach: Ich war 10 Jahre jünger und die Wirtschaftslage war besser als heute!
In dem Alter und bei der heutigen Wirtschaftslage eine Stelle zu finden ist sehr schwierig, leider will das kein Stellenvermittlungsbüro zugeben. Sie versprechen einem das Blaue vom Himmel herunter: „Nein, nein, Sie sind überhaupt nicht zu alt.“ Oder: „Mit Ihren Qualifikationen werden Sie schnell wieder eine Stelle finden.“ Den Vogel abgeschossen hat allerdings die Filiale eines bekannten Stellenvermittlungsbüros. Ich habe mich dort um eine Temporärstelle beworben, wo Französischkenntnisse verlangt wurden. Per Mail hat mir die Dame mitgeteilt, dass ich sie anrufen solle. Als ich sie dann an einem Mittwoch angerufen habe, hat sie mir mitgeteilt, es sei schade, dass ich mich nicht früher gemeldet hätte, sie hätten sehr lange jemanden für eine andere Stelle mit guten Französisch-kenntnissen gesucht, nun sei die Stelle leider bereits vergeben. Ich habe ihr dann entgegnet, dass ich mich für die Temporärstelle beworben hätte. Sie hat mir dann gesagt: „Wenn Sie bis Freitag nichts von mir hören, kommen Sie für diese Stelle nicht in Frage.“ Während des ganzen Telefonates hat mir mein Gefühl gesagt, dass mich die Dame von A – Z angelogen hat. Natürlich habe ich bis Freitag nichts gehört. Am Montag habe ich ihr ein Mail gesandt, mit der Frage, sie möge mir doch mitteilen, warum ich die Stelle nicht erhalten hätte. Sie hat es nicht einmal für nötig gefunden mir zu antworten! Zwei Tage später habe ich ihr gemailt, sie möchte meine Unterlagen vernichten, ich verzichte auf eine Zusammenarbeit mit ihrer Filiale. Mir scheint, dass die Stellenvermittlungsbüros kein Interesse haben, mich zu vermitteln, oder wissen sie, dass ich schwer vermittelbar bin und sagen es mir nur nicht (siehe oben)?
Als ich an einem Donnerstagnachmittag einkaufen ging, habe ich einen Bekannten von mir getroffen, er war früher Personalchef. Nach einem längeren Gespräch hat er mir bestätigt, dass ich für den Arbeitsmarkt zu alt sei. Ich sei eben näher bei 50 als bei 40, hat er mir gesagt. Schöne Aussichten, nicht?
Ich bin vielseitig interessiert. Damit ich die mir nun zur Verfügung stehend Zeit sinnvoll nutzen kann, habe ich mir einen Plan gemacht, was ich an welchem Morgen tun werde. Dieser Plan sieht folgendermassen aus:
Montag: Englisch lesen und schreiben
Dienstag: Deutsch
Mittwoch: Französisch lesen und schreiben
Donnerstag: Psychologiebuch lesen (Zimbardo)
Freitag: Studium des Biologiebuches von Neil A. Campbell. Dies ist das Buch, welches Biologiestudenten für ihr Studium benötigen. Es umfasst 1600 Seiten und ist 2kg schwer! Ein äusserst interessantes Buch!
Im Oktober 2009 habe ich an der Akademie St. Gallen mit der 3jährigen Weiterbildung zum Betriebswirtschafter HF begonnen. So musste ich obigen Plan dahingehend ändern, dass die Schulfächer Vorrang haben. Der geänderte Plan sieht nun folgendermassen aus:
Montag: Betriebswirtschaftliches Modell (anhand des St. Galler Management-Modells)
Dienstag: Volkswirtschaftslehre
Mittwoch: Unternehmenslogistik
Donnerstag: Finanz- und Rechnungswesen
Freitag: Organisation
Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, halte ich mich weiterhin an den alten Plan.
Ich würde nie am Mittag für mich alleine kochen (ausser am Sonntag), da ich dies auch als reine Zeitverschwendung empfinde. Es ist nicht so, dass ich nicht kochen könnte, aber ich esse nicht gerne alleine. In einem Restaurant hat es immer viele Leute, da gibt’s immer was zu beobachten, manchmal treffe ich auch jemanden, den ich kenne. Deshalb esse ich jeden Mittag in einem anderen Restaurant: Am Montag gehe ich mit einem ehemaligen Schulkollegen essen, am Dienstag war ich bis jetzt am Mittagstisch der Pfarrei am Dom. Da es ihn nicht mehr gibt, gehe ich jetzt im ‚Gschwend’ essen, am Mittwoch im Rest. Schwarzen Adler, am Donnerstag bei meinen Eltern, am Freitag nehme ich mein Mittagessen im KBZ Kreuzbleiche ein, weil dort um 13 Uhr mein Weiterbildungskurs beginnt.
Am Nachmittag bin ich im B & I (Beratung und Information, gehört zum RAV) anzutreffen, wo ich mein E-Mail Konto leere und Bewerbungen schreibe. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch mit den einen oder anderen Personen dort. So sehen meine Tage aus, eigentlich nicht spektakulär. Mir ist wichtig, dass ich eine Struktur habe. Ich bemühe mich auch, abends zeitig schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Ich weiss ja nie, wann ich wieder eine Stelle habe. Da ist eine Tagesstruktur schon von Vorteil. Ich glaube nicht, dass ich ein typischer Arbeitsloser bin, denn ich kann mich sehr gut beschäftigen (siehe oben!) Physik, Chemie und Astronomie interessieren mich auch. Da ich mich nun weiterbilde, hat sich dieses Thema von selbst erledigt. Es gibt einen Spruch, der lautet: Wer arbeiten will, findet auch Arbeit. Ich finde diesen Spruch total daneben, denn ich will ja arbeiten und habe auch bereits mehr als 100 Bewerbungen geschrieben. Aber was soll ich machen, wenn man mich nicht arbeiten lässt?
Mit Hilfe des B& I habe ich einen Flyer kreiert (ich suche, ich biete), den ich meinen Kollegen und den Dozenten an der Akademie in St. Gallen gemailt oder per Post geschickt habe. Diesen Flyer werde ich an ausgewählte Firmen senden und anfangs März werde ich ein Stelleninserat veröffentlichen (so ich bis dann noch keine Stelle habe).
Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch, aber es gibt Tage, da fühle ich mich so nutzlos, ich frage mich dann, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Zum Glück sind diese Phasen jeweils sehr kurz, eben: Ich bin ein Stehauf-männchen. Allerdings werde ich im Frühjahr 2010 ausgesteuert sein, sollte ich bis dann keine Stelle gefunden haben. Das macht mir langsam aber sicher Sorgen, da die Wirtschaftsprognosen noch nicht allzu rosig sind.
Trotzdem bin ich jede Woche motiviert, um neue Bewerbungen zu schreiben, es könnte ja sein, dass ich gerade dank dieser einen Bewerbung eine neue Stelle habe! Darum mein Rat an alle: Gebt niemals auf und macht das Beste aus jeder Situation!
Roger
Gerne stelle ich mich vor und erzähle von meiner Arbeitslosigkeit und wie ich sie bewältige: Ich heisse Roger, bin 47 Jahre alt und seit dem 1. November 2008 arbeitslos. Ich bin nicht das erste Mal arbeitslos, das letzte Mal vor 10 Jahren, allerdings war ich damals nur gerade 3 Monate ohne Stelle. Warum ich damals schneller einen Job gefunden habe? Ganz einfach: Ich war 10 Jahre jünger und die Wirtschaftslage war besser als heute!
In dem Alter und bei der heutigen Wirtschaftslage eine Stelle zu finden ist sehr schwierig, leider will das kein Stellenvermittlungsbüro zugeben. Sie versprechen einem das Blaue vom Himmel herunter: „Nein, nein, Sie sind überhaupt nicht zu alt.“ Oder: „Mit Ihren Qualifikationen werden Sie schnell wieder eine Stelle finden.“ Den Vogel abgeschossen hat allerdings die Filiale eines bekannten Stellenvermittlungsbüros. Ich habe mich dort um eine Temporärstelle beworben, wo Französischkenntnisse verlangt wurden. Per Mail hat mir die Dame mitgeteilt, dass ich sie anrufen solle. Als ich sie dann an einem Mittwoch angerufen habe, hat sie mir mitgeteilt, es sei schade, dass ich mich nicht früher gemeldet hätte, sie hätten sehr lange jemanden für eine andere Stelle mit guten Französisch-kenntnissen gesucht, nun sei die Stelle leider bereits vergeben. Ich habe ihr dann entgegnet, dass ich mich für die Temporärstelle beworben hätte. Sie hat mir dann gesagt: „Wenn Sie bis Freitag nichts von mir hören, kommen Sie für diese Stelle nicht in Frage.“ Während des ganzen Telefonates hat mir mein Gefühl gesagt, dass mich die Dame von A – Z angelogen hat. Natürlich habe ich bis Freitag nichts gehört. Am Montag habe ich ihr ein Mail gesandt, mit der Frage, sie möge mir doch mitteilen, warum ich die Stelle nicht erhalten hätte. Sie hat es nicht einmal für nötig gefunden mir zu antworten! Zwei Tage später habe ich ihr gemailt, sie möchte meine Unterlagen vernichten, ich verzichte auf eine Zusammenarbeit mit ihrer Filiale. Mir scheint, dass die Stellenvermittlungsbüros kein Interesse haben, mich zu vermitteln, oder wissen sie, dass ich schwer vermittelbar bin und sagen es mir nur nicht (siehe oben)?
Als ich an einem Donnerstagnachmittag einkaufen ging, habe ich einen Bekannten von mir getroffen, er war früher Personalchef. Nach einem längeren Gespräch hat er mir bestätigt, dass ich für den Arbeitsmarkt zu alt sei. Ich sei eben näher bei 50 als bei 40, hat er mir gesagt. Schöne Aussichten, nicht?
Ich bin vielseitig interessiert. Damit ich die mir nun zur Verfügung stehend Zeit sinnvoll nutzen kann, habe ich mir einen Plan gemacht, was ich an welchem Morgen tun werde. Dieser Plan sieht folgendermassen aus:
Montag: Englisch lesen und schreiben
Dienstag: Deutsch
Mittwoch: Französisch lesen und schreiben
Donnerstag: Psychologiebuch lesen (Zimbardo)
Freitag: Studium des Biologiebuches von Neil A. Campbell. Dies ist das Buch, welches Biologiestudenten für ihr Studium benötigen. Es umfasst 1600 Seiten und ist 2kg schwer! Ein äusserst interessantes Buch!
Im Oktober 2009 habe ich an der Akademie St. Gallen mit der 3jährigen Weiterbildung zum Betriebswirtschafter HF begonnen. So musste ich obigen Plan dahingehend ändern, dass die Schulfächer Vorrang haben. Der geänderte Plan sieht nun folgendermassen aus:
Montag: Betriebswirtschaftliches Modell (anhand des St. Galler Management-Modells)
Dienstag: Volkswirtschaftslehre
Mittwoch: Unternehmenslogistik
Donnerstag: Finanz- und Rechnungswesen
Freitag: Organisation
Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, halte ich mich weiterhin an den alten Plan.
Ich würde nie am Mittag für mich alleine kochen (ausser am Sonntag), da ich dies auch als reine Zeitverschwendung empfinde. Es ist nicht so, dass ich nicht kochen könnte, aber ich esse nicht gerne alleine. In einem Restaurant hat es immer viele Leute, da gibt’s immer was zu beobachten, manchmal treffe ich auch jemanden, den ich kenne. Deshalb esse ich jeden Mittag in einem anderen Restaurant: Am Montag gehe ich mit einem ehemaligen Schulkollegen essen, am Dienstag war ich bis jetzt am Mittagstisch der Pfarrei am Dom. Da es ihn nicht mehr gibt, gehe ich jetzt im ‚Gschwend’ essen, am Mittwoch im Rest. Schwarzen Adler, am Donnerstag bei meinen Eltern, am Freitag nehme ich mein Mittagessen im KBZ Kreuzbleiche ein, weil dort um 13 Uhr mein Weiterbildungskurs beginnt.
Am Nachmittag bin ich im B & I (Beratung und Information, gehört zum RAV) anzutreffen, wo ich mein E-Mail Konto leere und Bewerbungen schreibe. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch mit den einen oder anderen Personen dort. So sehen meine Tage aus, eigentlich nicht spektakulär. Mir ist wichtig, dass ich eine Struktur habe. Ich bemühe mich auch, abends zeitig schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Ich weiss ja nie, wann ich wieder eine Stelle habe. Da ist eine Tagesstruktur schon von Vorteil. Ich glaube nicht, dass ich ein typischer Arbeitsloser bin, denn ich kann mich sehr gut beschäftigen (siehe oben!) Physik, Chemie und Astronomie interessieren mich auch. Da ich mich nun weiterbilde, hat sich dieses Thema von selbst erledigt. Es gibt einen Spruch, der lautet: Wer arbeiten will, findet auch Arbeit. Ich finde diesen Spruch total daneben, denn ich will ja arbeiten und habe auch bereits mehr als 100 Bewerbungen geschrieben. Aber was soll ich machen, wenn man mich nicht arbeiten lässt?
Mit Hilfe des B& I habe ich einen Flyer kreiert (ich suche, ich biete), den ich meinen Kollegen und den Dozenten an der Akademie in St. Gallen gemailt oder per Post geschickt habe. Diesen Flyer werde ich an ausgewählte Firmen senden und anfangs März werde ich ein Stelleninserat veröffentlichen (so ich bis dann noch keine Stelle habe).
Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch, aber es gibt Tage, da fühle ich mich so nutzlos, ich frage mich dann, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Zum Glück sind diese Phasen jeweils sehr kurz, eben: Ich bin ein Stehauf-männchen. Allerdings werde ich im Frühjahr 2010 ausgesteuert sein, sollte ich bis dann keine Stelle gefunden haben. Das macht mir langsam aber sicher Sorgen, da die Wirtschaftsprognosen noch nicht allzu rosig sind.
Trotzdem bin ich jede Woche motiviert, um neue Bewerbungen zu schreiben, es könnte ja sein, dass ich gerade dank dieser einen Bewerbung eine neue Stelle habe! Darum mein Rat an alle: Gebt niemals auf und macht das Beste aus jeder Situation!
Roger
Teer
Vor vierzehn Jahren hat sie ein Gedicht geschrieben, das für sie auch heute noch Gültigkeit besitzt. Es handelt vom Widerspruch der Moderne, die sich mit Teer immer neue Verkehrswege erschliesst, gleichzeitig aber die Wege zum Selbst verbaut. Lesen Sie das berührende Gedicht über den Befreiungskampf eines Strassenkindes.
Was wäre es schön,
könnte ich den schwarzen, zähflüssigen,
inzwischen verhärteten Teer,
der meine Haut, meine Seele –
dort, wo er sitzt – nicht atmen lässt,
einfach so abkratzen.
Man sagt, es sei normal,
allemal für Strassenkinder,
Teer an der Haut kleben zu haben.
Mit Teer würden die Strassen
des Lebens gepflastert,
die uns Menschen erst die Vielzahl
der Möglichkeiten eröffne,
neue Wege zu beschreiten.
Mich lähmt der Teer,
macht mir müde Glieder,
lässt mich nicht atmen.
In meine zarte Kinderhaut
brannte er tiefe Wunden.
Die Narben kann man
heute noch sehen.
Die Zeit heilt alle Wunden,
ha, ha, dass ich nicht lache!
Damals waren meine Fingernägel
noch zu weich und nicht lang genug,
um den verhassten Teer abzukratzen.
Dann wuchsen sie und
ich bekam bröckchenweise
den einen oder anderen Teerklumpen los.
Ich schien einzutauchen in die Leichtigkeit des Seins…
Strassenkind bleibt Strassenkind,
und so kamen,
die Haut begann zu atmen,
sich zu erneuern,
neue zähflüssige Teerschlacken hinzu.
Ich besuchte für ein Jahr eine Schamanin,
die mit viel Liebe und Spiritualität
meine verhärteten Teerklumpen,
die mich nicht atmen liessen,
mir die Freude der Leichtigkeit nahmen,
aufweichte und wegschwemmte.
Der Teer floss in den Boden
und floss bis zum Erdmittelpunkt.
Heute vermag ich es in zunehmendem Masse,
dem Teer auszuweichen,
auf dass er mich nicht mehr trifft.
Auch sind meine Fingernägel inzwischen
hart genug,
ich habe sie seit dem Besuch bei der Schamanin
auch nicht mehr geschnitten,
um neue Teerklumpen jederzeit
mit Geduld und Spucke
abkratzen zu können.
Hin und wieder,
die Zeiten mehren sich,
gelingt es mir sogar
frei zu atmen
und positive Energien
wahrzunehmen.
Silvia, geschrieben im Januar 1996
Was wäre es schön,
könnte ich den schwarzen, zähflüssigen,
inzwischen verhärteten Teer,
der meine Haut, meine Seele –
dort, wo er sitzt – nicht atmen lässt,
einfach so abkratzen.
Man sagt, es sei normal,
allemal für Strassenkinder,
Teer an der Haut kleben zu haben.
Mit Teer würden die Strassen
des Lebens gepflastert,
die uns Menschen erst die Vielzahl
der Möglichkeiten eröffne,
neue Wege zu beschreiten.
Mich lähmt der Teer,
macht mir müde Glieder,
lässt mich nicht atmen.
In meine zarte Kinderhaut
brannte er tiefe Wunden.
Die Narben kann man
heute noch sehen.
Die Zeit heilt alle Wunden,
ha, ha, dass ich nicht lache!
Damals waren meine Fingernägel
noch zu weich und nicht lang genug,
um den verhassten Teer abzukratzen.
Dann wuchsen sie und
ich bekam bröckchenweise
den einen oder anderen Teerklumpen los.
Ich schien einzutauchen in die Leichtigkeit des Seins…
Strassenkind bleibt Strassenkind,
und so kamen,
die Haut begann zu atmen,
sich zu erneuern,
neue zähflüssige Teerschlacken hinzu.
Ich besuchte für ein Jahr eine Schamanin,
die mit viel Liebe und Spiritualität
meine verhärteten Teerklumpen,
die mich nicht atmen liessen,
mir die Freude der Leichtigkeit nahmen,
aufweichte und wegschwemmte.
Der Teer floss in den Boden
und floss bis zum Erdmittelpunkt.
Heute vermag ich es in zunehmendem Masse,
dem Teer auszuweichen,
auf dass er mich nicht mehr trifft.
Auch sind meine Fingernägel inzwischen
hart genug,
ich habe sie seit dem Besuch bei der Schamanin
auch nicht mehr geschnitten,
um neue Teerklumpen jederzeit
mit Geduld und Spucke
abkratzen zu können.
Hin und wieder,
die Zeiten mehren sich,
gelingt es mir sogar
frei zu atmen
und positive Energien
wahrzunehmen.
Silvia, geschrieben im Januar 1996
Gallusplatz
Es geschah an einem Mittwochnachmittag. Ich hatte gerade meine erste Klientin alleine beraten, als mich jemand, der wusste, dass ich ausgebildete Pflegefachfrau bin, wegen eines Mannes rief, der bewusstlos neben dem Brunnen auf dem Gallusplatz lag. Mein erster Gedanke:
Ich habe keine Handschuhe und: Wurde die Ambulanz informiert? Der Bewusstlose hatte schon eine gräuliche Gesichtsfarbe und schien kaum mehr zu atmen. Ich erschrak, da ich das Gefühl hatte, dass der Mann nächstens sterben würde. Glücklicherweise ertasteten meine Finger einen starken Puls am Handgelenk. Ich atmete erleichtert tief durch. Ich bewegte den Oberkörper des Mannes immer wieder, damit dieser einen zusätzlichen Impuls zum Atmen erhielt.
Etwa zwölf Minuten lang kniete ich neben dem Bewusstlosen und hatte das Gefühl, die Zeit bliebe stehen. Ich betrachtete die Umgebung: neben mir standen drei Männer, einer davon ein Hauswart. Auf den Bänken sassen einzelne Personen, die in ihren Lesestoff vertieft waren. Ein Radfahrer fuhr an uns vorbei und schaute kurz hin. Ansonsten schien sich kaum jemand für die Situation zu interessieren. Die Zeit stand für mich noch immer still. Wir warteten und warteten.
Plötzlich spürte ich den Puls am Handgelenk des Bewusstlosen nicht mehr und die Atmung hörte auf. Angst durchjagte mich. Eine Mund zu Mund-Beatmung bei diesem Blut im Mund? Gedanken um den Tod kreisten in meinem Kopf. Es schien, als ob sich der Mann verabschieden wollte. Ich wehrte mich innerlich dagegen und auf einmal bewegte sich der Brustkorb wieder und der Puls war wieder da. Erleichtert wartete ich weiter auf die Ambulanz aus Herisau, da alle anderen Wagen vom Kantonsspital unterwegs waren. Und endlich, nach 12-13 langen Minuten, erschien eine Notfallärztin mit Begleitung noch vor der Ambulanz. Ich liess den Mann am Handgelenk los und steckte meine Hände in das kalte Wasser des Brunnens. Ein Mann bot mir sein Stofftaschentuch zum Abtrocknen an und bedankte sich aufrichtig dafür, dass ich Hilfe geleistet habe. Erstaunt und erfreut nahm ich das Dankeschön an. Es tat mir gut zu wissen, dass doch noch jemand erkannt hat, was ich etwas geleistet habe.
Danach verliess ich den Platz und begab mich wieder hinauf ins Büro. Ich schaute kurz aus dem Fenster und ein eigenartiges Gefühl beschlich mich. Meinem Neffen zeigte ich kürzlich ein Kinderbüchlein mit einer belebten Strasse, auf der sich verschiedene Ereignisse wie Feuer, Unfall usw. gleichzeitig abspielen. Ähnlich das Bild jetzt, das ich vom Fenster aus sah: Auf der anderen Seite des Brunnens standen Autos, an deren Frontscheiben gewissenhafte Polizeibeamtinnen Bussen unter die Scheibenwischer klemmten. Eine Frau kam gerade dazu und diskutierte mit ihnen über die Busse. Und nur einige Meter daneben wurde der Bewusstlose medizinisch versorgt. Mir schien, dass der Kampf um das Leben des Menschen nicht relevant genug sei, um beachtet zu werden. Die Lesenden auf den Bänken jedenfalls steckten ihre Köpfe weiterhin in ihre Bücher. Ich löste mich vom Fenster und überlegte mir, ob der Mann wollte, dass er gerettet wird oder ob er lieber gestorben wäre.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Ich habe keine Handschuhe und: Wurde die Ambulanz informiert? Der Bewusstlose hatte schon eine gräuliche Gesichtsfarbe und schien kaum mehr zu atmen. Ich erschrak, da ich das Gefühl hatte, dass der Mann nächstens sterben würde. Glücklicherweise ertasteten meine Finger einen starken Puls am Handgelenk. Ich atmete erleichtert tief durch. Ich bewegte den Oberkörper des Mannes immer wieder, damit dieser einen zusätzlichen Impuls zum Atmen erhielt.
Etwa zwölf Minuten lang kniete ich neben dem Bewusstlosen und hatte das Gefühl, die Zeit bliebe stehen. Ich betrachtete die Umgebung: neben mir standen drei Männer, einer davon ein Hauswart. Auf den Bänken sassen einzelne Personen, die in ihren Lesestoff vertieft waren. Ein Radfahrer fuhr an uns vorbei und schaute kurz hin. Ansonsten schien sich kaum jemand für die Situation zu interessieren. Die Zeit stand für mich noch immer still. Wir warteten und warteten.
Plötzlich spürte ich den Puls am Handgelenk des Bewusstlosen nicht mehr und die Atmung hörte auf. Angst durchjagte mich. Eine Mund zu Mund-Beatmung bei diesem Blut im Mund? Gedanken um den Tod kreisten in meinem Kopf. Es schien, als ob sich der Mann verabschieden wollte. Ich wehrte mich innerlich dagegen und auf einmal bewegte sich der Brustkorb wieder und der Puls war wieder da. Erleichtert wartete ich weiter auf die Ambulanz aus Herisau, da alle anderen Wagen vom Kantonsspital unterwegs waren. Und endlich, nach 12-13 langen Minuten, erschien eine Notfallärztin mit Begleitung noch vor der Ambulanz. Ich liess den Mann am Handgelenk los und steckte meine Hände in das kalte Wasser des Brunnens. Ein Mann bot mir sein Stofftaschentuch zum Abtrocknen an und bedankte sich aufrichtig dafür, dass ich Hilfe geleistet habe. Erstaunt und erfreut nahm ich das Dankeschön an. Es tat mir gut zu wissen, dass doch noch jemand erkannt hat, was ich etwas geleistet habe.
Danach verliess ich den Platz und begab mich wieder hinauf ins Büro. Ich schaute kurz aus dem Fenster und ein eigenartiges Gefühl beschlich mich. Meinem Neffen zeigte ich kürzlich ein Kinderbüchlein mit einer belebten Strasse, auf der sich verschiedene Ereignisse wie Feuer, Unfall usw. gleichzeitig abspielen. Ähnlich das Bild jetzt, das ich vom Fenster aus sah: Auf der anderen Seite des Brunnens standen Autos, an deren Frontscheiben gewissenhafte Polizeibeamtinnen Bussen unter die Scheibenwischer klemmten. Eine Frau kam gerade dazu und diskutierte mit ihnen über die Busse. Und nur einige Meter daneben wurde der Bewusstlose medizinisch versorgt. Mir schien, dass der Kampf um das Leben des Menschen nicht relevant genug sei, um beachtet zu werden. Die Lesenden auf den Bänken jedenfalls steckten ihre Köpfe weiterhin in ihre Bücher. Ich löste mich vom Fenster und überlegte mir, ob der Mann wollte, dass er gerettet wird oder ob er lieber gestorben wäre.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Königin Astrid
Eine Frau, die seit Jahren in einer Altersresidenz lebt, erinnert sich an eine Pflegerin, die ihr sehr viel gegeben hat. Sie hat ihr ein bewegendes Gedicht gewidmet.
Ihre Hoheit, die Königin Astrid
sorgt nachts für meine Wenigkeit
und bringt mir trotz meines Leidens immer wieder Heiterkeit.
Sie hat Witz, Humor und ihr heiteres Wesen
trägt dazu bei, dass Patienten besser genesen.
Schwester Astrid sollte man in grosser Anzahl klonen
ich glaube, für jede Klinik würde sich das lohnen!
Heute beginnt die Fastnachtszeit
Mensch, was für Erinnerungen an meine Kindheit.
Jedes Jahr beim Umzug durch die Strassen der Stadt dabei,
Verkleidungen fantasievoll, selbstangefertigt mancherlei
Schwester Astrid würde auch gut zu einer Maskerade passen
ihre Lieblingstätigkeit ist nämlich spassen.
Im Speisesaal bringen ihre lustigen Witze uns immer wieder zum lachen
das Gelächter darüber lässt uns manchmal beinahe platzen.
Auch die vergessene Pointe am Schluss kann unsere Freude an ihr nicht verpatzen.
Wisst ihr, was ich am Liebsten täte
sofern ich das nötige Geld dazu hätte?
Ich nähme Astrid mit auf eine ferne kleine Insel im Meer
und zurückkommen würde ich nimmermehr.
Ich sehne mich dermassen nach dem geliebten Meeresstrand
mit den Füssen würden wir waten, halb im Wasser, halb im Sand
Schwester Astrid würde mich hegen und pflegen bis zu meinem verdienten Ende
und mich streicheln und halten meine kranken Hände.
Das ist es, was mir seit vielen Jahren fehlt und zu Tränen rührt
weil keine liebende Hand meine kranke Haut höchst selten berührt.
Ich weiss schon lange nicht mehr, was Liebe ist
und dieses Gefühl wird von mir ganz schrecklich vermisst.
Auch meine Seele ist krank und traurig
und ich finde es einfach schaurig.
Meine vier Geschwister, seit ich zurück bin aus Spanien, ignorieren mich
und lassen mich als älteste Schwester einfach im Stich.
Seit zehn Jahren im Heim und nie ein Besuch
kein Kontakt, weder schriftlich noch telefonisch, kein Versuch!
Ich frage mich immer wieder warum? Warum denn nur
und verfolge unser Leben und finde keine Spur.
Ich bin mir keiner Schuld bewusst und ihre Absenz ist für mich ein grosser Frust
an zerbrochenem Herzen kann man auch zugrunde gehn
doch letztlich bleibt die Hoffnung bestehn.
Ich bete viel und bitte um Kraft und Mut
und hoffe einfach, einmal kommt es wieder gut.
11. November 2008, 19h40
Ihre Hoheit, die Königin Astrid
sorgt nachts für meine Wenigkeit
und bringt mir trotz meines Leidens immer wieder Heiterkeit.
Sie hat Witz, Humor und ihr heiteres Wesen
trägt dazu bei, dass Patienten besser genesen.
Schwester Astrid sollte man in grosser Anzahl klonen
ich glaube, für jede Klinik würde sich das lohnen!
Heute beginnt die Fastnachtszeit
Mensch, was für Erinnerungen an meine Kindheit.
Jedes Jahr beim Umzug durch die Strassen der Stadt dabei,
Verkleidungen fantasievoll, selbstangefertigt mancherlei
Schwester Astrid würde auch gut zu einer Maskerade passen
ihre Lieblingstätigkeit ist nämlich spassen.
Im Speisesaal bringen ihre lustigen Witze uns immer wieder zum lachen
das Gelächter darüber lässt uns manchmal beinahe platzen.
Auch die vergessene Pointe am Schluss kann unsere Freude an ihr nicht verpatzen.
Wisst ihr, was ich am Liebsten täte
sofern ich das nötige Geld dazu hätte?
Ich nähme Astrid mit auf eine ferne kleine Insel im Meer
und zurückkommen würde ich nimmermehr.
Ich sehne mich dermassen nach dem geliebten Meeresstrand
mit den Füssen würden wir waten, halb im Wasser, halb im Sand
Schwester Astrid würde mich hegen und pflegen bis zu meinem verdienten Ende
und mich streicheln und halten meine kranken Hände.
Das ist es, was mir seit vielen Jahren fehlt und zu Tränen rührt
weil keine liebende Hand meine kranke Haut höchst selten berührt.
Ich weiss schon lange nicht mehr, was Liebe ist
und dieses Gefühl wird von mir ganz schrecklich vermisst.
Auch meine Seele ist krank und traurig
und ich finde es einfach schaurig.
Meine vier Geschwister, seit ich zurück bin aus Spanien, ignorieren mich
und lassen mich als älteste Schwester einfach im Stich.
Seit zehn Jahren im Heim und nie ein Besuch
kein Kontakt, weder schriftlich noch telefonisch, kein Versuch!
Ich frage mich immer wieder warum? Warum denn nur
und verfolge unser Leben und finde keine Spur.
Ich bin mir keiner Schuld bewusst und ihre Absenz ist für mich ein grosser Frust
an zerbrochenem Herzen kann man auch zugrunde gehn
doch letztlich bleibt die Hoffnung bestehn.
Ich bete viel und bitte um Kraft und Mut
und hoffe einfach, einmal kommt es wieder gut.
11. November 2008, 19h40
Es geschah um Mitternacht
Er habe sich 20 Jahre lang im Kreis gedreht, erzählt der 41-jährige Mann, sei im Kantonsschulpark, in der Gassenküche oder auf der Gasse rumgehängt. Aber jetzt habe er sich entschlossen, einen Entzug im Tessin zu machen. Bevor er gehe, wolle er mir diese Geschichte geben, die er gestern aufgeschrieben habe.
Ich und eine Bekannte retteten einen Mischlingshund aus einer miserablen Haltung. Ich hatte gleich mehr Lebensfreude mit dem Hund. Ich ging wieder viel mehr aus dem Haus und ich erlebte schöne Stunden. Der Hund Sahra ist auch zu neuem Leben erwacht – bis zu jenem Tag, an dem ich vom Unglück verfolgt wurde. Als ich um Mitternacht noch schnell mit dem Hund Gassi ging, verfolgte Sahra einen Fuchs. Der Fuchs hatte Glück und kam vor dem Auto über die Strasse, aber mein neues Glück wurde vom Auto erfasst, der Autofahrer, der meines Hundes Leben hätte retten können, fuhr einfach weiter. Zuerst dachte ich, er habe Glück gehabt, es sei nichts Schlimmes passiert, denn als er zu mir kam, blutete er nicht schlimm, ein bisschen aus dem Maul. Aber als ich heimwärts ging, legte er sich plötzlich auf den Teer. Ich trug Sahra nach Hause. Sie trank ein bisschen Wasser und legte sich im Badezimmer auf den Badewannenteppich. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte um diese Zeit; gleich am Morgen wollte ich zum Tierarzt gehen. Ich schaute immer wieder nach meiner Liebsten, aber es sollte nicht sein. Sahra starb um ca. sieben Uhr.
Ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen und habe sie noch zwei Tage lang behalten, bis mein Kumpel, der auch einen Hund hat, mir sagte, man müsse sie in die Verbrennung bringen. Ich war sehr froh, als er dies übernahm und sie in diesen Container legte. Ich gab die Hoffnung nicht auf und sagte mir, jetzt ist sie im Hundehimmel.
Alfons
Ich und eine Bekannte retteten einen Mischlingshund aus einer miserablen Haltung. Ich hatte gleich mehr Lebensfreude mit dem Hund. Ich ging wieder viel mehr aus dem Haus und ich erlebte schöne Stunden. Der Hund Sahra ist auch zu neuem Leben erwacht – bis zu jenem Tag, an dem ich vom Unglück verfolgt wurde. Als ich um Mitternacht noch schnell mit dem Hund Gassi ging, verfolgte Sahra einen Fuchs. Der Fuchs hatte Glück und kam vor dem Auto über die Strasse, aber mein neues Glück wurde vom Auto erfasst, der Autofahrer, der meines Hundes Leben hätte retten können, fuhr einfach weiter. Zuerst dachte ich, er habe Glück gehabt, es sei nichts Schlimmes passiert, denn als er zu mir kam, blutete er nicht schlimm, ein bisschen aus dem Maul. Aber als ich heimwärts ging, legte er sich plötzlich auf den Teer. Ich trug Sahra nach Hause. Sie trank ein bisschen Wasser und legte sich im Badezimmer auf den Badewannenteppich. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte um diese Zeit; gleich am Morgen wollte ich zum Tierarzt gehen. Ich schaute immer wieder nach meiner Liebsten, aber es sollte nicht sein. Sahra starb um ca. sieben Uhr.
Ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen und habe sie noch zwei Tage lang behalten, bis mein Kumpel, der auch einen Hund hat, mir sagte, man müsse sie in die Verbrennung bringen. Ich war sehr froh, als er dies übernahm und sie in diesen Container legte. Ich gab die Hoffnung nicht auf und sagte mir, jetzt ist sie im Hundehimmel.
Alfons
Wenn die in Lybien so saublöd tun, gehe ich halt zu Bruder Klaus
Frau M. lebt in einer Zweizimmer-Wohnung im Osten der Stadt. Sie ist sich an ein finanziell bescheidenes Leben gewohnt. Wegen ihrer psychischen Behinderung war sie jahrelang auf eine IV-Rente angewiesen und lebte damit knapp über dem Existenzminimum. Seit drei Jahren erhält sie eine AHV- und EL-Rente von monatlich Fr. 2711.--. Frau M. erzählt:
„Ich wachte gestern Morgen mit dem Wunsch auf, Bruder Klaus zu besuchen. Das ist ein wunderbarer Heiliger, den wir in der Schweiz fast vergessen haben. Ja gell, die Heiligen im eigenen Land … ! Dabei hat er uns schon so oft geholfen!
Ich habe mir gesagt, wenn die in Libyen so saublöd tun, gehe ich halt zu Bruder Klaus. Es muss doch etwas getan werden jetzt - und beten hilft immer.
Vor meiner Abreise machte ich noch „Kassensturz“ und entschied mich, diese und nächste Woche auf meine Handorgel-Stunden zu verzichten. Die Kosten für die Bahnfahrt würden sonst mein Budget „sprengen“, da ich vor drei Wochen bereits einen Ausflug nach Bern gemacht habe.
Ich bin dann mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn nach Luzern und von dort nach Sachseln gefahren. Ich liebe diese Strecke. In der Pfarrkirche in Sachseln – wo Bruder Klaus begraben liegt - betete ich den Rosenkranz. Dann ging ich ins Flüeli Ranft, um dort weiterzubeten. Ein wunderbarer Ort!
Auf dem Nachhause-Weg wurde ich total „verschifft“. Ich hatte keinen Regenschutz dabei. Das war mir alles egal, denn in mir war es schön ruhig geworden!“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
„Ich wachte gestern Morgen mit dem Wunsch auf, Bruder Klaus zu besuchen. Das ist ein wunderbarer Heiliger, den wir in der Schweiz fast vergessen haben. Ja gell, die Heiligen im eigenen Land … ! Dabei hat er uns schon so oft geholfen!
Ich habe mir gesagt, wenn die in Libyen so saublöd tun, gehe ich halt zu Bruder Klaus. Es muss doch etwas getan werden jetzt - und beten hilft immer.
Vor meiner Abreise machte ich noch „Kassensturz“ und entschied mich, diese und nächste Woche auf meine Handorgel-Stunden zu verzichten. Die Kosten für die Bahnfahrt würden sonst mein Budget „sprengen“, da ich vor drei Wochen bereits einen Ausflug nach Bern gemacht habe.
Ich bin dann mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn nach Luzern und von dort nach Sachseln gefahren. Ich liebe diese Strecke. In der Pfarrkirche in Sachseln – wo Bruder Klaus begraben liegt - betete ich den Rosenkranz. Dann ging ich ins Flüeli Ranft, um dort weiterzubeten. Ein wunderbarer Ort!
Auf dem Nachhause-Weg wurde ich total „verschifft“. Ich hatte keinen Regenschutz dabei. Das war mir alles egal, denn in mir war es schön ruhig geworden!“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Wenn es ans Herz geht
Eine junge Frau meldet sich beim Sozialdienst: Ihr Vater liege im Spital wegen einer Herzoperation. Sie wolle ihn besuchen, aber ihr fehle das Geld für das Zugbillet.
Die junge Frau steht etwas aufgeregt vor mir. Sie zwingt sich zur Ruhe. Lächelt. Beginnt zu erzählen. Umständlich zu Beginn. Immer mehr zuvorkommend und immer mehr wie eine Verkäuferin. Sie „verkauft“ mir eine Geschichte, die ihr – so ihre Aussage - zu Herzen gehe. Ihr Vater liege in einer grossen Stadt im Spital. Herzoperation! Sie selber wohne erst seit kurzem hier im Quartier bei ihrer Schwester. Die sei schon Hals über Kopf in das Spital gefahren. Den Geldbeutel habe sie gleich mitgenommen. Und jetzt stehe sie selber da ohne Geld und bräuchte … ob es jetzt gleich möglich wäre, dass … Sie nennt mir den exakten Preis für ein Zwei-Tage-Zugsbillet. Denn sie komme erst morgen wieder zurück … Sie nennt mir ihre Adresse. Nein – das Handy sei leider momentan abgeschaltet. Heute Nachmittag lade sie wieder Guthaben darauf. Sie lächelt immer noch höflich. Nennt mir als Alternative die Telefonnummern ihrer Eltern im Toggenburg.
Zum Billetpreis käme natürlich noch das Trambillet in jener Stadt dazu, meint sie weiterhin höflich lächelnd und positiv aufmunternd nickend. Ich sage ihr, dass ich das mit der Stadt abkläre. Sie fragt hastig nach, ob ich denn jetzt dort im Spital anrufe. Nein, nein. Ich würde ihr bloss im Internet nachschauen, welches Tram sie nehmen müsse. Ich bitte sie, draussen im lauschigen Garten Platz zu nehmen.
Im Internet checke ich nicht das Tram sondern diese Telefonnummer. Der Name stimmt so weit. Ich rufe an. Der Mann am anderen Ende entpuppt sich als ihr Onkel. Ich müsse seinen Bruder im gleichen Dorf anrufen. Dort nimmt dessen Frau, die Mutter ab.
Und ihr Herz läuft über. Es sei alles so schlimm. Ihre Tochter sei in den Drogen und jetzt in St.Gallen in der Bewährungshilfe. Ich soll ihr um Himmelswillen kein Geld geben. Sie gehöre in eine Klinik, damit das endlich aufhöre! Sie fleht mich förmlich an, mich dafür einzusetzen und erzählt ihre Leidensgeschichte mit der Tochter über alle Jahre: Polizei, um Geld angehen, Betrügereien, Gerichte, sich ihrer im Dorf schämen müssen und so weiter. Ihr Mann habe vor einigen Jahren eine Herzoperation gehabt. Aber er stehe jetzt neben ihr. Es gehe ihm zum Glück gut. Ich sei doch Pfarrer der katholischen Kirche, darum erzähle sie mir dies alles, damit ich – bitte nochmals – was unternehme. Und sie wohne nicht mit der Schwester zusammen. Die beiden hätten schon über Jahre hinweg keinen Kontakt mehr. Alle anderen Kinder von ihr seien gut herausgekommen. Sie sei auch Grossmutter. Goldige Enkel. Ihre Tochter habe auch ein Meiteli. Das alles gehe ihr so ans Herz!Ich gehe wieder nach draussen in den Garten. Ich weiss eigentlich nicht, was ich der jungen Frau sagen soll. Muss ich auch nicht. Der Garten ist leer. Die Frau verschwunden.
Zurück bleibt eine Herzensgeschichte und mir ein Satz der Mutter: „Wissen Sie, Eltern bleibt man ein Leben lang!“
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
Die junge Frau steht etwas aufgeregt vor mir. Sie zwingt sich zur Ruhe. Lächelt. Beginnt zu erzählen. Umständlich zu Beginn. Immer mehr zuvorkommend und immer mehr wie eine Verkäuferin. Sie „verkauft“ mir eine Geschichte, die ihr – so ihre Aussage - zu Herzen gehe. Ihr Vater liege in einer grossen Stadt im Spital. Herzoperation! Sie selber wohne erst seit kurzem hier im Quartier bei ihrer Schwester. Die sei schon Hals über Kopf in das Spital gefahren. Den Geldbeutel habe sie gleich mitgenommen. Und jetzt stehe sie selber da ohne Geld und bräuchte … ob es jetzt gleich möglich wäre, dass … Sie nennt mir den exakten Preis für ein Zwei-Tage-Zugsbillet. Denn sie komme erst morgen wieder zurück … Sie nennt mir ihre Adresse. Nein – das Handy sei leider momentan abgeschaltet. Heute Nachmittag lade sie wieder Guthaben darauf. Sie lächelt immer noch höflich. Nennt mir als Alternative die Telefonnummern ihrer Eltern im Toggenburg.
Zum Billetpreis käme natürlich noch das Trambillet in jener Stadt dazu, meint sie weiterhin höflich lächelnd und positiv aufmunternd nickend. Ich sage ihr, dass ich das mit der Stadt abkläre. Sie fragt hastig nach, ob ich denn jetzt dort im Spital anrufe. Nein, nein. Ich würde ihr bloss im Internet nachschauen, welches Tram sie nehmen müsse. Ich bitte sie, draussen im lauschigen Garten Platz zu nehmen.
Im Internet checke ich nicht das Tram sondern diese Telefonnummer. Der Name stimmt so weit. Ich rufe an. Der Mann am anderen Ende entpuppt sich als ihr Onkel. Ich müsse seinen Bruder im gleichen Dorf anrufen. Dort nimmt dessen Frau, die Mutter ab.
Und ihr Herz läuft über. Es sei alles so schlimm. Ihre Tochter sei in den Drogen und jetzt in St.Gallen in der Bewährungshilfe. Ich soll ihr um Himmelswillen kein Geld geben. Sie gehöre in eine Klinik, damit das endlich aufhöre! Sie fleht mich förmlich an, mich dafür einzusetzen und erzählt ihre Leidensgeschichte mit der Tochter über alle Jahre: Polizei, um Geld angehen, Betrügereien, Gerichte, sich ihrer im Dorf schämen müssen und so weiter. Ihr Mann habe vor einigen Jahren eine Herzoperation gehabt. Aber er stehe jetzt neben ihr. Es gehe ihm zum Glück gut. Ich sei doch Pfarrer der katholischen Kirche, darum erzähle sie mir dies alles, damit ich – bitte nochmals – was unternehme. Und sie wohne nicht mit der Schwester zusammen. Die beiden hätten schon über Jahre hinweg keinen Kontakt mehr. Alle anderen Kinder von ihr seien gut herausgekommen. Sie sei auch Grossmutter. Goldige Enkel. Ihre Tochter habe auch ein Meiteli. Das alles gehe ihr so ans Herz!Ich gehe wieder nach draussen in den Garten. Ich weiss eigentlich nicht, was ich der jungen Frau sagen soll. Muss ich auch nicht. Der Garten ist leer. Die Frau verschwunden.
Zurück bleibt eine Herzensgeschichte und mir ein Satz der Mutter: „Wissen Sie, Eltern bleibt man ein Leben lang!“
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
Grillparty mit meiner Enkelin
Frau M. arbeitet als Küchenhilfe in einem Restaurant in der Stadt. Sie verdient pro Monat Fr. 2450.--. Sie ist seit 15 Jahren geschieden und lebt seither alleine. Seit der Scheidung leidet sie unter körperlichen und psychischen Schwierigkeiten. Vor vier Wochen hatte sie eine Rückenoperation. Es sei alles gut gegangen, erzählt sie erleichtert. Sie habe im Moment fast keine Rückenschmerzen mehr. Das sei ein ganz anderes Lebensgefühl.
Frau M. erzählt - mit einem breiten Lachen im Gesicht - weiter: „Bei ‚YY‘ habe ich mir heute ein ‚Schnäppchen‘ geleistet.“ Sie zeigt stolz auf den Plastiksack, den sie neben den Stuhl gestellt hat und holt den Inhalt heraus. „Das ist ein ‚Einweg – Gartengrill‘! Stellen Sie sich mal vor, ein Gartengrill für Fr. 5.95! Jetzt kann ich endlich mit meiner lieben Enkelin auf dem Dach grillieren – in den Sommerferien. Das hat sich meine Enkelin schon so lange gewünscht. Ich werde Würstchen und Maiskolben kaufen und dann kann die Grillparty losgehen. Und das alles ist so praktisch. Ich kann den Grill danach einfach wegwerfen! Ein Grill für nur Fr. 5.95!“
Frau M. gibt mir das ganze Paket in die Hände. Wahrscheinlich schaue ich ziemlich verdutzt ‚aus der Wäsche‘. Ich habe noch nie etwas von einem ‚Wegwerf-Grill‘ gehört. Auf der Rückseite des Grills steht tatsächlich in fetter Schrift: Unbedingt beachten: Grill kann nur einmal verwendet werden!
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Frau M. erzählt - mit einem breiten Lachen im Gesicht - weiter: „Bei ‚YY‘ habe ich mir heute ein ‚Schnäppchen‘ geleistet.“ Sie zeigt stolz auf den Plastiksack, den sie neben den Stuhl gestellt hat und holt den Inhalt heraus. „Das ist ein ‚Einweg – Gartengrill‘! Stellen Sie sich mal vor, ein Gartengrill für Fr. 5.95! Jetzt kann ich endlich mit meiner lieben Enkelin auf dem Dach grillieren – in den Sommerferien. Das hat sich meine Enkelin schon so lange gewünscht. Ich werde Würstchen und Maiskolben kaufen und dann kann die Grillparty losgehen. Und das alles ist so praktisch. Ich kann den Grill danach einfach wegwerfen! Ein Grill für nur Fr. 5.95!“
Frau M. gibt mir das ganze Paket in die Hände. Wahrscheinlich schaue ich ziemlich verdutzt ‚aus der Wäsche‘. Ich habe noch nie etwas von einem ‚Wegwerf-Grill‘ gehört. Auf der Rückseite des Grills steht tatsächlich in fetter Schrift: Unbedingt beachten: Grill kann nur einmal verwendet werden!
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Zum Glück habe ich den Fernseher
Frau M., 79 Jahre alt, lebt in einem Betagtenheim in St. Gallen. Sie ist in einer Pflegefamilie in einem Dorf in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Mit 20 Jahren ist sie in die Schweiz gekommen und hat hier geheiratet. Ihr Halbbruder ist vor drei Jahren gestorben. Sie hat keine Angehörigen mehr.
Ich besuche Frau M. im Betagtenheim. Nachdem wir einige Dinge betreffend Verwaltung der Einkünfte und Ausgaben geregelt haben, beginnt Frau M. zu erzählen:
„Mein Mann und ich waren 16 Jahre verheiratet. Dann hat er sich in eine andere Frau verliebt. Das ist eine zeitlang so gegangen. Ich konnte es aber nicht haben – noch eine andere Frau neben mir. Als er nicht bereit war „die andere“ aufzugeben, habe ich mich scheiden lassen. Er hat wieder geheiratet und nach 8 Jahren ist er da draußen im Westen der Stadt über die Brücke gesprungen. Als ich das erfahren habe, hat es mir schon einen Stich ins Herz gegeben – aber so richtig wehgetan hat es nicht.
Ich habe über 40 Jahre in derselben Firma in St. Gallen gearbeitet, davon 19 Jahre als Abteilungsleiterin. In der Firma habe ich Anni kennen gelernt. Wir haben 38 Jahre lang am selben Tisch zu Mittag gegessen. Anni hat nie viel geredet. Sprechen war nicht ihr Ding. Ich habe oft zu ihr gesagt: Anni, so wirst du nie einen Mann finden. Wenn du einen Mann kennen lernst, mit ihm ausgehst und nicht sprichst, „kratzt der doch sofort die Kurve“!
Nach der Scheidung habe ich mit Anni die Ferien verbracht. Das ging sehr gut. In der Nacht hat sie nicht geschnarcht und am Tag hat sie immer das gemacht was ich wollte.
Anni kommt mich im Heim regelmäßig besuchen. Sie ist immer noch nicht sehr gesprächig. Aber treu ist sie!
Manchmal denke ich, da habe ich ein Leben lang gearbeitet, mein Geld verdient und selbständig gelebt. Und was ist mir geblieben? Nichts. Ein Fernsehapparat, ein paar Bilder, meine Kleider. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Ich darf gar nicht zu viel denken.
Zum Glück habe ich den Fernseher! Am Morgen schaue ich mir gerne Tierfilme an. Am späteren Nachmittag kommt dann zum Beispiel „Um Himmels Willen“. Das ist sehr lustig. Da streiten eine Nonne und ein Bürgermeister immer miteinander. Am liebsten sind mir aber Krimis. Beim „Tatort“ kann ich mich so richtig reinhängen. Und wenn er fertig ist, ist alles vorbei. Den „Fröhlichen Feierabend“ verpasse ich nie und beim „10 vor 10“ schlafe ich meistens schon.
Ich bin hier nicht zu Hause. Endstation. Mir „stinkt’s“! Als es in diesen Tagen draußen wieder so grau und trüb war und meine Stimmung im Keller habe ich mir gesagt: Jetzt zieh’ ich mir alles rein, was mir Freude macht. Ich trinke Wein, genieße in der Cafeteria einen Kaffee, schaue mir im Fernseher gute Filme an und freue mich auf den Frühling. Dann kann ich endlich wieder nach draußen gehen und an die Sonne sitzen.“
Frau M. fragt mich, bevor ich gehe: „Bringen Sie mir, wenn Sie das nächste Mal kommen, bitte wieder mal die Kommunion?“ Sie schaut einen flüchtigen Moment innig zum Himmel und sagt: „Das gibt mir so viel.“
Brigitta Holenstein, kath. Sozialdienst Ost
Ich besuche Frau M. im Betagtenheim. Nachdem wir einige Dinge betreffend Verwaltung der Einkünfte und Ausgaben geregelt haben, beginnt Frau M. zu erzählen:
„Mein Mann und ich waren 16 Jahre verheiratet. Dann hat er sich in eine andere Frau verliebt. Das ist eine zeitlang so gegangen. Ich konnte es aber nicht haben – noch eine andere Frau neben mir. Als er nicht bereit war „die andere“ aufzugeben, habe ich mich scheiden lassen. Er hat wieder geheiratet und nach 8 Jahren ist er da draußen im Westen der Stadt über die Brücke gesprungen. Als ich das erfahren habe, hat es mir schon einen Stich ins Herz gegeben – aber so richtig wehgetan hat es nicht.
Ich habe über 40 Jahre in derselben Firma in St. Gallen gearbeitet, davon 19 Jahre als Abteilungsleiterin. In der Firma habe ich Anni kennen gelernt. Wir haben 38 Jahre lang am selben Tisch zu Mittag gegessen. Anni hat nie viel geredet. Sprechen war nicht ihr Ding. Ich habe oft zu ihr gesagt: Anni, so wirst du nie einen Mann finden. Wenn du einen Mann kennen lernst, mit ihm ausgehst und nicht sprichst, „kratzt der doch sofort die Kurve“!
Nach der Scheidung habe ich mit Anni die Ferien verbracht. Das ging sehr gut. In der Nacht hat sie nicht geschnarcht und am Tag hat sie immer das gemacht was ich wollte.
Anni kommt mich im Heim regelmäßig besuchen. Sie ist immer noch nicht sehr gesprächig. Aber treu ist sie!
Manchmal denke ich, da habe ich ein Leben lang gearbeitet, mein Geld verdient und selbständig gelebt. Und was ist mir geblieben? Nichts. Ein Fernsehapparat, ein paar Bilder, meine Kleider. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Ich darf gar nicht zu viel denken.
Zum Glück habe ich den Fernseher! Am Morgen schaue ich mir gerne Tierfilme an. Am späteren Nachmittag kommt dann zum Beispiel „Um Himmels Willen“. Das ist sehr lustig. Da streiten eine Nonne und ein Bürgermeister immer miteinander. Am liebsten sind mir aber Krimis. Beim „Tatort“ kann ich mich so richtig reinhängen. Und wenn er fertig ist, ist alles vorbei. Den „Fröhlichen Feierabend“ verpasse ich nie und beim „10 vor 10“ schlafe ich meistens schon.
Ich bin hier nicht zu Hause. Endstation. Mir „stinkt’s“! Als es in diesen Tagen draußen wieder so grau und trüb war und meine Stimmung im Keller habe ich mir gesagt: Jetzt zieh’ ich mir alles rein, was mir Freude macht. Ich trinke Wein, genieße in der Cafeteria einen Kaffee, schaue mir im Fernseher gute Filme an und freue mich auf den Frühling. Dann kann ich endlich wieder nach draußen gehen und an die Sonne sitzen.“
Frau M. fragt mich, bevor ich gehe: „Bringen Sie mir, wenn Sie das nächste Mal kommen, bitte wieder mal die Kommunion?“ Sie schaut einen flüchtigen Moment innig zum Himmel und sagt: „Das gibt mir so viel.“
Brigitta Holenstein, kath. Sozialdienst Ost
Die urbane Tarnkappe
Ich hätte keine Ahnung, was es für jemanden wie ihn bedeute, durch die Stadt zu gehen, ständig mit der Angst, in eine Kontrolle zu geraten. Nein, sagte ich, aber wenn er sich Mühe gäbe, mir das zu erklären, könne ich ihn vielleicht besser verstehen. In die nächste Beratungsstunde brachte er folgenden Text mit:
Haben Sie sich schon mal um ihr Profil Sorgen gemacht? Oder gehören Sie etwa zu den Glücklichen, Auserwählten, die nicht ins Profil passen? Profil? Falls Sie sich jetzt fragen, um was für ein Profil es sich handelt, hier die Kurzbeschreibung (für alle anderen, bitte nach dem Absatz weiterlesen): Das Profil ist Eigentum der Polizei und allmächtig. Das Profil entscheidet über Ihre Ruhe und Ihren Frieden. Hat die Polizei einmal Ihr Profil erfasst, gibt es kein Entkommen. Das Profil entscheidet, ob man sich in der Stadt frei bewegen kann oder sich ständig paranoid umdrehen muss.Sie müssen sich das in etwa so vorstellen: In St. Gallen existiert ein „potenzieller Brecher des Gesetzes Profil“, das den Weizen vom Spreu trennt, also den gelassenen Normalbürger vom nervöswerdenden Gelegenheitskiffer. Früher bin ich dem Profil öfter ins Netz gegangen, heute benutze ich das Profil für mich. Wie?, fragen Sie mich. Mit meiner genialen Erfindung: der urbanen Tarnkappe! Ein Beispiel. Ich gehe gerade durch eine grosse Menschenmenge durch die Stadt und erspähe prompt zwei Helfer in blau. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Blitzschnell entscheidet sich, ob ich in Ruhe meines Weges gehen kann oder ob ich mich einer peinlichen und zeitraubenden Prozedur unterziehen muss: Identitätskontrolle. Sobald die obengenannten Helfer eine Menschenmenge inspizieren, wenden sie das „potenzieller Brecher des Gesetzes Profil“ an: Normale Kleidung, passende Grösse, keine Aufdrücke oder Beschriftungen, CH-Bürger zwischen 35-99 Jahre alt = gutAusgeflippte Klamotten, Übergrösse, vielfarbige Aufdrücke und Beschriftungen, Ausländer, Inländer-Bürger zwischen 0-34 Jahre, rote Augen, kleine Augen, grosse Augen, taumelnder Gang, nervöses Zucken, stehen bleiben, umdrehen, wegrennen, penetrantes Wegschauen, „unauffällig“ pfeifen = schlecht Haben sie dich in ihrem Radius erfasst und lautet die Analyse „schlecht“, wird man routinemässig aufgehalten, schikaniert, kontrolliert und aufgezogen. Da ich eher in die Kategorie „schlecht“ gehöre, wird es Zeit für die urbane Tarnkappe. Sie setzt mein Profil ausser Kraft, indem sie mir hilft, die Polizei zu verwirren. Spass beiseite, ich gehe einfach geradewegs auf die Polizei zu und schon werde ich nicht mehr kontrolliert. Das kann jeder, auch ohne Tarnkappe.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Haben Sie sich schon mal um ihr Profil Sorgen gemacht? Oder gehören Sie etwa zu den Glücklichen, Auserwählten, die nicht ins Profil passen? Profil? Falls Sie sich jetzt fragen, um was für ein Profil es sich handelt, hier die Kurzbeschreibung (für alle anderen, bitte nach dem Absatz weiterlesen): Das Profil ist Eigentum der Polizei und allmächtig. Das Profil entscheidet über Ihre Ruhe und Ihren Frieden. Hat die Polizei einmal Ihr Profil erfasst, gibt es kein Entkommen. Das Profil entscheidet, ob man sich in der Stadt frei bewegen kann oder sich ständig paranoid umdrehen muss.Sie müssen sich das in etwa so vorstellen: In St. Gallen existiert ein „potenzieller Brecher des Gesetzes Profil“, das den Weizen vom Spreu trennt, also den gelassenen Normalbürger vom nervöswerdenden Gelegenheitskiffer. Früher bin ich dem Profil öfter ins Netz gegangen, heute benutze ich das Profil für mich. Wie?, fragen Sie mich. Mit meiner genialen Erfindung: der urbanen Tarnkappe! Ein Beispiel. Ich gehe gerade durch eine grosse Menschenmenge durch die Stadt und erspähe prompt zwei Helfer in blau. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Blitzschnell entscheidet sich, ob ich in Ruhe meines Weges gehen kann oder ob ich mich einer peinlichen und zeitraubenden Prozedur unterziehen muss: Identitätskontrolle. Sobald die obengenannten Helfer eine Menschenmenge inspizieren, wenden sie das „potenzieller Brecher des Gesetzes Profil“ an: Normale Kleidung, passende Grösse, keine Aufdrücke oder Beschriftungen, CH-Bürger zwischen 35-99 Jahre alt = gutAusgeflippte Klamotten, Übergrösse, vielfarbige Aufdrücke und Beschriftungen, Ausländer, Inländer-Bürger zwischen 0-34 Jahre, rote Augen, kleine Augen, grosse Augen, taumelnder Gang, nervöses Zucken, stehen bleiben, umdrehen, wegrennen, penetrantes Wegschauen, „unauffällig“ pfeifen = schlecht Haben sie dich in ihrem Radius erfasst und lautet die Analyse „schlecht“, wird man routinemässig aufgehalten, schikaniert, kontrolliert und aufgezogen. Da ich eher in die Kategorie „schlecht“ gehöre, wird es Zeit für die urbane Tarnkappe. Sie setzt mein Profil ausser Kraft, indem sie mir hilft, die Polizei zu verwirren. Spass beiseite, ich gehe einfach geradewegs auf die Polizei zu und schon werde ich nicht mehr kontrolliert. Das kann jeder, auch ohne Tarnkappe.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Überleben in St.Gallen
«Wissen Sie, ich könnte einen Survival-Guide schreiben. Ich weiss genau, wie man in St. Gallen überlebt», sagte der junge Mann. Weshalb er ihn denn nie geschrieben habe, wollte ich von ihm wissen. Er habe nicht gewusst, dass sich jemand dafür interessieren könnte. An das nächste Beratungsgespräch brachte er einen Text mit, auf den er selbst stolz war. Gerne veröffentliche ich ihn an dieser Stelle. Natürlich wollte er anonym bleiben.
Sparsam leben ist eine Kunst, gratis leben (fast) unmöglich. Falls Sie doch mal, wider erwarten, am Nullpunkt angelangt sind, Ihr einziger Besitz eine Matratze ist und ihr einziger Freund das Dach über dem Kopf, sollten Sie sich vielleicht ein bis zwei Tipps aus diesem Survival-Guide merken.
1. Um 4.30 Uhr ist der beste Zeitpunkt, um aufzustehen, wenn man City-Surviving betreibt. Warum? Weil dann Lebensmittel ausgeliefert werden., z.B. Gipfeli und Weggli an Restaurants, Joghurt etc. an den Supermarkt (auch kleinere Quartiersupermärkte). Das Ganze ist natürlich eine Gewissensfrage, aber immer noch besser als betteln oder „mischeln“. Gehören Sie eher zu den Leuten, die schlafen bis 11 Uhr, müssen Sie wohl oder übel entweder Mundraub in der Migros begehen (mmh... Trauben!) oder am Abend im Stadttheater beim Aussenlager vorbeischauen. Ich weiss zwar nicht, ob das Loch im Gitter mittlerweile geflickt ist, aber schauen kostet nichts. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen meine spezielle „Theatererfahrung“. Wie gesagt ging ich manchmal ins Stadttheater. Eines Abends, als ich wieder einmal Essen holen ging, nahm ich im Dunkeln 3 – 4 Schachteln an mich, ohne zu wissen, was ich eigentlich erwischt hatte. Um es kurz zu fassen: 1 ½ Kilogramm Raclette-Käse, eine Schachtel Tartarwürste von Bell und Silserbrötli. Jeder Koch würde mich auf eine Insel verbannen, wenn er wüsste, was ich damit gekocht habe: nämlich „Gehacktes mit Hörnli“ überbacken mit Raclett-Käse. Tartarfleisch ist nicht umsonst so hochgelobt, ich würde es trotzdem nie roh essen. Haben Sie schon einmal kein Geld gehabt und so exklusiv gegessen? Gehen Sie doch öfter ins Theater. 2. Wer isst, muss irgendwann auf die Toilette, doch auch WC-Papier ist nicht gratis. Diese 2 Franken spar ich mir lieber für was anderes, gibt es doch am Bahnhof Reinigungswägelchen randvoll mit WC-Papier und Abfallsäcken. Knapp zusammengefasst: Mit diesen Tipps und dem Sozialgeld sollte man einigermassen über die Runden kommen. Doch manchmal, wenn gar nichts klappt, findet man sich maskiert wieder, in einer fremden Wohnung, bei einem fremden Dealer, sich an fremdem Geld vergreifend. Dann ist der Punkt erreicht, wo ich aufhöre, so zu leben, und mir eine Arbeit suche, sodass ich nie mehr auf diese Tipps angewiesen bin. Was ist? Überrascht? Haben Sie gedacht, dass ich mein eigenes Treiben gutheisse? Dass wir uns nicht falsch verstehen: Ich habe getan, was ich tun musste, um zu überleben, doch weiss ich, dass es falsch ist. Leider hat Moral neben Hunger keinen Platz. Aber nichtsdestotrotz lass ich es mir nicht nehmen, Ihnen noch einen Trick mitzugeben, den jeder gebrauchen kann. Wenn Sie das nächste mal im Parkhaus sind, fahren Sie doch einfach mit Ihrem Vordermann mit hinaus, anstatt das Ticket zu bezahlen. Gute Laune garantiert.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Sparsam leben ist eine Kunst, gratis leben (fast) unmöglich. Falls Sie doch mal, wider erwarten, am Nullpunkt angelangt sind, Ihr einziger Besitz eine Matratze ist und ihr einziger Freund das Dach über dem Kopf, sollten Sie sich vielleicht ein bis zwei Tipps aus diesem Survival-Guide merken.
1. Um 4.30 Uhr ist der beste Zeitpunkt, um aufzustehen, wenn man City-Surviving betreibt. Warum? Weil dann Lebensmittel ausgeliefert werden., z.B. Gipfeli und Weggli an Restaurants, Joghurt etc. an den Supermarkt (auch kleinere Quartiersupermärkte). Das Ganze ist natürlich eine Gewissensfrage, aber immer noch besser als betteln oder „mischeln“. Gehören Sie eher zu den Leuten, die schlafen bis 11 Uhr, müssen Sie wohl oder übel entweder Mundraub in der Migros begehen (mmh... Trauben!) oder am Abend im Stadttheater beim Aussenlager vorbeischauen. Ich weiss zwar nicht, ob das Loch im Gitter mittlerweile geflickt ist, aber schauen kostet nichts. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen meine spezielle „Theatererfahrung“. Wie gesagt ging ich manchmal ins Stadttheater. Eines Abends, als ich wieder einmal Essen holen ging, nahm ich im Dunkeln 3 – 4 Schachteln an mich, ohne zu wissen, was ich eigentlich erwischt hatte. Um es kurz zu fassen: 1 ½ Kilogramm Raclette-Käse, eine Schachtel Tartarwürste von Bell und Silserbrötli. Jeder Koch würde mich auf eine Insel verbannen, wenn er wüsste, was ich damit gekocht habe: nämlich „Gehacktes mit Hörnli“ überbacken mit Raclett-Käse. Tartarfleisch ist nicht umsonst so hochgelobt, ich würde es trotzdem nie roh essen. Haben Sie schon einmal kein Geld gehabt und so exklusiv gegessen? Gehen Sie doch öfter ins Theater. 2. Wer isst, muss irgendwann auf die Toilette, doch auch WC-Papier ist nicht gratis. Diese 2 Franken spar ich mir lieber für was anderes, gibt es doch am Bahnhof Reinigungswägelchen randvoll mit WC-Papier und Abfallsäcken. Knapp zusammengefasst: Mit diesen Tipps und dem Sozialgeld sollte man einigermassen über die Runden kommen. Doch manchmal, wenn gar nichts klappt, findet man sich maskiert wieder, in einer fremden Wohnung, bei einem fremden Dealer, sich an fremdem Geld vergreifend. Dann ist der Punkt erreicht, wo ich aufhöre, so zu leben, und mir eine Arbeit suche, sodass ich nie mehr auf diese Tipps angewiesen bin. Was ist? Überrascht? Haben Sie gedacht, dass ich mein eigenes Treiben gutheisse? Dass wir uns nicht falsch verstehen: Ich habe getan, was ich tun musste, um zu überleben, doch weiss ich, dass es falsch ist. Leider hat Moral neben Hunger keinen Platz. Aber nichtsdestotrotz lass ich es mir nicht nehmen, Ihnen noch einen Trick mitzugeben, den jeder gebrauchen kann. Wenn Sie das nächste mal im Parkhaus sind, fahren Sie doch einfach mit Ihrem Vordermann mit hinaus, anstatt das Ticket zu bezahlen. Gute Laune garantiert.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Einblick in das Leben von Elvis Bollhalder
Mit sechzehn lebte er in einem Zelt am Waldrand, mit siebzehn wurde er Vater. Wie lebt er heute? Welche Chancen birgt sein Leben?
Wie ist die Geschichte entstanden? - Das erste Beratungsgespräch fand kurz nach der Trennung von seiner Freundin statt. Er fühlte sich als völliger Versager. Er erzählte mir aus seinem Leben wie um zu belegen, dass er stets nur versagt hatte. Ich staunte über die Fülle seiner Erfahrungen und fragte mich, wie ich als Sechzehnjähriger in einem Zelt am Waldrand gelebt und überlebt hätte. Meine Anregung, seine Geschichte aufzuschreiben, nahm er begeistert auf. Ich blieb skeptisch: Würde er sich wirklich dahinterklemmen?
An das nächste Gespräch kam er mit einem Notizblöcklein. Er diktierte, ich tippte ab. „Das ist die erste Geschichte, die ich schreibe“, sagte er voller Stolz.
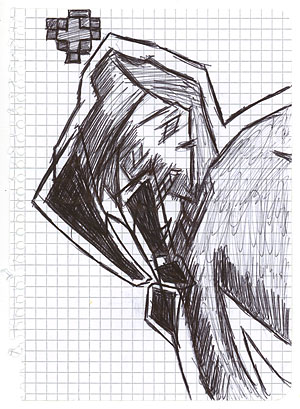
Meine Mutter hat mich von zuhause rausgeworfen als ich sechzehn war, gerade als ich mit der Lehre begann. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also holte ich das Zelt aus dem Keller und ging in den Wald, baute dort mein Lager auf. Den Sommer über war es noch sehr einfach und schön warm, doch den Winter über musste ich Schlafsäcke aus anderen Kellern klauen und Jacken, damit ich nicht frieren musste. Esswaren musste ich auch irgendwie besorgen, also bat ich meine Kollegin darum und sie brachte mir Nüsse und Chips und was sie sonst noch auftreiben konnte. Ich habe mich voll asozial gefühlt. Obwohl ich in der Lehre war, hätte ich mich am liebsten in einem Loch verkrochen, so sehr schämte ich mich. Da ich keine Unterstützung von der Familie hatte, blieb mir aber nichts anderes übrig. Es machte mich eine Weile richtig kaputt, so zu leben, aber ich blieb optimistisch und führte meine Lehre weiter. Ich liess mich von nichts abbringen, war jedoch leicht reizbar wegen meiner Lebenssituation. Dann kam eine Überrraschung: mein kleiner Sohn kam auf die Welt, als ich siebzehn war. Er war ein richtiger Segen für mich, aber leider kamen mit dem Segen auch viele Probleme und Ausgaben. Darum gab ich die Lehre auf und ging jobben als Bauisolierer-Hilfsarbieter, um meiner Freundin und meinem Kleinen etwas bieten zu können. Als das Kind nach einem Jahr die Brust nicht mehr brauchte, nahmen sie es uns weg, weil meine Freundin zu jung war. Und das geschah, als ich achtzehn war. Es ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mich am liebsten getötet, so scheisse ging es mir damals. Ich gab den Job auf, verliess meine Freundin und fing an zu dealen mit Gras, bis die Polizei dahinterkam und mich erwischte. Es kamen noch mehr Probleme auf mich zu. Ich hatte Gerichtsverhandlungen, bekam Bewährung auf zwei Jahre und während dieser Zeit entschloss man sich dafür, dass ich kein Sorgerecht mehr habe. Als ich das erfuhr, war es beinahe mein Untergang. Ich entschloss mich, ein Jahr lang nichts zu tun und mich neu zu orientieren. Dann kam der Moment, als ich dachte, es muss weitergehen. Das hiess für mich, dass ich zuerst einmal von den Drogen weg musste. Also habe ich ein halbes Jahr lang einen Entzug gemacht und in diesem Entzug habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Sie half mir, wo sie nur konnte. Das baute mich auf und brachte mich dazu, dass ich es schaffte, dieses halbe Jahr durchzustehen. Dann hiess es, meine Freundin gehe an die Kunstschule in St. Gallen. Ich dachte mir, ich begleite sie und fange neu an. Ich ging mit ihr nach St. Gallen und wie man sagt, aller Anfang ist schwer. Der Anfang war wirklich schwer. Ich hatte nämlich keine Wohnung und keine Sozialhilfe, also musste ich bei der Freundin leben und das war nicht gut für unsere Beziehung, weil ich nichts tat den ganzen Tag. Meine Freundin machte Schluss mit mir, weil sie mich nicht mehr richtig liebte. Nachdem das geschehen war, ging ich zu meinem Kollegen, den ich in St. Gallen kenntengelernt hatte. Der bot mir an, mich unter seiner Adresse beim Sozialamt anzumelden. Das war eine gute Chance, von da an bekam ich wenigstens Sozialgelder, um zu überleben. Mein Kollege hatte nur ein Zimmer, doch ich wollte meinen Freiraum. Deshalb ging ich ins Obdachlosenheim. Es zieht mich zwar runter, wenn ich sehe, wie die Leute dort leben, aber dann dachte ich an meinen Sohn, also raffte ich mich auf und suchte eine Wohnungen und einen Job. Und da schau her, ich habe Glück, habe eine Wohnung gefunden und der Job ist auch sehr nah.
Ich will euch damit empfehlen, egal wie tief man ist und egal wie hoffnungslos es scheint, immer und immer wieder probieren, irgendwann schafft man sein Ziel.
Elvis Bollhalder
Wie ist die Geschichte entstanden? - Das erste Beratungsgespräch fand kurz nach der Trennung von seiner Freundin statt. Er fühlte sich als völliger Versager. Er erzählte mir aus seinem Leben wie um zu belegen, dass er stets nur versagt hatte. Ich staunte über die Fülle seiner Erfahrungen und fragte mich, wie ich als Sechzehnjähriger in einem Zelt am Waldrand gelebt und überlebt hätte. Meine Anregung, seine Geschichte aufzuschreiben, nahm er begeistert auf. Ich blieb skeptisch: Würde er sich wirklich dahinterklemmen?
An das nächste Gespräch kam er mit einem Notizblöcklein. Er diktierte, ich tippte ab. „Das ist die erste Geschichte, die ich schreibe“, sagte er voller Stolz.
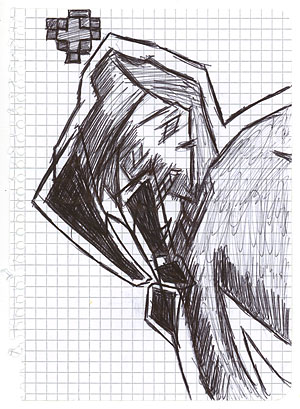
Meine Mutter hat mich von zuhause rausgeworfen als ich sechzehn war, gerade als ich mit der Lehre begann. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also holte ich das Zelt aus dem Keller und ging in den Wald, baute dort mein Lager auf. Den Sommer über war es noch sehr einfach und schön warm, doch den Winter über musste ich Schlafsäcke aus anderen Kellern klauen und Jacken, damit ich nicht frieren musste. Esswaren musste ich auch irgendwie besorgen, also bat ich meine Kollegin darum und sie brachte mir Nüsse und Chips und was sie sonst noch auftreiben konnte. Ich habe mich voll asozial gefühlt. Obwohl ich in der Lehre war, hätte ich mich am liebsten in einem Loch verkrochen, so sehr schämte ich mich. Da ich keine Unterstützung von der Familie hatte, blieb mir aber nichts anderes übrig. Es machte mich eine Weile richtig kaputt, so zu leben, aber ich blieb optimistisch und führte meine Lehre weiter. Ich liess mich von nichts abbringen, war jedoch leicht reizbar wegen meiner Lebenssituation. Dann kam eine Überrraschung: mein kleiner Sohn kam auf die Welt, als ich siebzehn war. Er war ein richtiger Segen für mich, aber leider kamen mit dem Segen auch viele Probleme und Ausgaben. Darum gab ich die Lehre auf und ging jobben als Bauisolierer-Hilfsarbieter, um meiner Freundin und meinem Kleinen etwas bieten zu können. Als das Kind nach einem Jahr die Brust nicht mehr brauchte, nahmen sie es uns weg, weil meine Freundin zu jung war. Und das geschah, als ich achtzehn war. Es ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mich am liebsten getötet, so scheisse ging es mir damals. Ich gab den Job auf, verliess meine Freundin und fing an zu dealen mit Gras, bis die Polizei dahinterkam und mich erwischte. Es kamen noch mehr Probleme auf mich zu. Ich hatte Gerichtsverhandlungen, bekam Bewährung auf zwei Jahre und während dieser Zeit entschloss man sich dafür, dass ich kein Sorgerecht mehr habe. Als ich das erfuhr, war es beinahe mein Untergang. Ich entschloss mich, ein Jahr lang nichts zu tun und mich neu zu orientieren. Dann kam der Moment, als ich dachte, es muss weitergehen. Das hiess für mich, dass ich zuerst einmal von den Drogen weg musste. Also habe ich ein halbes Jahr lang einen Entzug gemacht und in diesem Entzug habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Sie half mir, wo sie nur konnte. Das baute mich auf und brachte mich dazu, dass ich es schaffte, dieses halbe Jahr durchzustehen. Dann hiess es, meine Freundin gehe an die Kunstschule in St. Gallen. Ich dachte mir, ich begleite sie und fange neu an. Ich ging mit ihr nach St. Gallen und wie man sagt, aller Anfang ist schwer. Der Anfang war wirklich schwer. Ich hatte nämlich keine Wohnung und keine Sozialhilfe, also musste ich bei der Freundin leben und das war nicht gut für unsere Beziehung, weil ich nichts tat den ganzen Tag. Meine Freundin machte Schluss mit mir, weil sie mich nicht mehr richtig liebte. Nachdem das geschehen war, ging ich zu meinem Kollegen, den ich in St. Gallen kenntengelernt hatte. Der bot mir an, mich unter seiner Adresse beim Sozialamt anzumelden. Das war eine gute Chance, von da an bekam ich wenigstens Sozialgelder, um zu überleben. Mein Kollege hatte nur ein Zimmer, doch ich wollte meinen Freiraum. Deshalb ging ich ins Obdachlosenheim. Es zieht mich zwar runter, wenn ich sehe, wie die Leute dort leben, aber dann dachte ich an meinen Sohn, also raffte ich mich auf und suchte eine Wohnungen und einen Job. Und da schau her, ich habe Glück, habe eine Wohnung gefunden und der Job ist auch sehr nah.
Ich will euch damit empfehlen, egal wie tief man ist und egal wie hoffnungslos es scheint, immer und immer wieder probieren, irgendwann schafft man sein Ziel.
Elvis Bollhalder