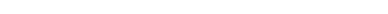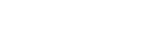Hilf mir, es allein zu tun
Herr und Frau T. sind mit ihren 11-, 12- und 14-jährigen Kindern vor neun Jahren von Eritrea in die Schweiz geflüchtet. Die Familie lebt in St. Gallen und wird vom Sozialamt unterstützt.
Herr und Frau T. haben in den vergangenen Jahren sehr gut Deutsch gelernt. Sie sind intensiv auf Stellensuche – bis heute leider erfolglos. Sie sagen, die Abhängigkeit vom Sozialamt sei für sie eine grosse Belastung.
Herr und Frau T. haben vor drei Jahren ein Geschäft im Osten der Stadt eröffnet. Sie verkaufen Lebensmittel, Gewürze und Kleider aus Eritrea. Das Geschäft läuft „schlecht und recht“. Das Einkommen schwankt zwischen 500.—und 1‘000.—pro Monat. Das bedeutet immerhin etwas mehr Unabhängigkeit vom Sozialamt.
Frau T. hat in Eritrea als Coiffeuse gearbeitet. Sie meldet sich beim kath. Sozialdienst Ost, weil sie sich vor drei Monaten entschieden hat, an der Coiffeurfachschule St. Gallen einen Wiedereinsteiger- und Weiterbildungskurs zu besuchen. Sie möchte als Coiffeuse arbeiten und erhofft sich damit die vollständige Unabhängigkeit vom Sozialamt.
Die Ausbildung dauert ein Jahr und kostet Fr. 3‘600.--. Die ersten drei Monatsraten von insgesamt 900.-- hat Frau T. bereits bezahlt. Nun stösst die Familie finanziell doch an Grenzen. Herr und Frau T. müssen sich eingestehen, dass sie auf die Dauer den monatlichen Betrag von Fr. 300.-- an die Ausbildung nicht mehr leisten können. Die Familie lebt am Existenzminimum.
Frau T. fragt beim Kath. Sozialdienst Ost nach einer allfälligen Finanzierung der Ausbildung.
Frau T. ist eine initiative, wache, freundliche Frau, die „auf eigenen Beinen stehen möchte“. Sie spricht sehr gut Deutsch.
Ich stelle bei einer Stiftung ein finanzielles Gesuch für den Restbetrag von Fr. 2‘700.—für die Ausbildung an der Coiffeurfachschule. Schon bald kommt der positive Bescheid. Die Ausbildung wird von der Stiftung finanziert. Frau T. ist überglücklich und bedankt sich tausendmal…
Ich bin zuversichtlich, dass sie mit ihren gewinnenden Ressourcen gute Chancen hat, eine Arbeit in einem Coiffeursalon zu finden.
Brigitta Hollenstein, Sozialarbeiterin FHS
Freiheit
C.
Die andere Seite
Unser Land, die Schweiz: Wunderschön mit ihren Bergen, Seen und Wäldern, kleinen Dörfern sowie riesigen, pulsierenden Städten. Circa 8,081 Millionen Menschen haben in der Schweiz ihre Heimat gefunden, leben und arbeiten in diesem Land. Dabei sind die Möglichkeiten so vielseitig wie das Land selbst. Vom Kaufmann über den Firmenchef in einer grösseren Stadt bis hin zum Bergbauern in einem kleinen Dorf in den Alpen. Man könnte denken, eigentlich sei in diesem Land alles perfekt. Jedoch ist nicht alles wie es scheint. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern dieser Welt eher klein, aber die Schlucht zwischen den zwei Seiten der Gesellschaft ist riesig. Jeder achte Mensch in der Schweiz ist Millionär, d.h. circa 330‘000 Menschen in der Schweiz. Sie leben wo und wie sie wollen. Sei es in einem schönen Haus am Seeufer von Zürich oder in einer grossen Villa in Zug. An den schönsten Orten der Schweiz, denn sie können es sich ja selbst aussuchen. Ohne Angst und Sorgen, was die Zukunft wohl bringt, denn ihre Zukunft ist sicher. Entweder diese Menschen hatten einfach Glück und sind so zu ihrem Vermögen gekommen oder aber sie haben es sich ihr Leben lang hart erarbeitet. Allein die Möglichkeit, sich ein Vermögen zu erarbeiten oder die Chance, sich ein Vermögen erarbeiten zu können, bedeutet für die andere Seite schon Luxus, denn die andere Seite, das sind ca 250‘000 Menschen in der Schweiz, die von Sozialhilfe leben. Jeder Dritte unter ihnen ist noch nicht einmal 18 Jahre alt.
Wie kommt es dazu? Wahrscheinlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Oft ist es so, dass die Jugendlichen im Alter von 14-16 eher weniger Lust auf Schule haben als sie es haben sollten. In diesem Alter ist es den meisten auch egal, wenn andere zu Ihnen sagen: Denk an später, das wirst du bereuen oder So bringst du es zu nichts…
Später dann, wissen sie, was damals gemeint war. Andere Gründe sind bestimmt auch die schlechte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Hat man hier in der Schweiz nicht die besten Schulen abgeschlossen, bleiben einem viele Türen verschlossen, und das hat nichts damit zu tun, dass man dumm ist. Es hat nun mal einfach nicht jeder die Papiere, die beweisen, dass man nicht dumm ist. Das wiederum liegt am fehlenden Geld für gesagte Erwachsenenbildungen und somit beisst sich die Katze immer wieder in den Schwanz. Wer länger als 5 Jahre keine Anstellung findet, gilt auf dem Sozialamt oft als „Langzeitarbeitsloser“ und somit als hoffnungsloser Fall.
Aber eigentlich handelt es sich nicht um hoffnungslose Fälle, sondern um Menschen. Menschen mit einer Geschichte, die so individuell ist, wie sie selbst sind. Ja, Sozialhilfeempfänger sind auch Menschen. Viele vergessen das. Besonders diese Menschen, die das Privileg geniessen, auf der anderen Seite leben zu dürfen. Ich sage bewusst „dürfen“, denn jeder Mensch sollte bedenken, dass alles endlich ist. Alles. Niemand hat eine Garantie dafür, dass sein Leben immer so bleibt, wie es ist, und dabei spielt Geld keine Rolle. Nichts bleibt für immer so, wie es in diesem Moment ist. Nichts Gutes aber auch nichts Schlechtes. Alles ist endlich. Das Gute kann sich so schnell in etwas ganz Schlechtes verwandeln und etwas Schlechtes kann genauso schnell zu etwas Wunderbarem werden. Nichts ist für immer, so wie es ist. Darauf gibt es eine Garantie. Es gibt auch etwas, was man mit Geld nur teilweise erwerben kann, jedoch niemals ganz. Das ist die Gesundheit. Die Gesundheit ist ein Geschenk. Wenn du gesund bist, dann sei dankbar für deine Gesundheit.Wenn Du jetzt denkst; „Ach, ich muss mir da keine Sorgen machen, ich habe ein so grosses Vermögen, ich kann jede Therapie und jede Behandlung bezahlen, um wieder zu gesunden, falls ich krank werde...“ oder aber falls du auf der anderen Seite der Gesellschaft stehst und denkst: „Ach, die reichen Menschen, die können sich ja alles leisten, denen kann gar nichts passieren, die haben doch das Geld, um jegliche Behandlung usw. zu bezahlen...“
Kannst Du sehen wie unterschiedlich und doch so gleich diese beiden Aussagen sind? Es sind zwei verschiedene Aussagen von zwei verschiedenen Menschen aus derselben Gesellschaft, die jedoch auf der jeweils anderen Seite als der andere stehen. Für beide habe ich jedoch dieselbe Antwort: „Nein. Es gibt einen Punkt, an dem auch Geld nichts mehr hilft und nichts bewirken kann.“ Vergiss das nicht! Und sei dankbar für deine Gesundheit. Du hast sie nur einmal! So, nun zurück zu den Menschen, die auf der anderen Seite stehen dürfen, auf der „Sonnenseite“, nennen wir sie so. Seien wir doch mal ganz ehrlich, für diese Menschen sind doch Sozialhilfeempfänger einfach nur eine „Last der Gesellschaft“. Eigentlich wird über Sozialhilfeempfänger doch gesagt: Sie sind doch nur zu faul, arbeiten zu gehen, geben sich ja eh keine Mühe, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen, sind assozial und wollen ausserdem gar nicht arbeiten. Die schlafen lieber bis ca. 15.00 Uhr nachmittags und freuen sich über das Geld, welches sie jeden Monat einfach für's Nichts tun bekommen. Und das dann auch noch von unseren Steuergeldern! Unfassbar! ...
Eine Frage, an die, die auf der Seite leben dürfen, auf der so über Sozialhilfeempfänger gesprochen wird: Ist es denn wirklich so schlimm, wenn man weiss, dass man mit seinem Geld, also den Steuergeldern, diesen Leuten in unserer Gesellschaft, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf der Sonnenseite leben können, aber im selben Land leben, zur selben Gesellschaft gehören wie Ihr, hilft? Es muss ein grausam schlimmes Gefühl sein zu helfen, wenn man einmal über die Worte nachdenkt, die über diese Sozialhilfeempfänger gesagt werden...
Ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen... Es ist eine wahre Geschichte und sie passiert hier, hier in der Schweiz. Da, wo du lebst. In dieser Geschichte geht es um eine junge Frau. Die hatte nach Ihrer Schulzeit das unfassbare Glück, im Anschluss eine Lehrstelle gefunden zu haben. Sie hat einen Ausbildungsplatz gefunden, wo doch so viele junge Leute einer der begehrten Ausbildungsplätze haben wollen. Sie ist immer pünktlich und hat Ihre Aufgaben, die sie vom Lehrmeister bekommen hat, immer sauber erledigt. Schnell hat sie jedoch gemerkt, dass dieser Beruf eine Veränderrung mit sich brachte. Eine Veränderung an ihrem Körper. Sie hat es jedoch ignoriert, denn sie wollte diesen Ausbildungsplatz nicht verlieren oder aufgeben, sie wollte doch diese Ausbildung absolvieren und mit einem guten Abschluss beenden... Aber irgendwann ging es nicht mehr. Sie war allergisch auf ein Mittel, das in diesem Beruf geradezu täglich benutzt wurde. So musste der Lehrvertrag und damit auch der Ausbildungsplatz aufgelöst werden.
Sie war nie faul und so hatte sie schnell wieder etwas Neues gefunden. Es war eine Anstellung in einem Geschäft, das für externe Firmen Waren vertrieb. Sie war eine der besten Verkäuferinnen dort und wurde von Mitarbeitern und Vorgesetzten sehr geschätzt. Oft hatte sie die Höchstzahl an Tagesabschlüssen, was daher kam, dass sie ein unglaubliches Talent besass. Die Kommunikation. Die Sprache und das Talent, „verkaufen zu können“.
Leider blieb das Glück auch dieses Mal nicht sehr lange bei ihr und so kam es, dass alle Mitarbeiter dieses Geschäfts ihre Arbeitsstelle verloren haben, auch sie, weil das Geschäft einfach nur noch rote Zahlen schrieb und Insolvenz anmelden musste. So musste sie sich, wie es in der Schweiz so üblich ist, auf dem RAV anmelden. Von diesem Tag an ging es bergab wie auf einer Achterbahn, die einfach nach unten fährt. Sie war nun gezwungen, die geforderte Anzahl an Bewerbungen dem RAV zu übergeben, ganz egal, für
was. Ob diese Stelle nun ihren Talenten und oder Qualifikationen entsprach oder nicht. Jede Stelle hätte sie anzunehmen, falls sie irgendwo eine Möglichkeit bekommen würde zu arbeiten. Wenn sie die geforderte Anzahl nicht bringt oder die Frechheit besitzen würde, eine Stelle nicht anzunehmen, weil zum Beispiel der Arbeitsweg zu lange wäre, dann wird das Geld, das am Ende des Monats ausgezahlt wird, gekürzt werden und zwar massiv. (Ausserdem, verlangt das RAV einen Arbeitsweg von 4 Stunden in Kauf zu nehmen!) 4 Stunden? Also 4 Stunden Hinfahrt zum Geschäft auf der anderen Seite der Schweiz, 8 Stunden Arbeiten und 4 Stunden Rückfahrt nach Feierabend. Wenn man dann 8 Stunden schläft, dann sind die 24 Stunden des Tages um... Ein reich erfülltes Leben!
Sie hat keine Stelle gefunden. Das RAV hat sie dann in ein so genanntes „Arbeitsintegrationsprogramm“ verwiesen. Das ist ein Ort, an dem Arbeitslose hingehen müssen, um irgendwelche Arbeiten (putzen, Küchenhilfe, Serviecemitarbeiter usw) unentgeltlich zu erledigen haben. Weigern sie sich, dahin zu gehen, wird das Geld gekürzt. Sie ging dahin. Unglücklicherweise wurde sie in ein Programm vermittelt, was dazu diente, schwer drogenabhängigen Menschen einen geordneten Tagesablauf zu ermöglichen. Jetzt putzte sie den ganzen Tag sinnlos vor sich hin, liess sich erniedrigen von den Menschen, die da (bezahlt) angestellt waren, um auf die (unbezahlten) anderen Menschen „aufzupassen“, musste sich beleidigen, anspucken und bedrohen lassen...
Ein Mann in diesem Programm hatte ihr jeden Tag gedroht, er würde sie irgendwann beissen, wenn sie nicht endlich abhauen würde. Sie würde da nicht hingehören, sie wäre ja eh nur hier, um sich über die anderen lustig zu machen. Er hatte also sogar gesehen, dass diese Frau im falschen Programm war! Also ganz offensichtlich war es das falsche Programm, denn sie hatte nie ein Drogenproblem oder sonstiges. Sie hatte lediglich ihren Job verloren... Das RAV jedoch hatte dies nicht interessiert. Als sie sich da Hilfe holen wollte und auf Verständnis hoffte, hat sie verstanden, dass es keine Hilfe und noch weniger Verständnis gibt. Nur Drohungen. Wenn Sie meinen, Sie müssten da nicht mehr hingehen, wissen Sie, dass es Kürzungen gibt. Als dieser Mann in diesem Programm, dann tatsächlich eines Tages auf sie losgehen wollte, rannte sie weg und hat auch im selben Moment dieses Programm abgebrochen. Die Kürzungen nahm sie in Kauf. Sie hat halt einfach weniger gegessen. Wenn man nach dem RAV „ausgesteuert“ ist, dann rutscht man eine Etage tiefer runter. Herzlich willkommen auf dem Sozialamt! Sie hat es also tatsächlich geschafft, auf dem Nullpunkt anzukommen. Im subsidiären System ist das Sozialamt der unterste Punkt. Das bedeutet, wenn man da angekommen ist, dann hat man am Ende des Monats am wenigsten von allen. Ein Mensch, der von Stipendien lebt beispielsweise, hat mehr, denn Stipendien sind im subsidiären System oben am Sozialamt. Die junge Frau hat sich mehr als nur bemüht um eine Stelle, einen Hilfsjob oder einen Ausbildungsplatz. Allerdings hat sie niemals eine Chance bekommen. Sie wurde schwanger, von einem Mann, der sie sitzen liess. Sie hat sich für das Kind entschieden! Und für das Leben als alleinerziehende Mutter! Da kann man nun auch wieder darüber urteilen und sie deshalb als schlecht darstellen. Denn sie hatte ja kein Geld und wie will sie auch ein Baby von Sozialhilfe grossziehen?! Nun, für diese Frau ist Abtreibung dasselbe wie Mord. Denn sie ist der Meinung, dass ein Baby vom allerersten Moment, in dem es klar ist, dass eine Frau schwanger ist, lebt! Denn wie sonst sollte man erkennen, dass eine Frau schwanger ist, wenn es kein Leben ist?! So hat sie sich, wie gesagt, für dieses Kind entschieden – und sie hat es nie bereut!
Jeden Morgen um 07.00 Uhr früh steht diese Frau pünktlich auf. Kümmert sich täglich um Haushalt, Sauberkeit, gesundes und frisches Essen und bestmögliche Förderung für ihr Kind! Sie hält Ihre Wohnung sauber und ordentlich. Bei ihr könnte man direkt vom Boden essen. Es liegt nichts herum! Sie kocht frisch und gesund. Spielt mit ihrem Kind und fördert es mit altersentsprechender Kleinkindförderung! Sie tut alles für ihr Kind! Irgendwann, so gegen 20.00 Uhr, ist der Tag beendet und das Kind schläft. Und dann, dann schreibt sie Bewerbungen... Pro Jahr ca. 480 Bewerbungen! Pro Jahr! Nicht in ihrem ganzen Leben! Bewerbungen als einfach Alles!
Sie hat eine Top Bewerbungsmappe und alle Unterlagen fein säuberlich, wie es sich gehört, darin eingereiht. Nur, ein Vorstellungsgespräch, das bekam sie nie! Wenn einmal (was sehr selten vorkam) eine Firma eine Absage schickte, dann stand da lediglich „Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir bereits jemanden für die Stelle gefunden haben. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer weiteren Suche viel Erfolg und alles Gute.“ Von 480 Bewerbungen bekam sie lächerliche 7 Briefe mit diesen leeren Worten zurück! Und vom Rest der Firmen hat sie nie etwas gehört. In der Schweiz hat sie eigentlich das Recht auf eine Erstausbildung. Allerdings hatte sie bereits dreimal versucht, Stipendien zu beantragen, und ist dreimal gescheitert. Denn die Möglichkeiten, die in der Schweiz für eine alleinerziehende Mutter bestehen, doch noch eine Ausbildung zu absolvieren, bestehen aus Privatschulen. Diese bieten Ausbildungsplätze an mit einem EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) als Abschluss. Wenn man allerdings Stipendien für eine genau solche Privatschule beantragt, bekommt man sie nicht gutgesprochen. Probleme, Probleme und nur Probleme... Das ist das Leben dieser jungen Frau. Und denkst du wirklich, dass sie gerne so lebt? Dass sie bis 15.00 Uhr schläft, sich freut auf das Geld, das am Ende des Monats kommt (und glaube mir, es ist NICHTS!)? Nichts ist nichts, was man teilen kann! Und der Grundbedarf der Sozialhilfe ist nichts! Das ist kein Leben! Das ist nur eine Existenz in einem Land, welches als so reich gilt! Diese Frau ist eine von so vielen. Von so vielen, die als Abschaum der Gesellschaft gesehen werden! Ja, mit denen ja niemand etwas zu tun haben möchte! Ist diese Frau Abschaum, weil sie sich FÜR das Leben ihres Kindes entschieden hat und es nicht getötet hat? Wäre diese Frau ein besserer Mensch, wenn sie das Gegenteil getan hätte?
Sehr geehrter Herr Banker, der von der Sonnenseite: Liegt es sich gut im warmen Bett um 07.30 Uhr? Nun, um diese Uhrzeit hat diese Frau in der Geschichte bereits gefrühstückt und bringt ihr Kind mit dem ÖV in die Schule. Denn ein Auto darf sie nicht besitzen, weil sie Sozialhilfeempfängerin ist. Und Du? Drehst du dich im Bett noch einmal um, bevor Du dann um 08.30 Uhr zu deiner Arbeit fährst und dort wieder mit deinen Arbeitskollegen über den Abschaum der Gesellschaft herziehst? Falls du das hier lesen kannst, dann lese noch einmal den Anfang dieser Geschichte. Es gibt einen Satz, an den du dich erinnern sollst, wenn du das nächste Mal über die armen Menschen der Gesellschaft lachst und über diese Menschen sprichst, von denen du die einzelnen Geschichten nicht kennst...
Alles ist endlich.
C.
Die schlechten sieben Jahre
Als das Unglück begann, war ich gerade mal 36 Jahre alt und stand mit beiden Füssen im Arbeitsleben. Es war an einem Dienstagmorgen. Ich ging wie üblich zur Arbeit, dann begann das Unheil seinen Lauf zu nehmen. Ich stürzte eine Treppe hinunter und blieb liegen. Ich konnte mich kaum mehr bewegen und hatte Angst, eine schwere Verletzung erlitten zu haben. Als das Notfallauto mich in das Spital brachte, wurde ein Bruch der ersten 3 Halswirbel festgestellt. In der anschließenden Operation wurde mir eine Metallplatte mit 6 Schrauben zur Stabilisierung implantiert. Ich war 4 Tage auf der Intensivstation, danach folgte ein Spitalaufenthalt von 5 Wochen. Nach 8 wöchiger Rehaklinik musste ich wieder zuerst lernen, richtig zu sprechen und zu essen. Meine Beweglichkeit wollte einfach nicht mehr zurückkommen. Als nach 45 Physiotherapien die Schmerzen immer noch vorhanden waren, bekam ich immer mehr Schmerztabletten. Doch diese machten mich abhängig und es wurde auch nicht besser mit der Beweglichkeit. Es kam wie es kommen musste und ich erhielt von da an eine IV-Rente und wurde vom Sozialamt unterstützt. Ich versuchte, wieder eine Arbeit zu finden, jedoch missglückte dies 3 Mal. Ich musste feststellen, dass ich immer mehr Freunde verlor und ich mich aus dem sozialen Umfeld entfernte. Ich fühlte mich nutzlos, da nach 2 Jahren eine erneute Operation der zwei unteren Bandscheiben anfiel. Ich dachte manchmal daran, warum immer ich! Ich fragte mich öfters, wo bleibt mein Glück! Als meine Mutter danach selber schwer erkrankte, hatte ich das Gefühl, dies könne doch nicht wahr sein. Sie hatte Diabetes und ihr musste ein Bein amputiert werden. Ein halbes Jahr später wurde bei ihr Krebs festgestellt. Von da an kümmerte ich mich jeden Tag um meine Mutter, da mein Vater arbeitstätig war. Ich stand jeden Morgen um 5.00 Uhr auf und machte mich auf den Weg zu meiner Mutter und pflegte sie, bis mein Vater nach Hause kam. Der Zustand meiner Mutter verschlechterte sich schnell und sie ging im Spital ein und aus. Eines Tages, als ich meine Mutter mit meinem Vater im Spital besuchte, sagte man uns, dass meine Mutter eine Lebenserwartung von maximal 3 Wochen habe und wir einen Platz suchen müssten, wo meine Mutter die letzte Zeit verbringen konnte. Diese Worte waren für mich und meinen Vater ein schockierendes Erlebnis! Für uns war klar, dass wir meine Mutter nach Hause nahmen, um in ihrer gewohnten Umgebung einschlafen zu können und mein Vater ging von da an nicht mehr Arbeiten. Meine Mutter war glücklich, wieder zuhause zu sein. Wir verbrachten alle zusammen noch 11 glückliche Tage zusammen. Wie immer war ich von morgens früh bis abends spät am Bett meiner Mutter. Es war an einem Freitagabend. Ich wollte meiner Mutter noch eine „Gute Nacht“ wünschen und gab ihr einen Kuss. Mein Vater war daneben und hielt ihre Hand. Meine Mutter schaute mich noch an und schlief friedlich ein. Nun war mein Vater alleine und wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Seit diesem Freitag war mein Vater ein gebrochener Mann! Ich konnte von Tag zu Tag mit ansehen, wie er seinen Glauben verlor. Er wurde wie meine Mutter von Krebs heimgesucht! Gleichzeitig hatte er innert 2 Jahren 2 Herzinfarkte und ging im Spital ein und aus. Für mich war es schon fast normal, dass ich nun die Aufgabe hatte, jeden Tag meinen todkranken Vater zu pflegen und rund um die Uhr für ihn da zu sein. Es waren nun 6 Jahre vergangen, seit ich meine Mutter verloren hatte. Meinem Vater ging es so schlecht, dass er zu mir sagte: „Mein Sohn, nimm mich bitte mit nach Hause“. Ich merkte selber, dass er in absehbarer Zeit sterben würde. Für mich war klar, dass mein Vater zu mir nach Hause kommt, um bei mir die letzte Ruhe zu finden. Es verging eine Woche und meinem Vater ging es immer schlechter. Er bekam starke Medikamente und hatte so viel Morphium, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Ich schlief auf dem Boden und er in meinem Bett. Es war Mittwochabend und ich lag neben ihm am Boden, als ich ein Husten hörte. Ich sah sofort nach ihm und nahm ihn in meine Arme, wo er für immer einschlief. Für mich brach in diesem Moment die Welt zusammen und ich fragte mich: „Gott, warum nur. “
Heute bin ich 48 Jahre alt und nehme Psychopharmaka und andere Schlaf- und Schmerzmittel. Mein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, dennoch habe ich die Hoffnung, dass alles gut wird. Denn die verflixten sieben schlechten Jahre habe ich nun hinter mir und glaube fest daran, dass das Glück auch mal wieder bei mir vorbeischaut.
HP Metzger
Der Mensch - der Unterschied
Seit Anbeginn der Menschheit führt sie Kriege gegen sich selbst. Warum? Krieg, Krieg bleibt immer gleich! Er beginnt ganz klein. Er kann mit nur zwei Menschen beginnen, die sich nicht mögen und später hassen. Warum? Ein Mensch hasst einen anderen Menschen aus verschiedenen Gründen. Sie sehen an sich oft nur den Unterschied. Du hast eine andere Hautfarbe, kommst aus einem anderen Land, sprichst eine andere Sprache, hast mehr Geld als ich, bist blond, nicht dunkelhaarig, bist grösser, kleiner, dicker oder dünner als ich oder du hast eine andere Religion als ich. Dann entsteht Streit und mit Streit wächst Hass. Menschen mit selben Ansichten und Werten schliessen sich zusammen und kämpfen gegen die anderen. Weil sie die anderen nicht tolerieren oder aber weil sie wollen, dass diese ihre Ansichten und ihr Denken teilen. Es ist Krieg. Warum? Grundsätzlich wollen sie also, dass die anderen gleich werden wie sie selbst sind. Menschen unterscheidet so viel und doch sind sie auch ohne Krieg zu führen so gleich?! Das verstehst du nicht?
Pass auf, ich zeige es dir. Siehst du die Sonne? Wie hell sie strahlt und mit ihrer ganzen Pracht die Erde wärmt? Sie scheint für uns alle! Kannst du den Wind spüren, der dich sanft berührt? Der Wind macht keinen Unterschied! Bevor er dich berührt, hat er jemanden anderen berührt und nach dir wieder jemand anderen. So zieht er durch die Welt. Sieh hoch zu den Sternen, siehst du, wie sie leuchten? Weisst du auch, dass wir dieselben Sterne sehen? Wir sehen dieselben! Du und ich. Wir. Wir sind doch Wir?! Oder erkennst du einen Unterschied? Wir Menschen sind in unserer Art, in unserem Glauben, Aussehen, Wohlstand, Gedanken, Weltansichten und in unserer Art auf dieser Welt zu leben so unterschiedlich wie gleich.
Wir alle sind eins- Menschen! Und…
Wir alle teilen uns etwas untereinander - unsere Welt. Alle gemeinsam.
C.
Flucht aus Algerien
Ich wurde im Januar 1954 in Kabylie, einer Gegend in Algerien, geboren. Ich wuchs auf bei den Eltern von meinem Vater und seinen Cousins, weil er selbst als Kommandant gegen Frankreich für die Unabhängigkeit Algeriens kämpfte. Meine Mutter lebte mal hier, mal dort, weil sie als Frau eines Kommandanten gesucht wurde. Erst nach 1962, der Unabhängigkeit Algeriens, konnte sie frei leben. Ich habe meinen Vater ein einziges Mal gesehen, im Februar 1958. Frere Jean hatte dieses Treffen damals arrangiert, indem er vorgab, er müsse mit mir in ein Spital in einer Stadt 150 km entfernt, wo mein Vater mit seiner Truppe war. Ich habe nur vage Erinnerungen an ihn, sehe ihn noch vor mir, den Mann in Uniform, der mir eigentlich fremd war. Kurz darauf ist er im Krieg gestorben.
Als dreijähriger Knabe kam ich zu den Pères blancs, die bald zu meiner Familie wurden. Als wäre ich dort geboren! Die drei Monate Schulferien, während denen ich bei den Eltern meines Vaters und seinen Cousins lebte, waren für mich die Hölle, weil eine andere Kultur herrschte, eine Kultur der Auseinander- und Durchsetzung, des „jeder für sich“, während ich bei den Pères blancs einen respektvollen Umgang, andere Sitten und andere Gewohnheiten gelernt hatte. Besonders Père Jean war wie mein Vater, ein ausserordentlicher Mensch, der sein Herz auf der Hand trug und mit einem milden Lächeln die Konflikte löste. Ich habe vier ältere Schwestern, aber wie gesagt, meine Familie war die Schule der Pères blancs. Ich lernte dort viele praktische Dinge wie Mauern hochziehen, Elektrisches reparieren, Feldarbeit oder mit Tieren umgehen. Wenn Père Jean mich mal fünf Minuten nicht sah, suchte er mich, er liess mich ein Bedürfnis nie länger haben. Wenn andere spielten, zog ich mich zurück und las Molière, Baudelaire und andere, hätte gerne Theater gemacht, merkte aber bald, dass ich darin kein Talent hatte. Nachdem meine Grossmutter 1972 gestorben war, wollte mich meine Familie zurückholen, aber ich wollte bei den Pères blancs bleiben.
Im Jahr 1978 wanderte ich nach Frankreich aus. Grossvater gab mir ein bisschen Geld, damit ich mir dort eine Existenz aufbauen konnte. Natürlich gab es Vorurteile gegenüber Algeriern, da ich aber die französische Kultur gut kannte, gelang mir die Integration in Paris sehr gut. Ich arbeitete in der Küche und in der Bar oder als Garçon, und eröffnete schliesslich ein eigenes Restaurant, eine Couscoussière mit französischen und algerischen Spezialitäten. Acht Personen arbeiteten für mich, ich hatte aber trotzdem viel Arbeit, musste alles andere vergessen, ich war mit meiner Arbeit verheiratet. Ich wollte keine Kunden verlieren, deshalb war mir der Empfang ganz wichtig, die Gäste sollten sich von Anfang an wohl fühlen. Oui, j’ai jouer sur l’acceuil. Das Restaurant existierte noch bis 2012, danach wurde es an eine Versicherungsgesellschaft verkauft.
Während meiner Zeit in Frankreich hatte ich drei Liebesbeziehungen, aber die ersten beiden scheiterten, weil ich zu viel arbeitete, die dritte daran, dass sie mir nicht nach Algerien folgen wollte, denn nach dem Tod meines Grossvaters, 1992, kehrte ich heim, um den Hof zu übernehmen. Die Verbindung zu meinem Grossvater war die ganze Zeit über sehr eng gewesen, wenn wir nicht alle vier Tage miteinander telefonierten, wurden wir krank. Er war Ingenieur in Agronomie und vertraute mir voll und ganz. Er starb in meinen Armen. Am tiefsten aber war meine Beziehung zu Pére Jean, ihm öffnete ich mein ganzes Herz. Wenn ich ihm Vater sagte, kamen ihm die Tränen.
Nach meiner Rückkehr begann ich den Hof zu modernisieren, kaufte einen Traktor und legte Bewässerungssysteme an. Ich liebe Tiere und Pflanzen. Meines Erachtens ist es ein Verbrechen, Tiere zu kastrieren. Ich hatte im Winter 10‘000 Hühner und im Sommer 15‘000, über 80‘0000 Kücken und 500 bis 1000 Schafe. Doch schon im Jahr 1993 begann die algerische Mafia aktiv zu werden und verlangte Geld von mir. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1997 haben sie in Betalha ein Massacker angerichtet. Es wird berichtet, die Mörder seien Islamisten gewesen, aber die algerische Armee stand dem Massacker Pate, indem sie die Stadt vor möglicher Hilfe abriegelte und die Mörder entkommen liess. Die Regierung unter Liamine Zeroual produzierte Terroristen.
Seit Dezember 1991 war das Leben in Algerien sehr schwierig, 1992 brach der Bürgerkrieg aus. 5 Tage vor den ersten freien Parlamentswahlen putschte die Armee und brachte die islamische Heilsfront (FIS) um den sicheren Sieg. Dieser Partei angehörige Menschen wurden in die Wüste deportiert und gefoltert. Die Armee schoss auf Menschen, niemand durfte etwas sagen, und wenn jemand etwas sagte, wurde er deportiert. Überall war die Polizei, die Regierung proklamierte, alle Ausländer müssten das Land verlassen. Ich erinnere mich, dass Menschen T-shirts mit folgender Aufschrift trugen: on ne peut pas nous tuer, nous sommes deja mort. 1994 wurde Père Jean und drei andere Pères blancs in Tizi Ouzou getötet. Es war ein Schock für mich. An die Beerdigung kamen viele Menschen, weil die Pères blancs so viel Gutes getan hatten. Sie führten eine Art Sekretariat für Menschen, die nicht schreiben konnten und, weil sie von weit her kamen, im Schulhaus übernachteten duften. Sie gaben Kleider und Schuhe ab an Menschen, die kaum etwas besassen. Tausende kamen an die Beerdigung. Wir sagten vor ausländischen Journalisten, dass sie nicht von Terroristen, sondern von der Spezialeinheit der Armee umgebracht wurden. Seither galt ich als gefährlich. Ich wurde eingesperrt, war 21 Monate lang im Gefängnis, wurde von einem ins andere Gefängnis gebracht und immer hiess es, das Dossier ist noch nicht da, wir können noch nichts entscheiden. Wir waren 63 Gefangene auf 40 bis 50 Quadratmeter, sahen kein Licht den ganzen Tag. Am 1. November 2001 wurde ich endlich aus dem Gefängnis entlassen, da erfuhr ich, dass sie meine Tochter, die ich mit meiner französischen Frau gehabt hatte und die mit mir nach Algerien gekommen war, umgebracht hatten. Zur Abschreckung, um mich zu warnen! Ich verliess Algerien mit meiner Frau und zwei Kindern, bekam am 15. August 2002 den Status B humanitaire. Über die Asylheime Vallorbe und Kreuzlingen bin ich nach St. Gallen gekommen. Ich hatte keine Probleme mit der Sprache und mit der Kultur, im Gegenteil, ich hatte von den Pères blancs eine Kultur des gegenseitigen Respektes gelernt. Ich erlebte auch keinen Rassismus in der Schweiz wie zum Beispiel in Frankreich. Ich habe im Restaurant Marktplatz als Küchenhilfe gearbeitet, dann im Restaurant Bäumli, manchmal über 50 Stunden die Woche. Dann, als Lagerist bei der Migros, erlitt ich einen Arbeitsunfall. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, bekomme eine IV-Rente, aber ich empfinde das Leben ohne Arbeit wie eine Strafe. Ich war wie zerschlagen nach dem Unfall, muss jetzt all die Stücke wieder zusammenbringen. Zum Glück hatte ich den Unfall nicht in Algerien. Dort wird nach dem Geldbeutel operiert und die Ratten kriechen durch die Gänge. Säuglinge liegen bis zu viert in einem kleinen Bett.
Meine Tochter hat eine gute Stelle in einer Apotheke, meinem Sohn geht es nicht gut, er hat Probleme mit dem Alkohol.
Ich habe ähnlich wie Hiob einige Schicksalsschläge erlitten. Erst als Waisenkind, da haben mir die Pères blancs geholfen. Dann, als meine Tochter umgebracht und mein Hof zerstört wurde. Und jetzt mit dem Unfall, der meine Rückenwirbel zerschlagen hat.
Ich muss mir immer wieder sagen, doch, mein Leben ist gelungen, die Pères blancs haben mich geliebt, in Frankreich habe ich ein Restaurant geführt, in Algerien einen Hof übernommen und modernisiert und auch in der Schweiz fleissig meine Arbeit gemacht.
Unsere beiden ältesten Kinder, die in Algerien geblieben sind, haben den Hof übernommen und führen ihn jetzt weiter. Wenn ich arbeiten könnte, würde ich wieder nach Algerien gehen und meinen Kindern auf dem Hof helfen. Ich könnte das Gemüse sortieren, das schöne für den Markt, das andere für die Armen oder für die eigene Küche.
anonym
Trinken Sie ihren Tee mit oder ohne Zucker
Frau F., ruft beim Kath. Sozialdienst Ost an. Sie möchte einen Termin vereinbaren. Sie ist Äthiopierin, alleinerziehende Mutter einer 5-jährigen Tochter, geschieden, wohnt seit 13 Jahren in St. Gallen und arbeitet als Reinigungsangestellte. Sie fragt mich, ob ich ihr helfen könne beim Ausfüllen eines Formulars für das Migrationsamt. Es geht um die Aufenthaltsbewilligung. Zudem möchte sie den Betrag, den sie nach der Scheidung vom Sozialamt erhalten habe zurückbezahlen. „Keine Schulden mehr beim Staat haben,- auf eigenen Füssen stehen“,- das ist ihr Ziel. Ich vereinbare mit dem Sozialamt Ratenzahlungen.
Frau F. möchte mich unbedingt einladen zu Tee und Kuchen. Sie wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich besuche sie. Am Tisch sitzen ihre Freundinnen – ebenfalls Äthiopierinnen. Die Frauen plaudern angeregt. Als ich mich hinsetze, bemühen sie sich deutsch zu sprechen. Die Atmosphäre ist herzlich, fröhlich und unkompliziert. Ich sitze in dieser „fremden“ Wohnung. Die Sprache, der Duft, die farbigen Kleider erinnern mich an ferne Länder. Und dennoch fühle ich mich irgendwie „zu Hause“. Frau F. giesst Tee in meine Tasse und reicht mir die Zuckerdose. Ich bedanke mich: „Ich nehme keinen Zucker.“ Die Frauen lachen. Eine sagt schalkhaft: „Wenn wir unseren Tee einmal ohne Zucker trinken, sind wir in der Schweiz integriert.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
The first cut is the deepest (erster Teil)
Frühsommer 1996. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, damals in einem Behindertenheim in Teufen. Noch etwas müde, aber sonst guter Dinge, wollte ich am Kiosk noch Kaffee und Zigaretten kaufen.
Dann, wie ein Hammerschlag von hinten, war die Welt eine andere. Die normale Metapher war ungültig, meine Knie waren nicht wie Pudding. Mein ganzer Körper war kochender Pudding, sodass ich nur noch auf die nächste Bank sinken konnte.
Der Verstand ausgeschaltet, der einzige Gedanke: Du stirbst, in den nächsten Sekunden, Minuten, vielleicht Sunden, aber DU STIRBST.
Die Anzeichen dafür waren klar. Mein Herz schlug nicht mehr oder aber so schnell, dass Sys- und Diastole nicht mehr unterscheidbar waren. Ich atmete nicht mehr oder aber so schnell, dass ich trotzdem keine Luft bekam.
Der einfahrende Zug sah aus wie immer, die Passanten (starrten sie mich nicht alle an) sahen aus wie immer, mein Gefühl sagte mir, dass sie alle aus der Hölle kamen, um mich zu holen.
Ich kannte zwar irrationale Angst seit meiner Jugend, aber das hier war nicht vergleichbar. Ich kam mir vor wie ein 100 m-Läufer, der plötzlich auf dem 41. Kilometer der Marathonstrecke ist, das Laufen ist gleich, die Belastung unendlich anders.
Plötzlich der Gedanke: DU LEBST NOCH.
Damit kam ganz langsam ein Teil meines logischen Denkens zurück.
Ein Check-up hatte ergeben, dass mein Körper erstaunlich gesund war, es gab also keinen Grund zu sterben. Somit musste also die Panik für alle somatischen Reaktionen verantwortlich sein, und, wie jeder Angstpatient bestätigen wird, gibt es nur ein frei erhältliches Medikament gegen Angst: Alkohol.
Nach einiger Zeit traute ich mir zu aufzustehen und ging zum Kiosk. Der Verkäufer starrte mich komisch an, entweder weil ich morgens um sechs drei Underberg kaufte, oder weil mein schweissüberströmtes Gesicht verdächtig wirkte.
Nachdem ich die Schnäpse schnell gekippt hatte, liessen die körperlichen Symptome etwas nach, vor allem aber konnte ich wieder klarer denken. Wenn wenig wenig hilft, hilft viel viel. Also begab ich mich, um besser nachdenken zu können, in die nächste Kneipe und orderte Wodka. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Erstens musste ich am Arbeitsplatz anrufen und mich krankmelden, was einige Zeit später auch möglich war, obwohl meine Angst eigentlich gar keine Handlung erlaubte. Das Zweite war wesentlich schwerer. Ich musste sofort etwas unternehmen, denn das wollte ich nie wieder erleben (ein unerfüllbarer Wunsch, wie ich später noch sehr oft feststellen musste). Das hiess Notfallstation. Ich stärkte mich also – und das ist nicht ironisch gemeint – noch etwa eine Stunde und machte mich auf den Weg. Sobald ich die „sichere“ Beiz verlassen hatte, nahm die Angst wieder zu und als ich beim Spital ankam, war sie wieder so stark, dass ich am liebsten wieder gegangen wäre.
Zu meinem Glück musste ich nicht warten – im Notfall normalerweise unmöglich – und ich muss so mies ausgesehen haben, dass ich nach kurzer Erklärung sofort Valium gespritzt bekam.
Oh segensreiches Benzodiazepin, in kürzester Zeit war ich ein neuer Mensch.
Da ich nie zuvor Benzos bekommen hatte, war die Wirkung verblüffend, mein vorheriger Zustand war nicht mehr spür-, noch nicht einmal nachvollziehbar. Dennoch überredeten mich die Ärzte stationär zu bleiben, was sich auch als sinnvoll erwies, denn sobald das Valium nachliess, musste ich nachschieben.
Und so begann eine bis heute anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere.
anonym
Geteilte Angst ist doppelte Angst (zweiter Teil)
Ich bin zu Besuch im Haus meiner Kindheit und Jugend. Beim Ausräumen meiner alten Sachen entdecke ich ein Stofftier. Ich beschliesse, es bei einem in der Nähe stattfindenden Flohmarkt zu verschenken. Doch jeder, dem ich es anbiete, sagt, dass es nicht zu ihm passe. Plötzlich merke ich, dass sich das Stoffding in etwas Lebendiges verwandelt. Ich versuche, es loszulassen, aber es klebt an meinen Händen. Spreize ich die Arme auseinander, dehnt es sich entsprechend.
Ich gehe nach Hause in mein Zimmer. Dort wickle ich es um die Türklinke und trete weit zurück, aber das Tierding bleibt kleben. Ab einer gewissen Dehnung reisst es auseinander. Nun stehe ich mit den Füssen auf die herabhängenden Enden, die anderen sind immer noch fest an meinen Händen. Auch hier gibt es wieder einen Riss, manche Teile des noch immer lebenden Wesens kleben nun an anderen Orten meines Körpers, zudem fallen nun kleine Fetzen während des Reissens zu Boden. Dort verwandeln sie sich in eine Art automatisierter Insekten. Da ich sowieso unter einer gut ausgeprägten Entomophobie (Angst vor Insekten) leide, wird die Lage zusehends bedrohlicher.
Immer noch versuchend, mich von den an meinem Körper klebenden, sich windenden Teilen dieses Dinges zu befreien, trete ich nun auf die am Boden befindlichen Stücke. Diese sehen nun aus wie plattbedrückte Kaugummi, teilen sich und wölben sich zu einem neuen Wesen. Voller Ekel und Panik stampfe ich nun hintereinander auf die neu entstandenen Dinger; der Vorgang wiederholt sich und erinnert an die Köpfe der Hydra. Ohne zu überlegen zerre und trete ich weiter. Die Insektendinger werden immer mehr.
Plötzlich merke ich, zu was das alles führen wird. Ich bin in einem geschlossenen Raum, kann mein Tun nicht kontrollieren und mache immer weiter. Da der Boden inzwischen in mehreren Lagen von diesem Zeug bedeckt ist, wird sich das ganze Zimmer in absehbarer Zeit damit füllen und ich werde ersticken. Als mir die Insektenwesen im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Hals stehen, wache ich auf, muss aufstehen, eine rauchen und fernsehen, da ich weiss, wenn ich wieder einschlafe, werden mich die Bilder weiter verfolgen.
Schmerzhafte Heilung (dritter Teil)
Ich wohne ihn einem riesigen Haus, das aussieht, als sei es von Escher und H.R. Giger gemeinsam konstruiert worden. Um von einem Zimmer meiner Wohnung zu einem andern zu kommen, muss ich zum Teil andere Wohnungen durchqueren.
In einer Art Gemeinschaftsraum treffe ich auf meine Oma, die sagt, dass sie in den letzten Jahren mehrere sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte. Auf meine Bemerkung, dass das mit 91 eine respektable Leistung sei, werde ich von den anderen Anwesenden als zynisch beschimpft. Erst jetzt bemerke ich, dass sich sehr viele Leute im Raum befinden. Und zwar sind es Menschen, die ich in meinem Leben mehr oder weniger gut kennengelernt habe. Alle sind der „besseren“ Gesellschaft zuzuordnen, sei es aufgrund von Status – Rechtsanwälte, Zahnärzte, Politiker etc. – oder Intellekt, z.B. viele Mitstudenten oder Dozenten von Früher. Auch Teile meiner Familie sind dabei.
Obwohl sie alle so aussehen wie früher, habe ich das Gefühl, dass sie sich auf irgendeine Art ähneln.
Als die Angriffe gegen mich immer heftiger werden, beschliesse ich, in meine Wohnung zurückzukehren. Dort ankommend stelle ich fest, dass alle meine persönlichen Sachen verschwunden sind. Ebenso wurden meine Schlösser ausgetauscht.
Als ich mit der Polizei wieder komme, ist meine Wohnung in eine Bar umgebaut, deren Besitzer und Gäste „diese Leute“ sind.
Szenenwechsel: ein Ferienort (Spanien?)
Zunächst ist alles schön, ich bin froh, mich erholen zu können. Plötzlich erkenne ich immer mehr mir bekannte Gesichter. Es stellt sich heraus, dass „diese Leute“ auch hier sind. Als sie mich allein finden, schlagen sie mich brutal zusammen, die Polizei sagt mir, sie könne nicht helfen.
In der Hoffnung, irgendwo Zuflucht zu finden, entdecke ich beim Gang durch die Stadt das Haus einer religiösen Gemeinschaft und die netten Menschen dort versichern mir, dass sie mich schützen werden. Mit der Zeit fällt mir auf, dass sich die Mitglieder auf irgendeine Weise ähnlich sind.
In dem Moment entpuppen sie sich m wahrsten Sinne des Wortes als „diese Laute“. Sie brechen mir mit Baseballschlägern die Glieder, stechen mit Messern auf mich ein und prügeln mich schliesslich zu Tode.
In diesem Moment erwache ich (es wäre mir lieber gewesen, dies wäre früher geschehen).
Epilog
Normalerweise würde jeder – inklusive mir – das Ganze als Ausdruck meiner paranoiden Persönlichkeitsstruktur werten. Das Lustige am Ganzen ist Folgendes: Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich am ganzen Körper solche Schmerzen, dass ich zur Beruhigungszigarette in die Stube kriechen musste. Als ich schliesslich doch noch auf dem Sofa einschlief und wieder erwachte, waren die starken Glieder- und Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, vollkommen verschwunden.
Yamabushi (vierter Teil)
Vor Jahren habe ich in irgendeinem Roman den Begriff Hauptbuch das erste Mal gelesen. Ich vermutete kontextmässig, dass es sich um etwas aus dem Geschäftsleben handelte. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, sollte es vermutlich mal googlen, aber das Wort ging mir nicht aus dem Kopf. Zudem habe ich es irgendwie mit Jungs Rotem Buch assoziiert und gedenke nun jetzt und hiermit etwas Ähnliches für mich und posthum vielleicht für andere zu verfassen.
Es soll Gedanken über grundsätzliche Probleme vor allem meines Lebens, aber auch über einfach alles enthalten.
Bevor ich aber eine ausführliche Vorrede verfasse, was ich in Abständen stückweise auch noch vorhabe, gehe ich direkt zu einem sehr aktuellen und dennoch für mich prinzipiellen Thema.
Die grundlegende Problematik ist, dass ich bei den meisten Dingen weiss, was richtig ist und was ich tun sollte. Aber mir stehen mein Trotz (negativ) und meine Abneigung (positiv) gegen Fremdbestimmung im Weg. Zurzeit geht es um Nicht-Rauchen und Fasten. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich beides kann, dass es mir gut tut und dass ich dadurch andere Probleme besser lösen kann und die Freiheit habe, das zu tun, was ich wirklich will.
Im Moment hält mich Geldmangel ab von meinem Ideal des Yamabushi (japanischer Eremit, der sich der Askese widmet), der ich nach meinem Umzug in die Berge gerne wäre, aber Askese ist nur dann möglich, wenn sie freiwillig geschieht, nicht, wenn ich durch Staatsbürokratie in die Armut gepresst werde.
Dies waren seine letzten Sätze. Der Vermieter fand ihn tot in seiner Wohnung. Die Ärzte vermuteten, dass er an übermässigem Konsum von Medikamenten und Alkohol gestorben war.
Pogrom von Istanbul
Im Jahr 1955, als 15-jähriges Mädchen, habe sie das Pogrom von Istanbul erlebt: „Gewalttätige Schläger sind am 6. und 7. September in Zügen und Bussen nach Istanbul gereist und haben die Wohnungen von uns Griechen geplündert und die orthodoxen Schulen und Kirchen niedergebrannt. Die Polizei schaute zu. Seither hat mein Vater die Namen von uns Kindern immer auf Türkisch geschrieben.“
Mit 20 Jahren sei sie in die Schweiz gekommen und habe einen Mann geheiratet, der drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes an einem Gehirntumor gestorben sei. Danach habe sie wieder geheiratet, einen italienischen Einwanderer. Gearbeitet. Gespart. Sie sei Schweizerin geworden. Nach dem Tod ihres Vaters habe sie die Angst um ihre Mutter geplagt, die jetzt allein in Istanbul gewesen sei. Sie habe sie in die Schweiz geholt, gepflegt sie bis ihrem Tod. Kurz darauf sei ihr zweiter Mann an Krebs gestorben.
Morgen gehe sie wieder zu ihrem Sohn in die Klinik. Bringe ihm Zigaretten und Schokolade.
Er mache Geduld, erzählt die ältere Frau von ihrem Sohn, der schon seit zwei Jahren in der Klinik ist. Er sei über neunzig Kilo. Sie bringe ihm Schokolade und Zigaretten. Er glaube an UFOs. Nein, die gibt es doch nicht, sage sie zu ihm. Er würde alles lieber aufgeben als seinen Glauben an UFOs – und an die Scientologen. Mit 17 sei er da reingerutscht.
Ich sehe das 15-jährige Mädchen vor mir, wie es die gewalttätige Horde näher kommen hört und verzweifelt hofft, eine wundersame Macht möge sie und ihre Familie retten.
Er mache Geduld.
Ich sehe den jungen Mann vor mir, als modellierte er die Geduld seiner Mutter und seine eigene, die immer noch auf den Vater wartet. Was wird sein, wenn die Skulptur abgedeckt wird?
Gemeinsam füllen wir die Steuererklärung aus. Während ich Bankauszüge und Rentenbescheinigungen durchblättere, entsteht ein Augenblick der Stille.
„Was kann ich tun“, fragt sie,“ ausser beten?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Not mit Nachtschicht
Sofa abgewetzt
Matratze mit Rissen
Die verstaubte Fahne
Im Zimmer des Sohnes:
Galatasaray
So sei er vor ihr gestanden
Sagt sie und wankt mit
Hängenden Armen hin und her
Und weint sich zurück
Vom Besuch in der Klinik
Sein Vater habe sich
Nie um ihn gekümmert
Die Tochter mit acht
Monaten gestorben
Und noch immer
Sieht sie den Sarg
Im Bauch des
Flugzeugs verschwinden
Zeigt auf den
Kaputten Staubsauger
Auch das noch
Auch der versagt
Seinen Dienst
Und in der Luft ein Staub
In dem das Licht erstickt
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Flash
Bimena Flash fühlsch di wiä neu gebora
doch chum i druf hei weiss i, jetzt gits heissi Ohre
doch leider gits au Zita do hesch kei Cash
denn merksch au, du vermissisch da Flash
denn wennd druf bisch, bisch i dinera eigna Welt
doch leider got au druf dis letschti Geld
denn endlich bim ena Neujahrs Ziel han is grafft
Droge bringend nüt und hans mit letschter Chraft
usem Droge Kreis use gschafft –
doch am Kiffe han i no nöd ganz chöna entflücha
i dua jetzt no gern mol amena Joint zücha
Christoph Zanotti
Im Wartsaal
Im Kinosessel lässt sich leichter mitfühlen. Man braucht auch nicht zu handeln, keine Entscheidungen zu treffen. In „Le silence de Lorna“ geht die Titelfigur, eine Albanerin, eine Scheinehe mit einem Junkie ein, um Belgierin zu werden und ihren grossen Traum zu verwirklichen: eine Imbissbude zu eröffnen. Ungewollt, durch das provozierende Verhalten des Junkies beinahe gezwungen, hilft sie ihm, einen Entzug zu machen. Allein ihre Anwesenheit, das Teilen alltäglicher Tätigkeiten, schienen ihm die Kraft dazu zu geben, den Entzug durchzustehen. Das ist aber nicht im Sinn der Männer, die im Hintergrund die Fäden ziehen und die Scheinehe arrangiert haben. Sie wollen, dass der Junkie, sobald Lorna im Besitz des belgischen Passes ist, so schnell wie möglich verschwindet, am besten an einer Überdosis stirbt, denn es wartet ein Russe, der durch eine Scheinehe mit Lorna Belgier werden will. Die Geschichte in allen Verästelungen weiter auszuführen, ginge hier zu weit: Am Ende des Films flieht Lorna vor ihren Häschern, denen sie bisher zugedient hatte, um ihren Traum zu verwirklichen, rennt durch einen Wald, findet Zuflucht in einer Waldhütte, macht ein Feuer für sich und – das Kind, das sie vom inzwischen verstorbenen Junkie erwartet.
Gestern Abend sass ich nicht im Kino, sondern in meinem Büro, als das Telefon läutete, die Sekretärin vom Pfarramt, ein Mann sei bei ihr, er brauche dringend Hilfe und könne nicht warten bis das Büro der Caritas, das für Durchreisende eigentlich zuständig wäre, morgen wieder offen ist. Wenige Minuten später öffne ich einem Mann die Türe, der mir folgende Geschichte erzählt:
„Sie müssen mir helfen, Sie sind der einzige, der mir helfen kann. Meine Familie wartet im Bahnhof, meine Eltern, meine Frau und meine zwei Kinder, wir sitzen fest und haben nichts zu essen. Wir brauchen nicht viel, nicht 2000 Euro, nicht 1000 Euro, nur 800 Franken, damit ich mit meiner Familie nach Paris reisen kann, wo ich arbeite. Nur leihen, ich werde es Ihnen zurückzahlen, nicht morgen oder übermorgen, aber sobald ich kann, über die Western Union Bank.“
Er legt mir ein Dokument vor mit dem „titre de séjour“ für Frankreich. Er selbst stammt aus Kosovo.
„Wie es dazu gekommen ist? Ich habe einem Albaner, der einen Camion besitzt, 5000 Euro gegeben, damit er meine Familie nach Frankreich bringt. Auf einer Autobahnraststätte im Rheintal hat er angehalten und meine Familie fortgeschickt, raus hier, hat er geschrien und meinen Vater geschlagen.“
Tränen schiessen ihm in die Augen, in ohnmächtiger Wut wankt er mit dem Kopf hin- und her und lässt seinen Blick über die Decke gleiten.
„Wir haben nichts zu essen, kein Billet, nichts. Nur leihen, bitte glauben Sie mir, schauen Sie hier!“
Er legt mir ein Schreiben von einem französischen Pfarrer vor, das bescheinigt, dass er ein integerer Mensch ist und sich für die Mitmenschen einsetzt. Der Brief ist weder mit Datum noch mit Briefkopf versehen.
„Und das hier bin ich!“ Er zeigt mir ein A4-grosses Farbfoto, auf dem schwarze Kinder auf einem Lehmboden sitzen und er in einem Talar neben ihnen steht. Er sei mit dem Pfarrer, der den Brief geschrieben habe, in Madagaskar in einer Mission gewesen, habe dort Kinder unterrichtet.“
Ich fragte ihn, wie sie denn über die Grenze nach Frankreich kommen wollten. Er kenne eine Grenzkontrolle bei Genf, die könne man zu Fuss überqueren, das sei kein Problem. Er müsse ja in zwei Tagen wieder zur Arbeit. Und seine Familie? Ja, die werde er dann schon irgendwie nach Frankreich schleusen.
Er arbeitet bei der Métro. Ich stelle mir vor, wie er sich durch die Menschenmenge zwängt, um Billete zu kontrollieren. Oder wie er in einem kleinen Häuschen sitzt und Billete verkauft. Sein Traum ist es, seine Familie bei sich zu wissen und genügend Geld zu verdienen, um sie zu ernähren.
1999 sei er im Krieg gewesen gegen Jugoslawien. Er hebt seine Arme, als hielte er ein Gewehr in den Händen: „Aber ich habe niemanden getötet.“ Wieder schiessen ihm Tränen in die Augen.
„Sie haben ein gutes Gesicht, ich sehe das, sie leiden mit mir. Sie sind der einzige, der mir helfen kann.“
„Ich kann Ihnen das Geld nicht geben“, sagte ich.
Er quittiert meine Aussage mit einer Mimik, als würde ich ihn direkt in die Verdammnis schicken.
„Ich kann Ihnen höchstens einen Gutschein für 50 Franken geben, damit Sie für sich und ihre Familie etwas zu essen kaufen können.“
„200?“, fragt er
„Ich lasse nicht mit mir verhandeln.“
Nachdem er gegangen war, blieb ich lange alleine im Büro zurück. Ein unbefriedigendes Gefühl nagte an mir. War das Hilfe? Hätte ich nicht vielmehr nein sagen sollen? Habe ich mich mit 50 Franken losgekauft? Habe ich bezahlt, um ein Problem loszuwerden? Ein Problem, von dessen komplexen Zusammenhängen ich nicht einmal die Spitze des Eisbergs erkennen kann. Hätte ich mit ihm gehen sollen, um seine Familie kennen zu lernen? Aber stell dir vor, er hätte nicht gelogen und du stündest jetzt im Wartsaal vor seiner Familie: Würdest du deine Hilflosigkeit ertragen? Oder anders herum: Hätte ich ihn nicht anzeigen müssen, um dieses Spielchen (falls es denn eines ist), das noch viele karitative Institutionen beschäftigen wird, zu beenden? Nicht aus Staatshörigkeit oder gar Fremdenfeindlichkeit, sondern um ihm und seiner Familie den Leidensweg abzukürzen?
Was war wahr an seiner Geschichte? Und wenn sie erlogen war, wie gross musste die innere Not dieses Menschen sein?
Lange blieb ich sitzen. Mir blieb nur das Schweigen. „Le silence d’un assistant social“.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Ohne dich
Ich fragte den jungen Mann, was er denn gerne mache, richtig gerne, mit Leidenschaft.
Er schreibe Gedichte.
Gedichte?
„Ja.“
„Wir freuen uns über Gedichte, wir können sie auch veröffentlichen unter www.ueberlebenskunst.org.“
„Meine Gedichte versteht hier niemand. Ich schreibe in Portugiesisch.“
„Wir finden jemanden, der es übersetzt.“
Zur nächsten Beratungsstunde brachte er ein Gedicht mit:
Ohne dich
Diese Einsamkeit verfolgt mich
Diese Leere, niemanden zu haben.
Aus meiner Lebenserfahrung der Wunsch
mich zu sehr abschirmen zu wollen.
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Angst, weil die Welt beängstigend ist
Angst vor der Einsamkeit
Angst vor der Liebe
Angst vor allem und jedem
Angst ein Wesen aus Nichts zu werden
Angst vor dem Leiden
Angst jemanden zu verletzen
und meine grösste Angst: Dich zu verlieren!
Für seine Gedichte hatte er nie einen Verleger gefunden. Ich kann mir vorstellen warum. Zu wenig Formbewusstsein, könnte der eine Lektor gesagt haben. Keine eigene Sprache, der andere.
Ich lese das Gedicht, zweimal, dreimal:
Ein Warum mit vielen Fragen,
wächst zu einem Wesen ohne Antwort.
Und tauche ein in ein Lebensgefühl, das ich nicht präziser hätte beschreiben können: Verloren in einem Horizont ohne Ende. Wo beginnen, welchen Standpunkt einnehmen, wo dieser doch mit der Zeit fliesst, schon jetzt wieder ein anderer ist? Dieses Lebensgefühl, das auf der anderen Seite auch Offenheit beinhaltet, hat gelitten während jener Zeit, da ich genau zu wissen glaubte, wer ich bin.
Der unendliche Wille,
die Unendlichkeit von Nichts.
Ich sehe mich zielstrebig durch die Stadt laufen, zielstrebig meine Karriere planen. Sehe mich unterrichten mit modernen Methoden-Tools. Grandios, was ich mit meinem Willen erreicht habe, erreichen kann.
die Unendlichkeit von Nichts.
So lese ich das Gedicht, stolpere voran, glaube zu verstehen und verstehe wieder nicht.
Nach einem halben Jahr kommt er überraschend wieder zu unserer Beratungsstelle. Er wolle nur einen Essensgutschein. Seine Situation hat sich kaum verändert. Er hängt rum in den Dreiweihern, lebt vom Sozialamt und muss massive Kürzungen hinnehmen, weil er Termine nicht einhält.
„Ich habe ihr Gedicht aufgehängt, hier im Pfarreiheim.“
„Ehrlich?“
Wir gehen das Treppenhaus hinunter bis zu seinem Gedicht. Lange bleibt er davor stehen, lächelt und sagt:
„Ich sollte wieder schreiben.“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter und Geschichtensammler
Januar 2013
Die Doppelgängerin
„Ich habe eine Doppelgängerin", sagt sie. „Sie hat mir die Tasche gestohlen mit all meinen Bankkärtchen drin und hebt jetzt von meinem Konto ab." „Niemand kann von ihrem Konto Geld abheben. Ihr Geld ist sicher auf der Bank", versuchte ich sie zu beruhigen. „Nein, sie hat schon letzten Monat Geld von meinem Konto abgehoben." „Niemand hebt Geld von ihrem Konto ab. Ich würde das auf den Bankauszügen sofort erkennen. Ihr Geld ist sicher auf der Bank." „Nein … Und jetzt holt mich bald ein Mann ab. Ich möchte nicht auf das Schiff! Himmelsternen! Jetzt bin ich doch schon 79 und sollte noch auf einem Schiff arbeiten. Das ist streng! Kann man nicht dafür sorgen, dass ich hier bleiben darf?" „Sie dürfen hier bleiben." „Nein." „Ganz bestimmt, sie dürfen hier bleiben. Auch ihre Betreuerin sagt, dass sie hier bleiben dürfen." „Haben Sie mit ihr gesprochen?" „Ja", lüge ich, um ihr Sicherheit zu geben. Wenn alle um sie herum bestätigen, sage ich zu mir, dass sie hier bleiben darf, wird sie sich vielleicht beruhigen. „Woher haben Sie denn gewusst, dass ich abgeholt werde?"
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Interaktives Plakat
Interaktives Plakat
3Weiern
Gemeinsam erleben geniessen erhalten
ohne Komatrinken und Cannabis,
ohne Littering, ohne Lärm
mit Respekt zur Umwelt
1. Akt: Unter gemeinsam erleben, geniessen, erhalten steht in fetten Buchstaben geschrieben: Ihr habt keine Ahnung! Zudem ist ohne dreimal durchgestrichen, nicht aber mit Respekt zur Umwelt.
2. Akt: Ein gelbes Blatt klebt auf dem Plakat mit der Aufschrift: Plakate aufhängen verdient keinen Respekt – Sozialarbeit schon. Eine Anspielung an die momentan laufende Plakataktion in der Stadt, welche aber die Rollen umkehrt: Nicht Sozialarbeitende definieren, was Betroffene zu tun oder zu lassen haben, sondern Betroffene definieren, welche Sozialarbeit Respekt verdient.
3. Akt: Das Plakat wird mit einem neuen Plakat überklebt.
4. Akt: ohne ist wieder dreimal durchgestrichen.
Heute Abend gehe ich wieder joggen und bin gespannt, wie die Geschichte weitergehen wird.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Ist das Schicksal kooperativ
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine Heimkarriere. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen bei unserer Mutter auf. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an:
„Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du wirst, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsenen Personen zu und fragte: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen ein. Bei einem grösseren Coup sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich wieder, Menschen zu begegnen, ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige es ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet.
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, allein zu sein.
Letzte Weihnachten feiern wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe – und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihm kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich wie ein Vater war, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob die Klippe meines 25-sten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und etwas zu essen reicht es. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld. Aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder ausstellen und den Leuten von Blut und abgeschlagenen Köpfen erzählen. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
Anonym
Neulich an der Tür
„Guten Tag, meine Name ist M. K., bevor ich weiterspreche, lesen Sie bitte diese Karte.“ Sie überreicht mir eine laminierte Karte, darauf steht in einigen Sätzen, dass sie keine Bettlerin ist, eine seelische Krankheit hat und Karten verkauft. Auch wenn ich in den letzten Wochen etwas bedrängt worden war und an jedem Arbeitstag mit weiteren unerfüllbaren Wünschen von Menschen an der Türe zu rechnen habe, bin ich interessiert und frage die Frau, die etwa Mitte dreissig schien, wie sie zum Kartenverkauf gekommen ist. Ich merke bald, dass sie Mühe mit Sprechen hat. Sie stottert und wiederholt immer wieder einige Wörter. Trotzdem bemüht sie sich sehr und beantwortet bereitwillig meine Fragen:
„Ich war einige Male in einer psychiatrischen Klinik. Da ich mit meiner Krankheit keine Arbeitsstelle finde, habe ich mich mit 5 anderen Kollegen zusammengetan. Wir gestalten Karten, lassen sie drucken und verkaufen sie täglich in einer anderen Stadt. Morgens wirft jeweils mein Kollege einen Pfeil auf eine Landkarte an der Wand. Und dorthin fahren wir dann. Jeder für sich. Ausser einem, der hat Epilepsie, er trifft sich alle zwei Stunden mit jemanden von uns. Heute war ich mit St. Gallen dran. Wohnen tue ich übrigens in Kreuzlingen.“
„Und verkaufen sie viele Karten? Und was passiert mit dem Geld, das sie verdienen?“
"Ich und meine Mitarbeiter versuchen mit den Einnahmen zu leben. Ich wäre sonst von der Fürsorge abhängig und das möchte ich nicht. Unsere Karten kommen bei den Leuten gut an, weil sie in keinem Geschäft zu kaufen und günstiger sind. Zudem schätzen sie es, dass wir einen Weg gefunden haben, um Geld zu verdienen. Der Aufwand ist sehr gross. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht bis ich den Mut zusammen hatte, an den Wohnungstüren zu läuten und meine Geschichte zu erzählen. Auch die Lauferei den ganzen Tag macht mich sehr müde.“
Ich begann zu realisieren, dass Frau K. und ihre MitstreiterInnen eine enorme Leistung vollbringen. Anstatt auf irgendwelche Unterstützung vom Staat oder von Institutionen zu hoffen, nutzen diese Menschen ihre Ressourcen.
„Wir unterstützen solche Projekte und den Durchhaltewillen, den sie haben. Ich nehme gerne einige Karten“, sage ich mit grossem Respekt.
Ich bitte sie ins Büro herein und wähle 9 Karten mit Scherenschnitt-motiven aus. Frau K. ist sichtlich erleichtert, dass sie sich einen Moment hinsetzen kann. Ich stelle mir vor, wie es wohl ist, die ganze Woche durch an den Türen zu klingeln und immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Die Spannung auszuhalten, ob die Person an der anderen Seite der Türe einem freundlich begegnen wird oder nicht.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Eine Wohnung im Himmel
Die Alte hat zum Sterben ihre Brille auf einen Schemel gelegt, gerade neben dem Bett. Das Sonnenlicht fällt schräg über den Wald, in dem sie oft spazieren gegangen ist, über die Bank am Waldrand, auf der sie oft gesessen ist und Gedichte geschrieben hat, über den Skilift, der jetzt im Herbst ausser Betrieb ist, über die Schiessanlage, die meistens nur samstags benutzt wird, und auf den Schemel, wo es die langen Schatten der Brillenbügel nachzeichnet und die Gläser leuchten lässt, als beobachteten sie das Sterben der Alten.
„Aha, Herr B.“, sagt sie und döst weiter. Sie hat sich abgedeckt, weil die Sonne direkt auf ihr Bett scheint. Bei Knie und Fussgelenk ziehen sich blaue Äderchen durch käsig-weisse Haut. Sie zieht den Rotz hoch, wie sie das früher oft getan hat, ohne die Augen zu öffnen. An der Wand hängt eine Fotografie von ihr mit einem Pferd vor dem Bauernhof, in dem sie aufgewachsen ist. Wie gemeisselt steht sie da, ein Bild für die Ewigkeit. Wie alt war sie damals, dreizehn, fünfzehn? Auf der rechten Seite ein Bild mit einer weissen Bergkette, an deren Fuss ein Fluss fliesst. Auf der linken Seite ihre Eltern.
Sie wollte nicht, dass ihre Tochter sie besuche.
Auf dem Schreibtisch liegt die Zeitung mit der Fotografie eines Herbstwaldes, von einer Leserin geknipst. Ich weiss es, weil ich die Zeitung heute Morgen bei einer Tasse Tee gelesen habe. Von hier aus könnte man ein ähnliches Bild schiessen, aber hier gibt es nichts mehr, was für die Zeitung interessant ist, hier läuft die Zeit aus.
Die Rauchfahne am Kamin gegenüber duckt sich im Wind, ihr Schatten wabert über den Hausgiebel nebenan. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich werde für sie die Formalitäten erledigen müssen.
Aber wie ich auf dem Fahrrad sitze und die feuchten Ränder um die plattgedrückten Herbstblätter glitzern sehe, erfasst mich plötzlich Freude und Trauer zugleich, ich möchte weiter radeln, immer weiter radeln und ihre Fahne durchs Land tragen auf der geschrieben steht: Ich habe für Arbeiter und alte Menschen eine Pension geführt und – der Vater im Himmel hält eine Wohnung bereit für mich.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Hartnäckig
Jedem der drei Katholischen Sozialdienste der Stadt St.Gallen ist ein bestimmtes Gebiet zugewiesen. Zu Beginn einer Beratung muss anhand einer Strassenliste abgeklärt werden, welche Stelle für die anfragende Person zuständig ist. Am Anfang meines Praktikums stellte das korrekte Entschlüsseln dieser Liste für mich eine Herausforderung dar. So auch bei dem Mann, der vor der Türe des Sozialdienstes Zentrum stand, und den ich irrtümlicherweise an einen anderen Sozialdienst verwiesen habe.
Wenige Tage danach bat uns der Sozialarbeiter der Caritas um einen Termin für einen Klienten. Zu meiner Überraschung stand zum vereinbarten Zeitpunkt genau der Mann vor der Tür, den ich wenige Tage zuvor zu meiner Kollegin geschickt hatte. Offenbar hatte er nicht locker gelassen und gelangte nun über die Caritas doch noch zum Katholischen Sozialdienst Zentrum. Um einige offene Fragen zu klären, setzte ich mich daraufhin mit einer weiteren Fachstelle in Verbindung. Die dort zuständige Sachbearbeiterin erklärte mir, dass sie den Mann gut kenne, weil er öfters bei ihnen vorbeikomme und immer wieder hartnäckig seine Anliegen vorbringe.
Unterdessen war der Mann nicht untätig geblieben, denn kurz danach zeigte er uns ein handgeschriebenes Dokument – er hatte beim RAV jemanden dazu gebracht, eine Bewerbung für seine Frau zu verfassen. Weil das Ehepaar keinen Drucker besitzt, erklärten wir uns dazu bereit, die ersten Bewerbungsschreiben bei uns im Büro auszudrucken. Zum Termin erschien das Paar dann mit Dutzenden von Diplomen und einem ganzen Sortiment an Firmenvisitenkarten. Der Mann hatte innerhalb kurzer Zeit bei allen Geschäften persönlich vorgesprochen, um eine Stelle für seine Frau zu finden.
Dieses zielstrebige Vorgehen des Mannes erheitert nicht alle beteiligten Fachstellen. Auch mir sind seine unangemeldeten Besuche nicht immer angenehm gewesen, doch bin ich von der Hartnäckigkeit beeindruckt, mit der er sich für seine Anliegen einsetzt. Gewiss eckt er mit seinem Verhalten an, doch ist es wohl gerade seine Umtriebigkeit, die ihn davor bewahrt aufzugeben und in Resignation zu fallen.
Bruno Wenk, Sozialarbeiter i.A.
Bilderausstellung zum Thema Armut
Armut ist ein Tabuthema und mit Scham verbunden. Wie spricht man eine betroffene Person an? Wie wird eine Situation geschildert? Antworten auf diese Fragen ergaben sich durch einen Fragebogen und in persönlichen Begegnungen, welche für alle Beteiligten eine Erfahrung von Respekt, Anerkennung und anregenden Gedanken war. Aus dem Bildmaterial und den Antworten zu den Fragen sind Bild-Text-Kompositionen entstanden. Die Betroffenheit und die Ernsthaftigkeit der Thematik hat sich im Unterricht spürbar gemacht, und es ist eine auf das Nötigste reduzierte Gestaltung entstanden. Eine Auswahl der Bilder finden Sie hier.
Von den Bildern gibt es eine Ausstellung, welche u.a. auch im Rahmen der schweizerischen Wanderausstellung „IM FALL“ zur öffentlichen Sozialhilfe im Frühling im St.Galler Waaghaus gezeigt wurde. Die Studierenden wählten mit den Kartonröhren zur Installation bewusst auch eine (Zitat) „Ärmliche Bauweise“, um von der Wirkung und Aussagen der Bilder zur Armut nicht abzulenken.
Die Ausstellung können Sie gerne ausleihen und für Ihren Anlass einsetzen. Sei es als anregender Blickfang oder für eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Thema.
30 doppelseitige Bilder an acht Kartonröhren – zum Zusammenbauen. Platzbedarf: 5 auf 3 Meter (grosszügig bemessen), Höhe 150 cm.
Kontakte
Sekretariat evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell
St. Gallen West, Burgstrasse 102, 9000 St. Gallen
Telefon 071 272 60 72 sekretariat@straubenzell.ch
Zurück nach Hause
Ein junger Mann, mit einem grossen Rucksack auf dem Rücken, steht vor der Türe und sagt, dass er kein Geld habe und zurück nach Hause will. Ich blicke in ein aufgewühltes und verängstigtes Gesicht, glaube ihm sofort und bitte ihn herein.
"Woher kommen Sie?"
"Aus Nürnberg. Mein Freund hat mich im Stich gelassen und ist abgehauen. Da er als Schwerstbehinderter eine Bahnkarte besitzt, die es erlaubt eine Begleitperson umsonst mitzuführen, bat er mich mit nach Zürich zu fahren. Ich fand das sei eine gute Idee, da ich noch nie in der Schweiz war. Ich wusste nicht mal, dass das Land nicht zur EU gehört. Wir übernachteten in Zürich unter dem Dach eines Schulhauses, und als ich erwachte, war mein Freund verschwunden. Ich wollte zurück nach Hause, erzählte am Bahnhof den Schaffnern von drei verschiedenen Zügen meine Geschichte und fragte, ob ich umsonst mitfahren kann. Der dritte Angefragte sagte okay und liess mich einsteigen. In St. Gallen fragte ich die Passanten, ob sie mir helfen können. Eine Frau gab mir 5 Franken. Eine andere Person sagte mir, ich solle zum Dom gehen. Dort schickte man mich zu Ihnen. Mir geht es gar nicht gut. Ich will wieder nach Hause."
"Wovon leben Sie in Nürnberg?"
"Ich bin momentan arbeitslos, lebe von der Sozialhilfe und wohne in einer betreuten Wohngemeinschaft."
Ich betrachte ihn und merke, dass er zuversichtlicher wirkt. Er zeigt mir seinen Schwerstbehinderten-Ausweis, der 2003 ausgestellt wurde. Ungläubig schaue ich ihn an und frage:"Ja, aber wo ist denn Ihre schwere Behinderung?"
"Die ist psychisch."
Noch immer ganz erstaunt denke ich darüber nach, wie es der Mann schaffen konnte, sich nach St. Gallen durchzuschlagen und wie ihm die Leute geholfen haben. Ich verspüre ein wenig Stolz und bin dankbar, dass es Menschen gibt, die bereit sind, spontan zu helfen.
Wir rechnen den Preis für die Heimfahrt aus, die ab Bregenz dank einer Tageskarte für ganz Bayern überraschend günstig ausfällt. Der junge Mann entspannt sich sichtlich, da er begreift, dass er heute mit unserer Hilfe wieder nach Hause kommen wird. Ich frage ihn, ob ihn noch etwas bedrückt, oder ob er uns was erzählen möchte. Er schüttelt den Kopf und meint nur: "Es ist mir eine Lehre, nicht einfach mit einem Kollegen mitzufahren. Das werde ich nicht mehr tun. Die Schweiz gefällt mir, nur die Menschen sind anders. Wenn ich hier leben würde, müsste ich mich zuerst an die Mentalität gewöhnen. Aufgefallen ist mir auch, dass die Strassenbeschilderung in Deutschland besser ist als hier."
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin
Vom Pfarrer zum Stricher
Grüezi! Sind Sie der Herr Pfarrer?
Nein?
Ja gut. Mein Name ist (…) und ich verkaufe Tücher und Servietten. Sie können sicher so was gebrauchen. Ich bin eben in Not und brauche Geld. Hier, sehen Sie! Zum Beispiel dieses fünffache Frotté-Set für – sagen wir – 45 Stutz mit Tuch, Waschlappen, Bodenleger …
Bitte? Sie haben gar keine Dusche im Büro?!
Aber dann können Sie dieses Set von Handtüchern gebrauchen! Sehen Sie, drei in einem Pack für 20 Franken.
Wieso nicht? Also bitte: Hände waschen müssen auch Sie!
Was? Nein! He! Es geht nicht um meine Situation! Ich brauche Geld, weil ich Rechnungen bezahlen muss! Ich wohne auch hier im Kreis Ost.
Wo? An der (…)-Strasse. Ich wurde vorhin von (…) hierher geschickt.
Oder sind Sie an Servietten interessiert? An diesen hier?
Nein, die sind aus Stoff und nicht aus Papier.
Also: Was ist jetzt?
Woher ich diese Ware habe? Ja – ich handle einfach damit. Ich lebe davon!
Wieso Hehlerei? Goht’s no?!
Nein? Sie wollen nichts kaufen? Auch nichts dafür geben?
Was „Sie haben kein Geld!“ ?? Sie haben doch wohl noch etwas Bargeld bei sich! Am Abend gibst Du es ja auch für die Weiber aus, oder?
Wie ich das meine? Hör mal! Was?
Ja, Du Dödel, warum sagst du das nicht gleich zu Beginn und lässt mich zuerst alles auspacken?
Damminoämolä!
Dann sag doch gleich, dass du nichts willst, du Arschloch! Und jetzt geh wieder zurück hinter deine verdammte Türe und schliesse sie schön hinter deinem blöden Gesicht ab! Du Pisser, Nuttensohn, Stricher!
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
Gallusplatz
Ich habe keine Handschuhe und: Wurde die Ambulanz informiert? Der Bewusstlose hatte schon eine gräuliche Gesichtsfarbe und schien kaum mehr zu atmen. Ich erschrak, da ich das Gefühl hatte, dass der Mann nächstens sterben würde. Glücklicherweise ertasteten meine Finger einen starken Puls am Handgelenk. Ich atmete erleichtert tief durch. Ich bewegte den Oberkörper des Mannes immer wieder, damit dieser einen zusätzlichen Impuls zum Atmen erhielt.
Etwa zwölf Minuten lang kniete ich neben dem Bewusstlosen und hatte das Gefühl, die Zeit bliebe stehen. Ich betrachtete die Umgebung: neben mir standen drei Männer, einer davon ein Hauswart. Auf den Bänken sassen einzelne Personen, die in ihren Lesestoff vertieft waren. Ein Radfahrer fuhr an uns vorbei und schaute kurz hin. Ansonsten schien sich kaum jemand für die Situation zu interessieren. Die Zeit stand für mich noch immer still. Wir warteten und warteten.
Plötzlich spürte ich den Puls am Handgelenk des Bewusstlosen nicht mehr und die Atmung hörte auf. Angst durchjagte mich. Eine Mund zu Mund-Beatmung bei diesem Blut im Mund? Gedanken um den Tod kreisten in meinem Kopf. Es schien, als ob sich der Mann verabschieden wollte. Ich wehrte mich innerlich dagegen und auf einmal bewegte sich der Brustkorb wieder und der Puls war wieder da. Erleichtert wartete ich weiter auf die Ambulanz aus Herisau, da alle anderen Wagen vom Kantonsspital unterwegs waren. Und endlich, nach 12-13 langen Minuten, erschien eine Notfallärztin mit Begleitung noch vor der Ambulanz. Ich liess den Mann am Handgelenk los und steckte meine Hände in das kalte Wasser des Brunnens. Ein Mann bot mir sein Stofftaschentuch zum Abtrocknen an und bedankte sich aufrichtig dafür, dass ich Hilfe geleistet habe. Erstaunt und erfreut nahm ich das Dankeschön an. Es tat mir gut zu wissen, dass doch noch jemand erkannt hat, was ich etwas geleistet habe.
Danach verliess ich den Platz und begab mich wieder hinauf ins Büro. Ich schaute kurz aus dem Fenster und ein eigenartiges Gefühl beschlich mich. Meinem Neffen zeigte ich kürzlich ein Kinderbüchlein mit einer belebten Strasse, auf der sich verschiedene Ereignisse wie Feuer, Unfall usw. gleichzeitig abspielen. Ähnlich das Bild jetzt, das ich vom Fenster aus sah: Auf der anderen Seite des Brunnens standen Autos, an deren Frontscheiben gewissenhafte Polizeibeamtinnen Bussen unter die Scheibenwischer klemmten. Eine Frau kam gerade dazu und diskutierte mit ihnen über die Busse. Und nur einige Meter daneben wurde der Bewusstlose medizinisch versorgt. Mir schien, dass der Kampf um das Leben des Menschen nicht relevant genug sei, um beachtet zu werden. Die Lesenden auf den Bänken jedenfalls steckten ihre Köpfe weiterhin in ihre Bücher. Ich löste mich vom Fenster und überlegte mir, ob der Mann wollte, dass er gerettet wird oder ob er lieber gestorben wäre.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin i.A.
Dem Volk nicht nah
Ich antwortete, ich könne ihr diese Dienstleistung nicht anbieten, lade sie aber gerne zu einem Gespräch ein.
Nein, sagte sie, um gleich den nächsten Wunsch anzufügen: „Helfen Sie mir Frauen zu mobilisieren, die sich für Menschen mit einer IV-Rente einsetzen.“ Auch dies übersteige meine Kompetenzen, gab ich zur Antwort. Wiederum bot ich ihr an, bei uns vorbeizukommen. Im dritten Anlauf sagte sie mir, dass die Kirche dem Volk nicht nah sei. Ich versuchte der Anruferin zu erklären, dass aus eben diesem Grund der Sozialdienst entstanden sei, wir aber für theologische Fragen nicht zuständig seien. Für diese könne sie sich beim Pfarrer melden.
Unbeirrt wiederholte die Frau alle drei Anliegen noch einige Male. Ich brachte viel Geduld auf, doch schien das Gespräch kein Ende zu nehmen. Schon fast entmutigt hörte ich dann, wie schön es sei, dass ich Verständnis für die Probleme der IV-BezügerInnen habe.
Irene Mlakar, Sozialarbeiterin i.A.
Lesung im Keller zur Rose
Anlass dieser Lesung war der Wunsch, www.ueberlebenskunst.org und die darauf publizierten Geschichten einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Einzeln und gemeinsam wurden Geschichten, Gedichte und Episoden vorgetragen, musikalisch stimmungsvoll umrahmt von Ruedi Brun an der Gitarre und Hampi Zbinden am Saxophon. Es war ein Abend, der zum Nachdenken anregte, aber auch bei vielen der Anwesenden immer wieder ein Schmunzeln auf das Gesicht zu zaubern vermochte.
Wenn es ans Herz geht
Die junge Frau steht etwas aufgeregt vor mir. Sie zwingt sich zur Ruhe. Lächelt. Beginnt zu erzählen. Umständlich zu Beginn. Immer mehr zuvorkommend und immer mehr wie eine Verkäuferin. Sie „verkauft“ mir eine Geschichte, die ihr – so ihre Aussage - zu Herzen gehe. Ihr Vater liege in einer grossen Stadt im Spital. Herzoperation! Sie selber wohne erst seit kurzem hier im Quartier bei ihrer Schwester. Die sei schon Hals über Kopf in das Spital gefahren. Den Geldbeutel habe sie gleich mitgenommen. Und jetzt stehe sie selber da ohne Geld und bräuchte … ob es jetzt gleich möglich wäre, dass … Sie nennt mir den exakten Preis für ein Zwei-Tage-Zugsbillet. Denn sie komme erst morgen wieder zurück … Sie nennt mir ihre Adresse. Nein – das Handy sei leider momentan abgeschaltet. Heute Nachmittag lade sie wieder Guthaben darauf. Sie lächelt immer noch höflich. Nennt mir als Alternative die Telefonnummern ihrer Eltern im Toggenburg.
Zum Billetpreis käme natürlich noch das Trambillet in jener Stadt dazu, meint sie weiterhin höflich lächelnd und positiv aufmunternd nickend. Ich sage ihr, dass ich das mit der Stadt abkläre. Sie fragt hastig nach, ob ich denn jetzt dort im Spital anrufe. Nein, nein. Ich würde ihr bloss im Internet nachschauen, welches Tram sie nehmen müsse. Ich bitte sie, draussen im lauschigen Garten Platz zu nehmen.
Im Internet checke ich nicht das Tram sondern diese Telefonnummer. Der Name stimmt so weit. Ich rufe an. Der Mann am anderen Ende entpuppt sich als ihr Onkel. Ich müsse seinen Bruder im gleichen Dorf anrufen. Dort nimmt dessen Frau, die Mutter ab.
Und ihr Herz läuft über. Es sei alles so schlimm. Ihre Tochter sei in den Drogen und jetzt in St.Gallen in der Bewährungshilfe. Ich soll ihr um Himmelswillen kein Geld geben. Sie gehöre in eine Klinik, damit das endlich aufhöre! Sie fleht mich förmlich an, mich dafür einzusetzen und erzählt ihre Leidensgeschichte mit der Tochter über alle Jahre: Polizei, um Geld angehen, Betrügereien, Gerichte, sich ihrer im Dorf schämen müssen und so weiter. Ihr Mann habe vor einigen Jahren eine Herzoperation gehabt. Aber er stehe jetzt neben ihr. Es gehe ihm zum Glück gut. Ich sei doch Pfarrer der katholischen Kirche, darum erzähle sie mir dies alles, damit ich – bitte nochmals – was unternehme. Und sie wohne nicht mit der Schwester zusammen. Die beiden hätten schon über Jahre hinweg keinen Kontakt mehr. Alle anderen Kinder von ihr seien gut herausgekommen. Sie sei auch Grossmutter. Goldige Enkel. Ihre Tochter habe auch ein Meiteli. Das alles gehe ihr so ans Herz!Ich gehe wieder nach draussen in den Garten. Ich weiss eigentlich nicht, was ich der jungen Frau sagen soll. Muss ich auch nicht. Der Garten ist leer. Die Frau verschwunden.
Zurück bleibt eine Herzensgeschichte und mir ein Satz der Mutter: „Wissen Sie, Eltern bleibt man ein Leben lang!“
Christoph Balmer-Waser, Sozialdienst Ost
In der Nachbarschaft - und doch einer anderen Welt
Vor Weihnachten meldet sich Frau L. verzweifelt wegen einer Zahnarztrechnung von Fr. 650.-. Diese übersteigt das enge Budget bei weitem. Mit Hilfe von Spendenfonds kann die Rechnung beglichen werden.
Frau L. ruft anfangs Januar an. Sie möchte mich gerne zu sich nach Hause einladen zum Essen oder einfach zum Tee. In ihrer Stimme liegt fast etwas Eindringliches. Ich bin etwas hin- und hergerissen. Einfach so einen Besuch machen, mich zum Tee einladen lassen? Eigentlich habe ich keine Zeit. Ich entscheide mich trotzdem, einen Termin auf nächste Woche, 13.30, zu vereinbaren. Die Familie wohnt in meiner Nachbarschaft.
Ich besuche die Familie L. nach dem Mittagessen – wie abgemacht zum Tee. Frau L. steht lachend an der Türe. Ein Sohn und zwei Töchter kommen herbeigerannt – eine herzliche Begrüssung.
Frau L. zeigt mit dem Finger in die Stube und sagt: „Sie sitzen hier. Wir essen“, und verschwindet sofort wieder in der Küche. Ich mache einen kurzen Versuch ihr beizubringen, dass ich bereits gegessen habe. Erfolglos. In meinem Kopf wirbeln Gedanken herum: oh je, wie mach’ ich das?
Die Stube ist sehr einfach, fast kärglich eingerichtet. Ein altes Sofa, eine Lampe, zwei Bilder, ein Fernsehapparat.
Nach einer Weile kommt Frau L. stolz mit einem Tablett voller Schüsseln: Kartoffeln und Rüebli, Pouletbrüstchen und selber gebackenes Brot. Dazu gibt es einen gemischten Salat mit einer üppigen Sauce.
Frau L. sagt, als ob sie ein Geheimnis preisgeben würde: „Alles zusammen in Ofen gebacken. Strom sparen!“
Als sie so freudig strahlend dasitzt mit all’ den Köstlichkeiten ist für mich klar, eine Portion esse ich. Sie hat wunderbar gekocht! Beim Salat mit der üppigen Sauce nickt sie mir ermutigend zu und sagt: „Salatsauce viel leicht.“
Frau L. möchte mir natürlich noch einen Dessert anbieten, aber ich kann nicht mehr. Dafür offeriert sie mir einen wunderbaren Schwarztee mit einem Stück Zitrone in einem fein geschwungenen orientalischen Glas.
An diesem Mittag bin ich in eine Welt eingetaucht, die mich tief berührt. Ich bin in der Schweiz, in St. Gallen, in meiner Nachbarstrasse und gleichzeitig irgendwo in Kroatien. Es ist eine Welt der bedrückenden Armut (materiell), der warmen Gastfreundschaft und des Reichtums des Herzens.
Brigitta Holenstein, kath. Sozialdienst Ost
Wechselbad der Gefühle
Manchmal bleibt Traurigkeit im Büro zurück, wie der lange, tiefe Ton eines Schiffhornes, das durch den Nebel klingt. Die Frau, die soeben mein Büro verlassen hat, ist HIV-positiv. Gejagt von innerer Unruhe will sie alles nachholen, was sie verpasst zu haben glaubt, jedoch klaffen immer wieder schwarze Löcher auf. Ihren Sohn sieht sie nur alle drei Wochen.
„Wenn er bei mir ist, bin ich gesund. Das Fieber kommt erst, wenn er gegangen ist“, sagt sie und weint. Für einen Augenblick findet sie Ruhe. Ich schaue ihr nach, schaue hinauf zum Himmel, wo sich grau-blaue Wolken ineinander schieben, in der Ferne fällt ein Lichtschleier zwischen den Wolken herab. Für sie, denke ich und weiss, dass ich mit diesem Gedanken die Hoffnung hege, etwas unfassbar Schönes, Grosses werde sie erwarten. Ohne diese Hoffnung hielte ich es nicht aus.
Manchmal bleibt ein Lachen im Büro zurück, gaukelt wie ein Schmetterling über Pult und Computertasten. Possenreisser sind wir doch alle, nur merken wir es nicht. Verbissen in unsere Rolle, bauen wir uns vor dem anderen auf und vergessen dabei das Lachen über uns selbst.
Manchmal bleibt Bitterkeit zurück: Ich hätte es wissen müssen, zu süss war seine Geschichte, und als er mir zum Dank für den Kredit eine Zeichnung seiner Tochter schenkte, schien mir die tiefere Bedeutung des Kredites, wieder Kontakt zu seinem Kind zu pflegen, bereits erfüllt, die Rückzahlung nur noch Formsache. Nach der ersten Rate blieben jedoch die Zahlungen aus, unter seiner Handy-Nummer erhielt ich die Nachricht, die Nummer sei nicht mehr gültig. Nachforschungen ergaben, dass an der Adresse, die er mir als seinen zukünftigen Wohnort angab, ein anderer Namen wohnte.
Manchmal bleibt Staunen zurück, Staunen über eine Begegnung, als hätte ich in einen Spiegel geschaut und mich selbst erkannt. Andere Lebensumstände zwar, andere Namen, Gegenden, aber dasselbe Ringen um tieferes Bewusstsein, dieselben Erfahrungen in Gebet und Meditation, dieselben Stolpersteine. Natürlich, jeder Klient spiegelt einen Teil von mir und oft ist es geheimnisvoll, nach gemeinsamen Spuren zu suchen. Aber jene Begegnungen, bei denen mir das gespiegelt wird, was mir besonders am Herzen liegt, sind Sternstunden.
Manchmal bleibt Angst zurück, Angst an Leib und Seele, weil der Schlag an den Türrahmen nachbebt, die Flüche durch die Bürotüre hindurch noch vibrieren und hinter meinem Rücken die Aktennotiz sich anschleicht: „Nach seiner Entlassung kaufte er sich eine Pistole. In seiner Wut hatte er den Arbeitgeber umbringen wollen.“ Die Angst nährt sich aus jenen Berichten in den Zeitungen, dass ein Mann eine Sozialarbeiterin im Sozialamt niederschoss. Als ich das Büro verlasse, habe ich das Gefühl, er lauere mir auf, springe mich aus dem WC oder einer dunklen Ecke an. Ich fühle mich auch zuhause bedroht. Es wäre für ihn ein Leichtes, meinen Wohnort herauszufinden. Noch Tage später besetzt Angst meine Seele. Ich fertige die Klienten kurz ab, meine Aufmerksamkeit ist in Beschlag genommen. Was habe ich getan? Nein gesagt. Es gebe nicht mehr Geld, als ihm von seinen Einkünften her zustehe. Zweimal Nein gesagt, dreimal nein gesagt. Da ist er ausgerastet.
Manchmal bleibt matte Müdigkeit zurück, jeden Kontakt empfinde ich wie eine Berührung überreizter Haut: Lasst mich in Ruhe! Was kümmern mich eure Bedürfnisse, eure Ängste und Nöte?! Ich habe nur einen Wunsch: Alleine durch die Stadt gehen, Blick gesenkt, niemanden grüssen, alleine am hintersten Tischchen eines Restaurants sitzen und zwei, drei Bier trinken.
Gestern schloss ich die Büroschubladen mit Akten und Kasse, stellte den Computer ab, löschte das Licht und blieb im Dunkeln stehen. Ich lauschte den Stimmen, die im Raum hängen geblieben waren, Gesichter erschienen aus dem Halbdunkel und erzählten mir ihre Geschichten und plötzlich tauchte die eine Geschichte hinter den Geschichten auf, plötzlich hörte ich die eine Stimme hinter den Stimmen, nein, keine Stimme, vielmehr ein Ton, ein tiefer tragender Ton.
Ich erhaschte einen Traumfetzen aus der Nacht: Ich stand an einem Abgrund, Nebelfetzen klebten in Felsschrunden, hingen an einzeln stehenden Föhren. Ich war dabei, das Wasser des Lebens aus der Tiefe zu schöpfen, zog an einer Schnur die Schöpfkelle herauf, sie war schon ganz nah, ich konnte das Wasser in der Kelle dampfen sehen, da erfasste mich Mitgefühl mit all jenen, die in den Abgrund gefallen waren oder sich hinabgestürzt hatten, und mich befiel ein Schwindel, der mich in die Tiefe zog.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
So weit, so offen
Ich wurde von einer Krankenschwester des Spitals angerufen, weil ein Mann der Gemeinde im Sterben lag. Er habe sonst niemanden.
Als ich das Zimmer betrat, sass der Pfarrer bei ihm am Bett. Ein schwaches Licht brannte auf dem Nachttisch. Nach dem Gebet erhob sich der Pfarrer und sagte: „ Dies ist jetzt ihr Stuhl.“ Der Sterbende lag regungslos da. Die anderen Männer im Zimmer schienen zu spüren, dass etwas Unfassbares, Grosses im Raum schwebte. Sie haben sich im Bett hin- und hergewälzt und wiederholt ihre Nachttischlampe betätigt, um Licht anzuzünden.
Dann ist er gestorben.
„Ich bestelle Ihnen ein Taxi“, meinte die Schwester.
„Nein“, antwortete ich, „ich gehe zu Fuss.“
Ich hätte es in diesem Moment nicht ertragen, in einem Auto zu sein, von der Umwelt abgetrennt. Über mir lag der Sternenhimmel. So weit, so offen. Ich war bis ins Innerste bewegt und fühlte nichts als Dankbarkeit für das unendlich Grosse über mir.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Zwischen Abschiebe- und Abschreckungslogik
Kennen Sie den alten Schweizer Film, in dem auf der Grenze zwischen zwei Berggemeinden ein verarmter Toter gefunden wurde? Er wird in der Nacht hin- und hergeschoben, damit die jeweilige Gemeinde die Kosten für die Beerdigung nicht übernehmen muss.
Es gibt eine durchaus eine moderne Variante für diese Komödie. Eine junge Frau mit einem Kleinkind möchte, nachdem die Beziehung zum Kindsvater in Brüche gegangen ist, wieder in die Nähe ihrer Mutter ziehen – auch um sich in der Betreuung des Kindes zu entlasten. Sie findet eine Wohnung, durchaus preiswert, aber es wird eine Mietkaution von drei Monatsmieten verlangt. Der Vermieter ist mit einer Teilzahlung und nachfolgendem Abstottern der Kaution nicht einverstanden. Finanzielle Sicherheit geht vor, besonders bei jemandem, der vom Sozialamt abhängig ist. Das Sozialamt des Wohnortes will sich nicht beteiligen, die Unterstützung könnte ja als „Abschiebeprämie“ verstanden werden. Das Sozialamt des Umzugsortes gibt unverhohlen zum Ausdruck, dass es allein schon der Politiker wegen einen Abschreckungskurs verfolgen müsse. Niemand fragt nach den Perspektiven dieser jungen Frau mit ihrem Kleinkind. Niemand lässt ab von institutionellen Zwängen und versucht, gemeinsam mit ihr und anderen Institutionen eine Lösung zu finden. Sie bleibt gefangen zwischen Abschiebe- und Abschreckungslogik.
Wer nun diese Geschichte so liest, ich wolle die junge Frau als Opfer darstellen, versteht mich falsch. Sie hat das ihre dazu beigetragen. Aber dies aufzuarbeiten wird durch solchen Umgang mit Menschen nur erschwert. Und mir wird aufgebürdet, an verschiedene Stiftungen Gesuche zu schreiben.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Vier Katzen als Begleiter
Das bekannte Januarloch klaffte auch bei Frau S., konnte jedoch mit Überbrückungshilfe in der Tat etwas gestopft werden. Die vier Katzen im Haushalt, lebendige Begleiter in einer schwierigen Lebenssituation, welche geprägt ist von Krankheit, psychischen Schwierigkeiten, Beziehungs- und Finanzproblemen, erhielten auch regelmässig Trockenfutter.
Und dann kam der Februar und das Geld der Sozialhilfe war noch nicht auf dem Konto ... Im Wissen um nicht wiederkehrende monatliche finanzielle Hilfe, kam von Frau S. erneut die Frage nach Bargeldleistung an den Sozialdienst. Und dann? Was ist zu bieten, obwohl das finanzielle Kontingent schon erschöpft ist? Ach ja, da gibt es noch einige letzte Caritas-Gutscheine aus der Weihnachtsaktion 07 im Angebot. Vielleicht können diese weiterhelfen. Leider nein, denn der Caritas-Laden hat wohl Katzenfutter, aber nur für Junior-Katzen. Leider hat die Katze von Frau S. bereits ein hohes Alter erreicht und ist in der Zwischenzeit zahnlos geworden. Oh je! Und nun die Problemlösung: Heute gegen Quittung Fr. 50.-- in bar für adäquates Katzenfutter. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt nichts was es nicht gibt. Die Klientin Frau S. hat mein Vertrauen und die Katze mein Erbarmen. Let it flow!
Gertrud Hermann, Sozialarbeiterin
Zwischen den Schmerzen
„Sie sind in Polen geboren“, sage ich und fahre fort, „mein Bruder hat kürzlich eine Radtour den masurischen Seen entlang gemacht. Er ist begeistert gewesen.“
Natürlich. In die Ressourcen kommen. Einen gemeinsamen „Raum“ schaffen. Wir.
Sie komme nicht von dort, sondern sei in der Nähe der russischen Grenze aufgewachsen. Ihre Mutter sei 1935 geboren. Sie sei noch ein kleines Kind gewesen, als ihre Familie zuerst von den Deutschen und dann von den Russen vertrieben worden seien. Ihr Grossvater habe in einer Fabrik gearbeitet, in der sie Bomben herstellten. An einem Morgen seien anstatt zwanzig Arbeiter nur drei gekommen. Die anderen seien niedergemacht worden.
Ihre Mutter habe früh geheiratet und fünf Kinder bekommen. Als das jüngste dreijährig war, verlor sie ihren Mann. Sie brachte die Kinder alleine durch. Sie habe viel gearbeitet, immer gearbeitet. Jetzt sei sie krank. Sie habe immer etwas, mal hier, mal dort.
„Wenn ich sie nächste Woche besuche, wird sie nur ganz kurz Freude haben. Ganz kurz nur zwischen den Schmerzen“, sagt sie.
Wir. Ein anderes Wir, als ich erschaffen wollte. Nicht aus dem Tourismus-Bereich, nicht aus der Schönheit von Landschaften. Sondern aus Mitgefühl.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Strassenreinigungskonform
Mitten in den vorweihnächtlichen Einkaufsrummel eine etwas andere Welt tragen. Eine besinnliche Welt. Eine Welt mit Geschichten, die zum Nachdenken und Mitfühlen anregen.
So stand ich vor einem Einkaufszentrum und verteilte Faltprospekte. Es dauerte nicht lange, da kam ein Mann in orangeleuchtender Weste auf mich zu. Es stellte sich heraus, dass er mit einem Strassenreinigungsfahrzeug die Plätze rundum das Einkaufszentrum säuberte.
„Was für Prospekte verteilen sie da?“, fuhr er mich an.
„Die kann meine Maschine nicht reinnehmen.“
Ich schaute ihn verdutzt an.
„Was glauben Sie denn? Die Leute nehmen den Prospekt mit und werfen ihn dann auf dem Parkplatz wieder weg. Ihre Faltprospekte bleiben zwischen den Drehbesen liegen.“
Ich schaute dem Mann nach, wie er zielgerichtet auf sein Gefährt zusteuerte. Das nächste Mal, dachte ich, bevor wir über irgendwelche Inhalte diskutieren, müssen wir darauf achten, dass der Prospekt strassenreinigungskonform ist.
Kaum hatte ich mich vom Schock erholt, trat eine Frau auf mich zu:
„Sie dürfen hier keine Prospekte verteilen! Ich habe meinen Verkaufsstand gleich hinter ihnen und teures Geld dafür bezahlt.“
Gertrud Hermann, Sozialarbeiterin
Der Orkan fegt noch immer über mich hinweg
Wie widerstehen, wenn jemand mit herzzerreissendem Weinen Druck macht? Wie, wenn sie von einem Leid stammelt, das sie keinem anderen Menschen auf der Welt wünsche, wenn sie von einer Tochter erzählt, die in ihrem Land keine Bluttransfusion erhalte. Bin ich als Sozialarbeiter nicht gerade auch für solche Ungerechtigkeiten sensibilisiert worden?
Wie ruhig bleiben, wenn sie gehässig oder gar aggressiv wird, sie sei nicht zum Spass hier, wenigstens vier Franken müsse ich ihr geben! Wohin wir denn kämen, wenn nicht einmal mehr die Kirche den Armen etwas gebe.
Ehrlich gesagt nagen noch immer Schuldgefühle an mir, auch wenn sie schon längst gegangen ist. Nützt wenig, dass ich mir vergegenwärtige, dass wir sie ja finanziell unterstützt und gleichzeitig auch klar gemacht haben, dass ihre Probleme tiefer lägen, dass regelmässige Beratung und wohl auch vorübergehend eine freiwillige Finanzverwaltung von Nöten sei. Dass wir ihr einen Termin angeboten haben, den sie nicht wahrgenommen hat. Der emotionale Orkan fegt immer noch über mich hinweg. Plötzlich merke ich, wie Wut aufsteigt – und dann Hilflosigkeit.
Ich versuche zu verstehen, sie aus dieser Hilflosigkeit heraus zu verstehen. Wie widerstehen und gleichzeitig verstehen?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Entschlüsseln
Mein Besuch bei den zwei alten Frauen hätte eigentlich eine kurzes angenehmes Unterfangen werden sollen, denn sie hatten zwei Steuererklärungen zu unterschreiben, die ähnlich waren wie letztes Jahr, nur dass ihr Vermögen um 3'000.- Franken angewachsen war. Und das, obwohl sie nicht einmal die ganze AHV-Rente erhielten. Nachdem ich an der Haustüre, wie vereinbart, zweimal geläutet hatte, mir ein Summton Einlass gewährte, drückte ich die Klingel neben der Wohnungstüre. Diese öffnete sich einen Spaltweit und als die alte Frau mich erkannte, wollte sie die Türe ganz öffnen, doch schlug diese metallisch klingend an. Mit einem Ruck versuchte sie, die Türe nochmals zu öffnen, die abermals anschlug, noch lauter, sodass es durch den ganzen Block hallte.
„Was ist?“, hörte ich ihre Schwester krächzen.
„Ich bringe die Türe nicht auf!“
„Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Sicherheitsschloss sein lassen!“
Jetzt versuchte sie die Türe aufzureissen, der Bolzen aber, der seitlich an der Türe befestigt war, glitt durch den Spalt eines metallenen Teils, das am Türrahmen befestigt war, und schlug an. Es vibrierte durch den ganzen Block, sodass ich sogar glaubte, die in den Beton eingelegten Eisenstangen zu hören.
„Was soll ich denn tun?!“, quiekte die kleine Frau, riss nochmals und nochmals an der Türe.
„Ganz ruhig“, sagte ich und glaubte, einen schlauen Plan zu besitzen. Es müsste doch irgendwie gelingen, den Bolzen aus dem Spalt zu drücken. Ich bat sie, die Türe nur einen klitzekleinen Spalt offen zu lassen, damit ich von der Seite das metallene Teil herausdrücken könne. Es gelang einmal, zweimal, dreimal, viermal nicht.
„Jetzt kommen wir nicht mehr aus der Wohnung“, krächzte die Schwester aus ihrem Zimmer.
„Was soll ich den tun?“ brüllte die andere zurück.
„Der Polizei anrufen.“
„Warten Sie, warten Sie ...“, bat ich, ohne eine Idee zu haben.
„Telefoniere der Hauswartin!“
„Ist sie hier im Haus?“, fragte ich.
„Gleich im oberen Stock.“
„Ich bin gleich zurück.“
Ich stieg die Treppe hoch, hörte die Türe immer heftiger gegen das metallene Teil schlagen, hörte die beiden immer lauter keifen. Mich überraschte, dass niemand im Block nachschauen wollte, was los war. Die Hauswartin war nicht da.
Ich rannte die Treppe hinunter und versuchte, die kleine Frau hinter der Türe zu beruhigen.
„Du verstehst nichts, nie verstehst du etwas!“, schrie die Schwester aus ihrem Zimmer.
Wenn ich verstünde, wie das Schloss funktionierte! Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Türe von innen aussieht, jedoch kein klares Bild wollte sich einstellen. Wahrscheinlich war ich jeweils so sehr damit beschäftigt, die stickige Wohnung zu verlassen, dass ich das Sicherheitsschloss nicht achtete. Es blieb mir nichts anderes übrig, als bei den Nachbarn zu fragen. Auf demselben Stock niemand. Auf dem nächsten Stock niemand. Einen Stock höher dann hörte ich Schritte hinter der Türe. Ein Mann öffnete einen Spaltweit und ich, begierig zu sehen, wie das Sicherheitsschloss funktionierte, näherte mich ihm zu schnell, bemerkte es, erklärte, ich wolle nur wissen, wie das Sicherheitsschloss funktioniere, und sah plötzlich nackte Angst in seinen Augen.
Ich wich zurück und versuchte zu beschwichtigen:„Wissen Sie, ich bin Sozialarbeiter und betreue zwei alte Frauen, die im selben Block wohnen und die Türe nicht mehr aufbringen.“
Durch den Türspalt erklärte er mir, wie ich das Sicherheitsschloss öffnen könne.
Ich stieg die Treppe hinab und erklärte der alten Frau hinter der Türe, auf deren linken Brillenglas das Licht des Ganges spiegelte, sodass ich ihr Auge nicht sehen konnte, links oben befinde sich ein Drehknopf, den sie nach rechts drehen müsse – aber erst nachdem sie die Türe geschlossen habe. Zwei-, dreimal probierten wir, dann gelang es, die Türe öffnete sich und ich fühlte mich wie Ali Baba, der sich durch ein Zauberwort den Zugang zu einem überwältigenden Schatz verschafft hat.
„Das haben Sie gut gemacht“, sagte ich.
Sie strahlte wie ein Mädchen, das vom Lehrer dafür gelobt wird, dass es ein Gedicht völlig korrekt bis zur letzten Zeile aufgesagt hat.
„Aber morgen hast du es wieder vergessen“, krächzte ihre Schwester aus dem Zimmer.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Ich möchte Klavier spielen lernen
Gestern kam eine Frau in die Beratung, um den Fragebogen mit mir auszufüllen. Sie ist mit dreiundzwanzig Jahren in die Schweiz gekommen und arbeitet seit Jahrzehnten als Fabrikarbeiterin. Ihre Träume, einen Mann zu finden, haben sich zerschlagen. Sie lebt allein, besucht alle drei bis vier Jahre ihre Verwandten im Heimatland.Der Fragebogen, erzählt sie, habe ihr den Kindertraum bewusst gemacht: Sie habe immer schon Klavier oder Akkordeon spielen wollen. Aber die Eltern seien sehr arm gewesen, mit vierzehn Jahren habe sie arbeiten müssen. Jetzt habe sie genügend Geld, um sich Klavier- oder Akkordeonunterricht zu leisten. Ob ich ihr helfen könne, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu finden?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Goldadern im sozialen Gefüge
Wie ist die Geschichte entstanden? – Zu jener Zeit, als ich die Geschwister besuchte, las ich meinem Sohn eine Geschichte über die Goldgräber am Yukon vor. Plötzlich schien mir „nach Goldadern graben“ eine treffende Metapher zu sein für das, was ich bei meiner Arbeit tue. Und ich versuchte, die Hartnäckigkeit und Geduld jener Goldgräber auf meine Arbeit zu übertragen.
Sozialarbeiterinnen als Goldgräber?
Manchmal scheint mir, es fehle mir an Geduld, um wie die Goldgräber ein Claim abzustecken, einen Stollen zu graben und das Gestein sorgfältig zu sieben bis endlich einmal – wenn überhaupt – einige Goldnuggets im Wasser glitzern.
Nach vielen Besuchen bei zwei älteren Geschwistern, die beide das achtzigste Lebensjahr überschritten haben, nach vielen Gesprächen, die sich um Krankenkassenselbstbehalte, Umgang mit der Postomat-Karte, Steuererklärungen, Wäscheplan und ähnliches drehten, erzählten sie mir, sie hätten beide einmal Akkordeon gespielt.
Streng sei der Lehrer gewesen, aber sie hätten viel gelernt.
„Wunderschön ist es, wenn Akkordeons zusammenklingen!“
Zum ersten Mal erlebte ich die beiden Schwestern entspannt, auch zueinander, zum ersten Mal sah ich ein Leuchten in ihren Augen.
„Aber jetzt können wir beide nicht mehr spielen.“
Ob sie wieder einmal Akkordeonmusik hören wollten, fragte ich sie.
„Ja, das wäre schön. Am liebsten etwas Klassisches.“
Des Goldgräbers Hoffnung, der Claim, war abgesteckt. Im Verlauf der Woche ging ich in ein Musikgeschäft und grub – weil die beiden Schwestern nur einen Kassettenrekorder besassen – nach einer Kassette mit klassischer Akkordeonmusik, fand aber keine, nur eine CD. Ich kaufte sie trotzdem, schliesslich bin ich als Goldgräber gut ausgerüstet, sprich: ich habe Zugang zu einem alten CD-Gerät, das ich tags darauf zu den beiden schleppte.
Voll freudiger Erwartung schob ich die CD ins Gerät, drückte play und sah innerlich bereits, wie die Goldnuggets im Sieb sich verfingen, wie ihre Augen aufleuchteten, wie rhythmisch wellende Bewegungen ihre Körper erfassten. Stattdessen hockten sie bocksteif da, auch nach zwei Minuten noch, und die ältere Schwester schaute stets auf die jüngere.
„Sie hört nichts“, krächzte sie laut.
„Ich höre nichts“, sagte die Jüngere und schüttelte den Kopf.
„Wissen Sie, wenn sie nichts hört, dann kann ich auch nicht zuhören.“
Ich stellte das Musikgerät ab. Vielleicht lag der Claim am richtigen Ort, aber die Goldader tiefer im Berg. Es wird wieder viele Gespräche benötigen, um die jüngere Schwester dazu zu bewegen, zur Hörmittelzentrale zu gehen – wenn sie sich überhaupt überzeugen lässt. Jedoch weshalb sollte ein sozialer Goldschürfer früher aufgeben als die Goldgräber von dazumal?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter