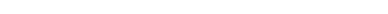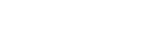Kinder in Rio de Janeiro
An Weihnachten in der Kaffeestube erzählte die ältere Frau, die mit fünf Jahren an der Kinderlähmung erkrankte, wie sie trotz ihrer Einschränkungen zu einem Leben gefunden hat, das sie erfüllt.
Sie betrat in Spezialschuhen und an Stöcken den Raum. Mit fünf Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Aber jetzt, erzählte sie, habe sie die goldene Linie überschritten, sie müsse nicht mehr arbeiten. „Sie strahlen so“, sagte ich. „Ach, das bin nicht ich, ich bin nur der Spiegel.“ Sie erzählte von ihrer Jugend, wie sie gerne Kindergärtnerin geworden wäre, aber mit den Kindern müsse man rumrennen können, und deshalb sei sie Sekretärin geworden. In London habe sie Englisch gelernt, morgens die Schule besucht, den Nachmittag geschwänzt, sich in den St.James Park gelegt und in den Himmel geschaut. In der Zeitung ein Bild gesehen von Kindern in den Slums von Rio de Janeiro. Das Bild habe sie nicht mehr losgelassen und sie habe ein Projekt aufgebaut. Sie habe kleine Schäfchen genäht, über tausend Stück, und sie für neun Franken verkauft. „Das ist – rechnen Sie selber aus – und das Geld habe ich den Schwestern in Rio de Janeiro geschickt. Als ich den Faden nicht mehr sah, begann ich Babyfinken zu stricken, mit einem speziellen Gerät. Jetzt habe ich schon über dreissig gestrickt und verkaufe sie für fünfzehn Franken das Pärchen – rechnen Sie selber aus.“ Sie hielt einen Augenblick inne, schaute mich strahlend an und sagte: „In Rio de Janeiro sind meine Kinder, verstehen Sie?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Eine tröstende Bekanntschaft am Grab
Sie haben sich beim Grab kennengelernt.
„Mein Mann liegt in der gleichen Reihe wie seine Frau.“
Jetzt geht sie jeden Mittag zu ihm nach Hause. Sie kochen gemeinsam, machen den Abwasch und danach geht jeder wieder seinen Weg.
Sich zu helfen wissen. Sich zusammentun.
Und doch: „Jeden Tag fehlt mir mein Mann.“
18. September 2012
Luamar Zwahlen, Sozialarbeiterin i.A.
Bei Kaffee und Kuchen
Am Seniorennachmittag komme ich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Torte mit einer älteren Dame ins Gespräch.
„Jeden Tag, wenn ich auf die Strasse gehe, werde ich angesprochen: Sie sind doch die Frau von der Drogerie“.
Und nicht ohne Stolz fügt sie hinzu:
„Mein Mann und ich waren ein super Team!“
Ein Schatten verdunkelt ihr Gesicht.
„ Jeden Tag fehlt er mir.“
Ihre Augen werden feucht:
„Jetzt sind schon 27 Jahre vergangen seit seinem Tod.“
18. September 2012
Luamar Zwahlen, Sozialarbeiterin i.A.
Vor dem Traualtar
Sie schildert, wie sie, als sie den Gang zum Altar in Begleitung ihres Vaters beschritten ist und dann vor ihrem zukünftigen Ehemann stand, am liebsten Nein gesagt hätte.
„Ich sah einen Film vor mir ablaufen.“
Sie sucht meine Augen. „Heute machen es ja die Frauen so und lassen die Männer manchmal am Altar stehen. Doch früher hat man sich das einfach nicht getraut.“
„Darf ich sie etwas fragen? Was ist das für ein Film gewesen, den sie in diesem Moment gesehen haben?“
Sie erklärt mir, dass sie die Zukunft an der Seite dieses Mannes vor sich sah.
„Ich wusste es kommt nicht gut - und so war es auch wirklich.“
St. Gallen, 17. September 2012
Luamar Zwahlen, Sozialarbeiterin i.A.
Begegnung
Wir treten in das Zimmer ein.
Ich sehe mich einer älteren Frau gegenüber, die mir lächelnd ihre Hand entgegenhält.
Ihre klaren blauen Augen fallen auf. Ihre wache Art.
Überall hängen Bilder und Zeichnungen. Die einen selbstgemalt, andere Geschenke von ihren Enkeln. Dazu kommen Fotos von ihrer Familie. Umgeben von ihren Lieben.
Diese Frau wirkt sehr interessiert: Sie weiss wer sie wählen wird, weiss wer in der Familie gerade wo im Alltag steht, weiss dass man die Paralympics häufiger und zu besseren Zeiten übertragen sollte, und sie weiss auch um ihre Schätze der Vergangenheit und ist bereit diese zu teilen.
Ab und zu schweift mein Blick zum Wasserbad auf ihrem Balkon, in dem sich die Spatzen vergnügen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Frieden regiert.
Obwohl die Frau im Rollstuhl ist. Obwohl sie nicht mehr zeichnen kann und obwohl sie jetzt vor dem 47. Hochzeitstag feststellen muss, dass nur noch 10 Hochzeitsgäste von damals am Leben sind.
Trotzdem.
24.9.12
Luamar Zwahlen, Sozialarbeiterin i.A.
Probehalber
„Hallo“, rief der alte Mann, an dem ich gerade vorbeigehen wollte.
„Ach, guten Morgen. Sie sind hier?“
„Nur mal probehalber. Seit zwei Wochen.“
„Und, wie geht es ihnen.“
„Ganz gut. Nur hier drinnen ist etwas nicht gut. Ein Tumor. Bösartig.“
Er schaut sich im Speisesaal des Altersheims um, als ob ihn etwas verfolgte.
„Heute Nachmittag habe ich eine Besprechung mit dem Arzt und der Tochter. Da schaut man, was man noch machen kann.“
Ich schaue ihn lange an, hilflos, schweigend, Worte wären nur billiges Übertünchen, und setze mich ihm gegenüber. Mit der Rückseite des Löffels spitzelt er Konfitüre aus dem Aluminiumbehälter. Vom Pflegepersonal kommt eine Frau und fragt mich, ob ich einen Kaffee wolle.
Einmal waren wir zusammen in den Seniorenferien, an einem Abend die letzten an der Bar, die dem Barpianisten zuhörten. Nach jedem Stück klatschten.
Abgeklatscht. So sitze ich da. Ich sehe ihn wie durch hauchdünnes, wolkiges Papier. Kritzle meine Erinnerungen darauf bis sie durchscheinend werden, mir entgleiten wie die Buchstaben meines eigenen Lebens.
Eine Frau geht gebückt am Rollator an uns vorbei.
„Morgen weiss ich mehr“, sagte der alte Mann, „kommen Sie morgen wieder?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Ich will sterben
Ich will sterben
wiederholte die alte Frau immer wieder, wenn ich morgens zu ihr ins Zimmer kam. Sie sperrte sich gegen jeden Versuch, ihr aus dem Bett zu helfen, machte sich steif wie ein Brett. Einmal liess sie sich sogar auf den Boden fallen und blieb liegen.
Ich will sterben, ich will sterben.
Sterben ist nicht so leicht, antwortete ich.
Ich will sterben, ich will sterben.
Da fasste ich Mut und sagte zu ihr: Gut, dann sterben Sie.
Ich legte ihre Hände auf dem Bauch übereinander: Machen Sie die Augen zu und gute Himmelfahrt.
Ich verliess das Zimmer und wartete vor der Türe. Die Stationsleiterin hätte kommen können oder ihre Angehörigen: Warum lassen Sie eine alte Frau einfach am Boden liegen? Es waren bange Minuten für mich.
Nach 10 Minuten ging ich wieder ins Zimmer. Und? Hat es geklappt?
Nein, antwortete sie in weinerlichem Ton, es goht nöd!
Ich habe Ihnen gesagt, sterben sei nicht so einfach. Ja, sagte sie und war von da an viel weicher und umgänglicher geworden.
Jacinta Stieger
Entstehen und vergehen
Da es mir nun besser geht, laufe ich wieder mit dem Stock, den ich ja auch immer brauchen kann. Es ist jetzt alles in Ordnung, nur mein linkes Bein muss jetzt auch wieder recht kommen. Aber ich kann doch wieder fortgehen. Am Sonntag bin ich in Schaffhausen gewesen. Eine schöne Rundfahrt, bin dann über Andelfingen und Winterthur nach St. Gallen gefahren, beim schönsten Sonnenschein. Ja, so gehen die Monate rasch zu Ende. Am Freitag ist ja schon wieder der erste Juli und dann kommt wieder Olma und wieder Weihnachten. Ich hatte noch viele Reisen vor, mal da und dorthin. In Gottes schöne Natur hinaus, ja, nun kann ich ja so vieles unternehmen. An Weihnachten und Neujahr bin ich ja wieder in Lungern. Ja, so möchte ich gerne mal wieder ins schöne Tirol, aber in meinem Leben wird es das niemals mehr geben. Aber Reisen tue ich ja gerne. Wo ich noch jung und schön war, ging ich 30 Jahre lang immer ins schöne Zillertal. Aber gesundheitlich geht es mir ja gut. Aber wenn ich jede Woche ins Marthaheim essen gehe, man muss vorzu schauen, was alles gehen und kommen wird, Gruss Peter Ja, jetzt geht’s mir wieder gut. Vor Ostern musste ich in den Notfall, da ich ja gar nicht mehr laufen konnte und Schmerzen hatte. Bin froh wieder mit dem Stock. Einen Monat ging ich mit dem Rollator. Ja, man wird älter und muss die Bürde tragen. Am 13. Juli muss ich ins Spital zur Augenoperation. Aber alles kommt und vergeht ja wieder.
Am 9.7.14h30, vier Tage nach Übergabe dieses Textes, ist er verstorben.
Eine Wohnung im Himmel
Die Alte hat zum Sterben ihre Brille auf einen Schemel gelegt, gerade neben dem Bett. Das Sonnenlicht fällt schräg über den Wald, in dem sie oft spazieren gegangen ist, über die Bank am Waldrand, auf der sie oft gesessen ist und Gedichte geschrieben hat, über den Skilift, der jetzt im Herbst ausser Betrieb ist, über die Schiessanlage, die meistens nur samstags benutzt wird, und auf den Schemel, wo es die langen Schatten der Brillenbügel nachzeichnet und die Gläser leuchten lässt, als beobachteten sie das Sterben der Alten.
„Aha, Herr B.“, sagt sie und döst weiter. Sie hat sich abgedeckt, weil die Sonne direkt auf ihr Bett scheint. Bei Knie und Fussgelenk ziehen sich blaue Äderchen durch käsig-weisse Haut. Sie zieht den Rotz hoch, wie sie das früher oft getan hat, ohne die Augen zu öffnen. An der Wand hängt eine Fotografie von ihr mit einem Pferd vor dem Bauernhof, in dem sie aufgewachsen ist. Wie gemeisselt steht sie da, ein Bild für die Ewigkeit. Wie alt war sie damals, dreizehn, fünfzehn? Auf der rechten Seite ein Bild mit einer weissen Bergkette, an deren Fuss ein Fluss fliesst. Auf der linken Seite ihre Eltern.
Sie wollte nicht, dass ihre Tochter sie besuche.
Auf dem Schreibtisch liegt die Zeitung mit der Fotografie eines Herbstwaldes, von einer Leserin geknipst. Ich weiss es, weil ich die Zeitung heute Morgen bei einer Tasse Tee gelesen habe. Von hier aus könnte man ein ähnliches Bild schiessen, aber hier gibt es nichts mehr, was für die Zeitung interessant ist, hier läuft die Zeit aus.
Die Rauchfahne am Kamin gegenüber duckt sich im Wind, ihr Schatten wabert über den Hausgiebel nebenan. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich werde für sie die Formalitäten erledigen müssen.
Aber wie ich auf dem Fahrrad sitze und die feuchten Ränder um die plattgedrückten Herbstblätter glitzern sehe, erfasst mich plötzlich Freude und Trauer zugleich, ich möchte weiter radeln, immer weiter radeln und ihre Fahne durchs Land tragen auf der geschrieben steht: Ich habe für Arbeiter und alte Menschen eine Pension geführt und – der Vater im Himmel hält eine Wohnung bereit für mich.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Königin Astrid
Königin Astrid
Ihre Hoheit, die Königin Astrid
sorgt nachts für meine Wenigkeit
und bringt mir trotz meines Leidens immer wieder Heiterkeit.
Sie hat Witz, Humor und ihr heiteres Wesen
trägt dazu bei, dass Patienten besser genesen.
Schwester Astrid sollte man in grosser Anzahl klonen
ich glaube, für jede Klinik würde sich das lohnen!
Heute beginnt die Fastnachtszeit
Mensch, was für Erinnerungen an meine Kindheit.
Jedes Jahr beim Umzug durch die Strassen der Stadt dabei,
Verkleidungen fantasievoll, selbstangefertigt mancherlei
Schwester Astrid würde auch gut zu einer Maskerade passen
ihre Lieblingstätigkeit ist nämlich spassen.
Im Speisesaal bringen ihre lustigen Witze uns immer wieder zum lachen
das Gelächter darüber lässt uns manchmal beinahe platzen.
Auch die vergessene Pointe am Schluss kann unsere Freude an ihr nicht verpatzen.
Wisst ihr, was ich am Liebsten täte
sofern ich das nötige Geld dazu hätte?
Ich nähme Astrid mit auf eine ferne kleine Insel im Meer
und zurückkommen würde ich nimmermehr.
Ich sehne mich dermassen nach dem geliebten Meeresstrand
mit den Füssen würden wir waten, halb im Wasser, halb im Sand
Schwester Astrid würde mich hegen und pflegen bis zu meinem verdienten Ende
und mich streicheln und halten meine kranken Hände.
Das ist es, was mir seit vielen Jahren fehlt und zu Tränen rührt
weil keine liebende Hand meine kranke Haut höchst selten berührt.
Ich weiss schon lange nicht mehr, was Liebe ist
und dieses Gefühl wird von mir ganz schrecklich vermisst.
Auch meine Seele ist krank und traurig
und ich finde es einfach schaurig.
Meine vier Geschwister, seit ich zurück bin aus Spanien, ignorieren mich
und lassen mich als älteste Schwester einfach im Stich.
Seit zehn Jahren im Heim und nie ein Besuch
kein Kontakt, weder schriftlich noch telefonisch, kein Versuch!
Ich frage mich immer wieder warum? Warum denn nur
und verfolge unser Leben und finde keine Spur.
Ich bin mir keiner Schuld bewusst und ihre Absenz ist für mich ein grosser Frust
an zerbrochenem Herzen kann man auch zugrunde gehn
doch letztlich bleibt die Hoffnung bestehn.
Ich bete viel und bitte um Kraft und Mut
und hoffe einfach, einmal kommt es wieder gut.
11. November 2008, 19h40
Wenn die in Lybien so saublöd tun, gehe ich halt zu Bruder Klaus
„Ich wachte gestern Morgen mit dem Wunsch auf, Bruder Klaus zu besuchen. Das ist ein wunderbarer Heiliger, den wir in der Schweiz fast vergessen haben. Ja gell, die Heiligen im eigenen Land … ! Dabei hat er uns schon so oft geholfen!
Ich habe mir gesagt, wenn die in Libyen so saublöd tun, gehe ich halt zu Bruder Klaus. Es muss doch etwas getan werden jetzt - und beten hilft immer.
Vor meiner Abreise machte ich noch „Kassensturz“ und entschied mich, diese und nächste Woche auf meine Handorgel-Stunden zu verzichten. Die Kosten für die Bahnfahrt würden sonst mein Budget „sprengen“, da ich vor drei Wochen bereits einen Ausflug nach Bern gemacht habe.
Ich bin dann mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn nach Luzern und von dort nach Sachseln gefahren. Ich liebe diese Strecke. In der Pfarrkirche in Sachseln – wo Bruder Klaus begraben liegt - betete ich den Rosenkranz. Dann ging ich ins Flüeli Ranft, um dort weiterzubeten. Ein wunderbarer Ort!
Auf dem Nachhause-Weg wurde ich total „verschifft“. Ich hatte keinen Regenschutz dabei. Das war mir alles egal, denn in mir war es schön ruhig geworden!“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Eine Stimme aus dem Altersheim (1)
Vorbemerkung
Dieses «Aphorismen-Puzzle» ist natürlich «nur» ein bitteres Dokument einer Depression. Als solches kann man es mit einer Handbewegung und Nebenbemerkung zur Seite legen. Es ist subjektiv und damit relativ. Vor allem kann man (wie bei einem «Puzzle» die Einzelteile für sich genommen unwichtig sind) die einzelnen Aussagen leicht kritisch widerlegen und also relativieren. Aber mit diesen Überlegungen hat sich ein Bewohner im Altersheim von seiner Depression im Vorgang einer Selbstheilung zu distanzieren vermocht, um seine Identität zu bewahren.
Jede Äusserung einer Depression enthält Überzeichnungen. Ihr könnten Stellungnahmen von Heimleitung, Mitarbeitern oder «zufriedenen » Pensionären unschwer zur Seite gestellt werden. Depression ist nicht einfach eine Gefühlsverstimmung, sondern eine Erkrankung. Wer sie verstehen, wer hier helfen will, muss bedenken, dass sie nicht selten eine gesellschaftliche Erkrankung im Milieu spiegelt.
Darum möchten diese Blätter gerade als Stimme einer Depression von Leitern und Mitarbeitern in Altersheimen erst einmal in aller Stille bedacht werden zur Selbstprüfung und Selbsthinterfragung. Man möge erst einmal das Gesamt-«Bild» des Puzzle auf sich wirken lassen. Jedes Heim lobt sich selbst und will gelobt sein. Es geschieht ja fraglos viel Gutes und Liebevolles im einzelnen. Hier aber, im «Puzzle-Bild» soll auch einmal etwas von der Schattenseite eines Lebens im Altersheim wahrgenommen werden. Denn auch das ist im wahren Sinne des Wortes «not-wendig». «Auch Pathologisches sagt Wahrheit»
(Thomas Mann).
Es ist nicht gestattet, einzelne Sätze dieser Blätter aus dem Gesamtzusammenhang genommen zu zitieren und weiter zu verbreiten. Gegen eine Weitergabe des gesamten Textes mit dem Ziel ernsthaften Bedenkens der Thematik bestehen keine Einwendungen.
***
Das Altersheim als «neues Daheim» ist ein Mythos. Er muss entmythologisiert werden: Es ist eine Institution als Schicksalskollektiv, bunt zusammengewürfelt, aber keine existentiell wahre Gemeinschaft. Gemeinschaft heisst: Leben miteinander statt nebeneinander, Nähe zueinander, Verantwortung füreinander, persönliche Offenheit, Austausch, vertrauendes Gespräch. Davon kann weder zwischen Pensionären noch zwischen Personal und Pensionären wirklich die Rede sein.
***
Das Altersheim kann nur technische Assistenz bei Hilfsbedürftigkeit und darüber hinaus Unterhaltung gewähren. Diese reichlich. Doch das Entscheidende, Bergende, seelisch Helfende kann hier kaum geschehen: Angenommensein, Verstandensein. Im Altersheim wird faktisch nur Zeit zugebracht und irgendwie ausgefüllt oder eben leer gelassen. Daher lässt einen das Zusammensein im Heim letztlich leer, auch wenn alle Dienste freundlich garniert sind.
Fortsetzung folgt
Eine Stimme aus dem Altersheim (2)
Zum grossen Teil leben wir im Heim von den Almosen eines mit freundlichem «Wie geht’s?» vorbeieilenden Personals: zwischen Tür und Angel.
***
Einem, der seelisch am Ersticken ist, hilft die Frage «Wie geht’s?» nicht. Einem Erstickenden muss man Sauerstoff geben. Dieser wäre Austausch, Nähe, vertrauendes Gespräch. Das gibt es hier nicht.
***
Das «Heim» und die «Heimat» (wo man in Liebe vertraut ist), – das sind nicht zufällig, sondern höchst bedeutsam zwei verschiedene Artikel: «Das» ist neutral. «Die» ist persönlich. «Das» ist austauschbar, technisch organisierbar. «Die» ist unersetzlich.
***
Der Eintritt ins Altersheim ist Entwurzelung. Denn das Heim ist eine unvermeidliche Einübung ins Sterben. Die Heimat wäre Raum fruchtbaren Lebens. Das leise Sterben im Altersheim beginnt mit der Verarmung wirklichen Gesprächs, beginnt mit der gesprächslosen Vereinsamung.
***
«Gut geschlafen?» fragt vorbeieilendes Personal. «Ich habe schlecht gewacht » müsste ich antworten. Ich sage es wohlweislich nicht. Es würde kaum wirklich gehört. Im besten Fall käme ein Hinweis auf Schlaftabletten oder ein freundliches Schulterklopfen.
Eine Stimme aus dem Altersheim (3)
Nun bin ich gut sieben Jahre in einem grossen, renommierten Altersheim. Es ist (wie die Verwaltungssprache sagt) wirklich «professionell geführt». Alles intakt nach Richtlinien. Immer auch geschieht irgend Unterhaltsames für die Pensionäre. – Für mich gab es im Altwerden keine andere Lösung als diese: das Heim. Nun erlebe ich, dass der hier seelisch unausweichlichen Verkümmerung auch der physische Verfall folgen wird. Der Prozess ist unumkehrbar.
***
Ich bin technisch versorgt. Das ist aber auch alles. Der Geist sucht Lebendiges. Manchmal noch gehe ich aus, umgeben von gesundem, wirklichem Leben. Aber die Kräfte nehmen ab, und im Alter schliesst man keine neue Freundschaften. Alte Freunde sterben fort oder sind, soweit noch am Leben, weit weg. Der Lebenskreis ist ganz klein geworden.
***
Hier im Heim gilt nun: Kein Mensch kann dem anderen helfen, wenn er sich selbst verschliesst und verbirgt: sowohl der Helfenwollende wie der Hilfsbedürftige. Daher also im Heim so viel Nebeneinander statt Miteinander, Floskeln statt Gespräch, Tangenten statt Begegnung, Gelegentliches statt Tragendes, Beobachtung statt liebendes Wahrnehmen, Höfliches statt Verbindliches, Versorgung statt Beheimatung. Man darf hier das Entscheidende nicht erwarten: nämlich dass wirkliche Hilfe nur in der Offenheit von Mensch zu Mensch geschieht.
***
Natürlich bräuchte mein Arzt, wenn er das liest, keine zwei Minuten für die Diagnose «Vereinsamungssyndrom», «Altersdepression». Ein aus der breiten Palette (konkurrierender Firmen) gezogenes Pharmakon würde genügen,
um mich auch noch um die kleinen guten Lesestunden zu bringen, die ich in meiner stillen Stube noch habe: um mich (wie manchen mit Psychopharmaka Behandelten um mich herum) zum beruhigten Automaten zu machen, der emotionell ruhiggestellt ist, daher im Tagesablauf unauffällig funktioniert, problemlos und zufriedengestellt eingegliedert in die Routine täglicher Abläufe. Ich will das aber nicht. Wenn ich schon seelisch verkümmern soll, dann will ich es wach.
***
Manche der Mahlzeiten im grossen Speisesaal bedrücken wie kollektiver Stumpfsinn. Natürlich ist der Tisch liebevoll geschmückt. Und wir werden freundlich und aufmerksam bedient. Mehr kann nicht sein. Sechs Jahre lang habe ich versucht, durch persönliche Anregung, Literarisches, Lesefrüchte, Anekdotisches, Aktuelles so etwas wie ein minimales Tischgespräch zu bewirken. Völlige Fehlanzeige. Ich habe es aufgegeben. Nie, kein einziges Mal, auch nicht bei festlichen Anlässen, habe ich ein Tischgespräch erlebt. So, wie das grosse Altersheim heute ist, ist es eine Melange von Spital, Kindergarten und Psychiatrie.
Eine Stimme aus dem Altersheim (4)
So ist also das Altersheim eine wirklich notwendige Einrichtung, ein notwendiges Übel, ein Notbehelf, ein Kunstprodukt in unserer Gesellschaft, in der das tragende Väterliche wie das tragende Mütterliche, eben die Familie, ganz an den Rand gedrängt wird. Das Aufgehobensein von Grosseltern im Kreis der jüngeren Generation ist vergangene Geschichte (nicht nur zum Nachteil der älteren Generation, sondern auch der Kinder und der gesunden Erwachsenen, denen damit eine wesentliche Lebenserfahrung verschlossen bleibt). Natürlich war «Familie» und «Grossfamilie» gewiss einst auch nicht immer so, wie es in ihr zugehen sollte. Aber die soziologische Entwicklung heute ist in ihrer Torheit unerbittlich. Die Familie hat ihre die Generationen umschliessende Kraft verloren. (Dahinter steckt letztlich ein religiöses Problem.) – Darum sollte man das Wort «unsere Heimfamilie» ja nicht grossmundig gebrauchen. Gewiss macht das Altersheim beste Versuche, aus der Notlösung etwas Gutes zu machen. Aber in Wahrheit bleibt das Altersheim ein Aufbewahrungsraum für Menschen ohne Heimat. Wer behauptet, das Altersheim sei mehr als eine Notlösung, weiss nicht, wovon er redet, oder er redet bewusst schön. – Unsere Zeit bräuchte in Kleingruppen mit zusammenpassenden Bewohnern familiär
strukturierte Heime, wo Pensionäre und stabiles Personal zusammenwachsen könnten und auch Vertrauen persönlich sich aufbauen kann.
***
Dass heutige Altersheime vom wirtschaftlichen Denken im Grossen bis ins Detail bestimmt sein müssen, ist auch ein Grund für ihre menschlich-seelische Sterilität. Heute wäre es an der Zeit, eine neue Konzeption «Altenheime» zu entwerfen. Freilich bedürfte es hierzu eines Gespürs von Vätern und Müttern der kirchlichen Diakonie von der Mitte des 19. Jhdts. bis Mitte 20. Jhdt. Allein deren Biographie zu studieren sollte zur Pflicht gemacht werden für in heute öffentlich geordneter «Sozialarbeit» verantwortlich Wirkende. Denn jene Männer und Frauen trugen das für ihre Zeit nötige Wissen und Gespür in sich und hatten gleichzeitig die Durchsetzungskraft, das Nötige in Wirklichkeit umzusetzen. – Dafür fehlt es heute allenthalben. «Sozialarbeit» ist heute faktisch ein Teil der Verwaltung des Menschen. – Die Grosskirchen, die heute als erste zu Neuem berufen wären, versagen auch hierin kläglich. (Nicht wenige Pfarrer verstehen ihre geistliche Berufung, ihr Ordinationsgelübde und ihr Wirken unter der Prämisse von Gehaltsprozenten.)
***
Zurück zum Konkreten: Im Altersheim bleibt der alte Mensch weitgehend in sich abgekapselt. Selbsteröffnung im Gespräch erfolgt sozusagen nie. Gespräch, Austausch ist reduziert auf banale Unterhaltung. Freundlichkeit ja, Vertrauen nein. «Das Wort», ursprünglich dem Menschen gegeben, «dass er nicht allein sei», dass er im «Du» das ihm nötige Gegenüber finde, den Mit-Mensch, also das Gemeinschaft wirkende Wort ist weithin zu Floskeln, zu Bemerkungen verkümmert, mit denen sich der altersmüde Mensch eher in sich selbst zurückzieht statt öffnet. Nur ja nichts allzu Persönliches!
Eine Stimme aus dem Altersheim (5)
Nur ja nichts Persönliches!: das betrifft nun ganz besonders das Verhältnis des (seinerseits selbst in Engführung gehaltenen) Personals zum Pensionär. Zwischen beiden bleibt letztlich eine stets schmerzhaft spürbare Grenze. – Primär hat mich in diesen sieben Jahren (nach einem offenherzigen Eintreten ins Heim und solchem Zugehen auf alle) nicht die weitgehende Deformation von Pensionären um mich herum depressiv gemacht, sondern die (reglementierte) Selbstabschottung des Personals von einem, der ohne Austausch, Gespräch,
Vertrauen nicht gut leben kann. Wächst Vertrauen, wo faktisch zwischen zweien Sprachlosigkeit herrscht? – «Wenn der Pensionär Hilfe braucht, soll er sich melden!» So die Direktive. Damit ist der physisch nicht behinderte Pensionär abgespeist als Untermieter Nr. x auf Zimmer Nr. y samt Vertragsbasis z. Wenn er nicht krank wird bzw. verunfallt, hat er zufrieden zu sein mit dem, was das Haus sonst freundlich bereitstellt (Unterhaltung). Persönlicher Austausch gehört nicht zu den Aufgaben des Personals. Der faktische Wortschatz zwischen Personal und mir (Korridor, Speisesaal) hat mit 10–20 Worten pro Tag reichlich Platz: gute Worte nebenbei. Wirkt freundliches Servieren überm Tellerrand alleine Gemeinschaft? 20 Worte (wenns hoch kommt): die «Kommunikation » zwischen dem Personal und mir.
***
Natürlich ist eine Distanz des Personals nötig. Denn es braucht diese als Selbstschutz für sich selbst, weil ein grosses Heim auch ein fataler Nährboden für ungutes Gerede oder Eifersucht ist. Der Pensionär, der alles bezahlt, bezahlt auch diesen Selbstschutz mit seiner menschlichen Vereinsamung. Nur Kommunikation und Zeit und Wille hiefür würde diese lindern. Freien Austausch (und manchmal mehr) hat das Personal nur unter sich. Es spricht dauernd über Pensionäre, aber (ausser technisch Nötigem) nie mit dem Pensionär als Person selbst. Wer hier einander-näher-Kommen sucht, das zum Leben gehört wie das Atmen, sucht sie vergeblich bei sich selbst reservierendem Personal (das zu persönlicher Reserve auch angehalten wird. Und letzteres bei erfahrenen und geschulten Mitarbeitern, die aus Lebenserfahrung selbst entscheiden könnten, wo, wie, wann es angebracht wäre, einem Pensionär auch persönlich näherzutreten, falls sie es selbst möchten. Natürlich kann das nur dann vertrauensbildend sein, wenn auch der Pensionär seinerseits um ein Schweigegebot weiss. Erfahrenes Personal wird hier sehr wohl zu unterscheiden wissen.)
Eine Stimme aus dem Altersheim (6)
Weil also «Hilfe» eingegrenzt bleibt in sachliche Verrichtung, bleibt in freundlicher Kurzverständigung stecken, was Begegnung werden könnte. Oft hat ja das Personal schlicht keine Zeit dafür. Manchmal ist es bis an die Grenze der Belastbarkeit gefordert (Freilich gilt die alte Wahrheit, dass jeder Zeit hat für das, was er will, und eben nie Zeit für das, was er nicht will). Der umschriebene Auftrag des Personals erschöpft sich in Assistenz und physischer Betreuung.Teilnehmende Nähe darf man nicht erwarten. Was in einer Familie in Nähe wie Konflikten normal ist, kann in der Heimatmosphäre nicht zum Tragen kommen. So lebt das Personal in Wahrheit «draussen»: seine Welt ist sein Daheim. Das Heim ist seine Berufswelt. Damit bleibt unvermeidlich für den Pensionär das Heim eine Pseudowelt ohne wirkliche Gemeinschaft.
***
Soweit von einem «Miteinander» zwischen Personal und Pensionär die Rede sein kann, so ist dieses «Miteinander» eingegrenzt auf Dienst: eine Prothese, mehr oder minder lebensnotwendig und gut, je nach «Fall». Eine Prothese ist eine notwendige Hilfskonstruktion, damit die Pensionäre einigermassen gut über die Runden ihrer 24 Stunden kommen. Mehr kann nicht sein.
***
Ich bin in meinem aufgaben– wie krisenreichen Leben nie so verlassen gewesen wie in den Jahren im Heim, so zurückgeworfen auf mein oft armseliges Selbst.
***
Man sucht Gemeinschaft, und findet ein freundlich-unverbindliches buntes Kollektiv. Man sucht Gespräch, und findet eine Postschalterauskunft oder Geschwätz oder Stummheit. Man sucht Vertrauen und stösst auf Reserve und Verschlossenheit. – Der Rest ist Schweigen.
Eine Stimme aus dem Altersheim (7)
«Sie können ja noch selbst aufstehen und in den Speisesaal gehen, Sie brauchen keine Zuwendung!» war die Antwort, die ein Pensionär bekam auf die scheue Bemerkung, noch nie habe ihm jemand ein liebes «Gute Nacht!» gesagt in seinem Zimmer. (Dass hinter der kleinen Frage ein Notruf der Vereinsamung sich bemerkbar machte, wurde gar nicht wahrgenommen.) Das Zimmer wird ja in der Tat nur betreten zu geschäftlicher oder technischer Verrichtung! Zu persönlichem Begegnen kommt es hier nie. – Die Antwort trifft genau ins Schwarze. Was heisst «Zuwendung»? Jeder gesunde, normale Mensch im Leben braucht, sucht, schenkt Zuwendung. Im Altersheim soll das offenbar nicht geschehen. Zwiesprache, und sei es in kürzester, aber vertrauend offener Art, kommt gar nicht zustande. – Dabei wäre für manch einen ein persönliches «Gute Nacht!», eine gütige ruhige Zuwendung ohne die stete Selbstreserve,
wirksamer als eine Schlaftablette, so wie ja auch bei jedem von uns ein persönliches «Guten Morgen!» manchmal ein wirkliches Friedenszeichen sein kann, das nachwirkt für den Tag. Aber über pflegerische Handreichung hinaus gibt es für den Bewohner eines Altersheimes kein seelisches Wahrnehmen seiner Verlassenheit.
***
Die über sieben Jahre hin, die ich hier im Altersheim bin, kam nie jemand vom Personal zu mir, um persönlich unverkrampft menschlichen Austausch (und sei es für fünf bis zehn Minuten) zu suchen. Manchmal kam es mir vor, mein Zimmer werde gemieden wie das eines Aussätzigen. Für vieles ist Zeit. Für wirkliches Begegnen nicht. Nur zu kurzer Verständigung in sachlicher Angelegenheit kam jemand zu mir. Da soll einer nicht depressiv werden? Mein helles Zimmer – wochenlang, monatelang – «Isolierstation». Wenn angemahnte «Achtung der Privatsphäre des Pensionärs» zur faktischen «Ächtung» seines Zimmers wird, liegt ja wohl allem ein offenbar nichtbehebbarer «Defekt» im Ganzen des Hauses zugrunde.
***
Warum resultiert durch unsere Welt «sozialer Dienste» die Tendenz zur Vereinsamung? Weil Helferarbeit, Pflegedienste unvermeindliche Struktur der Gleichförmigkeit haben. Betreuende wie Betreute im Heim begegnen sich auf dem Minimalniveau der Selbsterhaltung: technische Begegnung ohne wirkliche Nähe, Heim-Gesellschaft, aber keine Gemeinschaft.
Eine Stimme aus dem Altersheim (8)
Vertrauende Zuwendung wird so zwischen Personal und Pensionär gewiss nicht aufgebaut. Es bleibt alles eingeschränkt auf Kurzbemerkungen im Korridor, im Speisesaal. Wie es in Behindertenheimen «betreute Verwahrlosung» gibt (auch natürlich seelische), so ist «betreute Vereinsamung» im Altersheim geradezu vorprogrammiert. Ein Auf-die-Schulter-Klopfen wird dann u. U. nicht als Freundlichkeit, sondern als Herablassung empfunden, was gewiss weder bemerkt noch beabsichtigt ist, aber so «nebenbei» wirkt es u. U. so. Wirkliche Nähe ereignet sich anders. Auch ein Tänzchen mit einer über90- Jährigen täuscht, so belustigend es gemeint ist, nur eine Nähe vor, die gar nicht besteht.
***
Menschliche Nähe, Austausch, Vertrauen baut sich nur zwischen Mensch und Mensch auf. Alles andere bleibt an der Oberfläche. Im nur-Funktionalen erstickt der Mensch mit seiner gar nicht wahrgenommenen Geschichte, der Mensch in seiner wirklichen Not.
***
Auch polemisch Formuliertes enthält wohl ein Körnchen Wahrheit: Drei Dinge sind für das Personal vorrangig: 1) Die Salärprozente, 2) Die Vorschriften und sachlichen Richtlinien für terminbedrängten Job, 3) Der angepeilte Dienstschluss zum «Ab ins Privatleben!». Der Pensionär ein immer freundlich wahrgenommenes, aber auswechselbares Objekt. Das Personal (in den Augen des Pensionärs) ein auswechselbarer Funktionär.
***
So ist das Altersheim nur ein Spiegel des Verlustes, der heute alle gesellschaftlichen Schichten durchzieht: des Verlustes von Familie. Denn «Familie» lebt im und durch das Gespräch in Offenheit und Teilnahme. Bei dem, was man so schnell «Heimfamilie» nennt, kommt manchmal in Veranstaltungen doch kaum mehr heraus als eine Ansammlung von Einzelnen. Mehr als eine gesellige Runde kann «das Heim» beim besten Willen nicht bieten; sie kann kurzfristig über manches hinweghelfen; sie kann aber nicht wirkliches persönliches Begegnen ersetzen, das eine Annäherung an «Daheim» wäre.
***
Es geschieht vieles zur «Gemeinschaftsbildung»: Kaffeerunden, Jassrunden, Bastelstunden, Lichtbilder, musikalische Darbietungen, Chöre, Feiern usw. (letztere z. B. an Weihnachten stundenlang überdimensioniert), Faschingstreiben, alles dankenswert und mühevoll inszeniert. Auch im kirchlichen Jahreskreis wird festlich geschmückt und wir werden mit Überraschungen beschenkt. Aber auf der Basis der individuellen Vereinsamung bleibt ein entscheidender Rest, ohne den Osterhasen, Engelchen und Sterne niemanden in der Tiefe erreichen. Es bleibt dabei: Unterhaltung kann kurzfristig über manches hinweghelfen, Heilen aber könnte nur Vertrauen im Gespräch von Mensch zu Mensch. Alle Unterhaltung ist eine Ansammlung Vereinzelter, und hernach kehrt jeder einsam in sein Zimmer zurück.
Eine Stimme aus dem Altersheim (9)
Ich habe in all diesen Jahren weder mit jemandem von den Pensionären noch des Personals wirklich persönliches Begegnen im Gespräch erfahren. Nur ganz wenige im Haus erfahren es durch intensive Besuche familiärer oder freundschaftlicher Bindungen. Das sind Ausnahmen.
***
Über Wortfragmente hinaus geschieht im Hause kaum etwas. – Nach dem Abendessen routinemässig gut gemeint je kollektive moralische Belehrung, die jeder längst wieder vergessen hat ehe er auch nur seinen Stuhl am Tisch wieder zurechtgerückt hat. Nichts kollektiv Gutgemeintes kann das nicht stattfindende Gespräch ersetzen.
***
Auch die seltenen Besuche des «Besuchsdienstes» lösen dieses Defizit nicht. «Wie geht’s?» fragt der Besuchsdienst. Er erwartet Selbsteröffnung des Pensionärs, den er in den seltensten Fällen wirklich kennt, berührt seine evtl. Nöte, die er in keiner Hinsicht ändern oder lösen kann, und erzählt dann von Erlebnissen seinerseits, die den Pensionär wenig oder gar nichts angehen, weil ja gar keine gemeinsame Geschichte besteht, und dann ist es wieder ein wenig so, wie wenn man einem Gefangenen erzählt hat, wie schön es draussen in der Freiheit ist. Mit guten Wünschen geht der Besuchsdienst spätestens nach einer halben Stunde fort, befriedigt, denn er hat ja sein Programm. War das wirkliches Begegnen, Einander-näher-kommen? fragt sich der Pensionär und bleibt wieder allein in seinem Selbstgespräch. – Organisierter «Besuchsdienst» wäre sekundär, wenn das Personal frei zum Gespräch wäre.
***
Und Seelsorge? Fehlanzeige! Seelsorge wäre ja begleitende, treue, verpflichtende persönliche Zuwendung, vor allem zeitraubende! Dafür haben heutige Kultfunktionäre keine Zeit. In Andachten bringen sie etwas vom immer «guten Gott» ins Haus, und dann gehen sie schleunigst wieder fort, die Berufstheologen, die den «guten Gott» stets zuverlässig zur Hand haben. Innerlich angefochtene, einsame Menschen werden dabei kaum erreicht. Von Sterbebegleitung und Seelsorge im Sterbensgang ganz zu schweigen. – Und wenn jemand gestorben ist: Vorgestanzte Routine-Formeln. – Anschliessend (wie könnte es anders sein!) geht jedes sofort seinen Pflichten, Interessen, Vergnügungen nach.
***
Was also «Seelsorge» schuldig bleibt, wird abgewälzt aufs Personal, das dazu gar nicht in der Lage ist, und bleibt an den Ärzten hängen, die auch nichts ändern können. Sie verschreiben Tranquilizer, Neuroleptica, Antidepressiva, die in den Altersheimen konsumiert werden zum Ruhigsein als Glücklichsein. So wird Unlösbares tragbar gemacht, aber weder gelöst noch fruchtbar bewältigt. Nur Nähe von Mensch zu Mensch wäre hier wirkliche Hilfe.
***
In einem traditionsreichen Altersheim (koordiniert mit Klinik und ebenfalls angeschlossenen Pflegestationen) wird das (keineswegs einheitliche) Betreuungspersonal durch eine eigens angestellte Theologin begleitet und geschult, damit die Betreuung nicht in mechanischer Assistenz versackt, sondern individuelles Begegnen mit dem Pensionär im Gespräch auch persönliches Vertrauen aufbaut (ausgerichtet auf Lebenslauf, Bildung, Charakter, Behinderung des Pensionärs). – Das ist wohl der genaue Gegenpol zu unserem Heim, wo Distanz statt individuelle Begegnung als Leitlinie gilt. – In jenem Heim geht das bis zur Sterbebegleitung, unabhängig von konfessionellen Schranken, ausgerichtet auf die jeweilige Person. Und in einem anderen, weit entfernten, mir nicht zugänglichen Heim versucht man ein neues Konzept: Familiengerechte Kleingruppen zusammenpassender (also auch einander ergänzender) Pensionäre, je 6–10 Personen (ausgerichtet nach Biographie, Herkunft, Interessen, Behinderung, Krankheit). Jede Kleingruppe mit stabil verantwortlicher Betreuungsperson, zu der und mit der sich Vertrauen aufbauen kann. Grundsatz dort: «Jede Betreuung hängt wesentlich ab von dem Menschenbild, das der Betreuende hat.» Leitbild dort: «Wer in diesem Bereich arbeitet, kann Menschen nur helfen, wenn er in ihnen mehr als einen «Fall» sieht und sie in ihrer Persönlichkeit akzeptiert.»
Eine Stimme aus dem Altersheim (letzte Folge)
Natürlich würde das Personal, das diese Ansichten liest, sich missdeutet fühlen. Denn es setzt sich ja wirklich ein, ist stets hilfsbereit, geduldig und freundlich. Faktisch aber ist für persönliche Zuwendung weder genügend Raum noch Wille noch innere Freiheit. Und jedes vom Personal hat ja schliesslich seine eigenen (verschwiegenen) Sorgen. Man merkt sofort, was aufgesetzte Freundlichkeit ist und was unverkrampfte Herzensgüte. Aber ist es nicht so: Mit sichtbarer Erleichterung macht jedes nach Dienstschluss die Türe hinter sich zu, winkt sich mit freundlichem Wort fort oder besteigt sein Auto, um sich endlich «daheim» im wahren, im eigenen Lebenskreis und bei Geliebtem zu erholen. «Gott sei Dank, für heute wär es wieder geschafft!» Distanz ist nötig! – Das ist so gut zu begreifen. – Aber der Pensionär kann sich von nichts distanzieren, weder von seiner Geschichte noch von seiner Gegenwart. Auf ihn wartet nie etwas anderes als die Einsamkeit seines stummen Zimmers, in dem niemand mit ihm spricht. – So wird die tragische Differenz zwischen «Heim» und «Heimat» täglich vordemonstriert.
***
Wer freilich in gemütlicher Kaffeerunde und mit erotischen Boulevard- Illustrierten völlig genug hat, wird alles vielleicht anders sehen.
***
«Das» Altersheim kann nur objektiv, neutral sein, nicht primär personorientiert. «Die» Heimat aber ist persönlich. Im Grunde genommen ist diese Differenz sogar tödlich. So, wie die gesellschaftlichen Dinge heute liegen, kann das offenbar niemand ändern. Wie hier im Heim jeder letztlich allein ist, so wird er auch allein im Heim sterben, mehr oder minder verlassen. Für Sinn-Frage und Trost ist das Altersheim nicht zuständig. Es ist zuständig für Dienstleistungen.
***
Es sei aber nicht verschwiegen, dass, ganz verborgen und scheu, selten wirklich Helfendes, Tröstliches, von Mensch zu Mensch auch hier sich ereignen kann. Wo sich solches ereignet, ist es ein wirkliches Wunder! Das wahre Christliche und das schlichte Menschliche sind dann eins. – Aber es bleibt verborgen unter der offenkundigen Tatsache, dass in unserer totalverwalteten Welt der Mensch unendlich einsam wird. Dem begegnet er (vergeblich) draussen, ausserhalb des Heimes, durch Flucht in die Massenhysterie oder in schrankenlosen Individualismus. – Der ins Altersheim ausgegrenzte Mensch sieht dem von ferne zu. Heilende Hilfe, draussen in der Welt wie in der Heim-Welt, ist nur durch persönlich-liebevolle Vertrauensbeziehung möglich.
***
Wie in der heutigen «Sozialindustrie» so vieles, was Menschenführung betrifft, zu einem «Job» verkommt, so ist auch in Altersheimen Dienen und
Verdienen ununterscheidbar geworden. Einst gab es (bei aller menschlichen Fehlbarkeit) «Diakonie». Heute gibt es nur vielschichtiges «Dienstleistungsgewerbe ». Parallel dazu ist in unserer «Kommunikationsgesellschaft» auch Wort und Gespräch zu rudimentärer Verständigung verkümmert. Auch das Altersheim trägt alle Merkmale gemeinschaftsverarmter Massengesellschaft.
***
So gibt es Reglemente, die Gemeinschaft verhindern. Praktisches Helfen ist ja schon eingepfercht in Stufen, Taxpunkte, Statistik, Kalkulation, Kontrolle – Rapport. Der betreuende wie der betreute Mensch sind Nummern: Der in Funktionen durch Funktionäre verwaltete Mensch.
***
Wie es im Leben kein Recht auf Liebe gibt, so auch kein Recht auf Gespräch und Vertrauen. Das Entscheidende kann man nur erbitten und empfangen. Machbar ist nichts. Wo die Kleinmünzen des grauen Alltags (Pflichten, Verrichtungen, Worte) nicht vom Goldgrund offenen Vertrauens getragen und von dorther gespeist werden, werden die Tagesmünzen inflationär. Dann kommt die Routine, der Todfeind jeder Gemeinschaft. Der deprimierte Vereinsamte trauert über diesen Verlust. Menschsein ist daraufhin angelegt, in Vertrauen Gemeinschaft zu werden. Ohne Selbsteröffnung zwischen Pensionär und Personal kann sie sich nicht ereignen. – «Das Weltliche und das rechte Geistliche sind viel näher beieinander als die meisten Leute glauben. Das rechte weltliche Glück und das himmlische Glück werden akkurat auf dem gleichen Wege gefunden. » (Jeremias Gotthelf)
***
Wo das Gesetz regiert, «ist der Tod im Topf». Es gilt für das Personal. Es gilt auch für den Pensionär, der dankbar sein möchte, für das, was er empfängt, und der nicht bitter ersticken soll über dem, was er entbehrt: dem nun allerdings Entscheidenden.
***
Wer in Menschenführung Erfahrung hat, weiss, wie der alte Mensch oft sich in sich selbst isoliert, wie schwer es dann dem alten Menschen selbst fällt, liebevoll zu sein. Umso mehr ist er darauf angewiesen, dass er nicht nur als «Fall», «funktional» behandelt wird, sondern in persönlichem Austausch see-
lisch «wahrgenommen» wird. Sonst versinkt er in der Erfahrung, nur eine Nummer im Kollektiv zu sein. Die Frage bleibt grundsätzlich offen: Sind auch im Altersheim «Richtlinien» wichtiger als der konkrete Mensch? Richtlinien sind nötig. Aber das Leben ist immer ein Prozess, der erfordert, dass Richtlinien immer wieder auf den konkreten Menschen hin zu prüfen sind. Richtlinien sind für den Menschen da, nicht der Mensch für die Richtlinien.
***
Die Grenze zwischen Herrschen und Dienen im Altersheim kann keine starre Richtlinie sein. Sie ist vielmehr sehr verletzlich, fein und beweglich. Sie will immer neu erworben sein. Dann könnte auch die Tür zum Pensionär ein wenig «familiär», ein wenig «heimatlich» sich öffnen.
Wie lange noch?
„Lassen Sie uns hinausgehen, hier können wir nicht miteinander reden. Sie hören uns ab und nehmen alles auf Tonband auf. Sehen sie, wo ich mein Bett habe? Dort an der Decke haben sie kleine Löcher gebohrt, damit sie mich sehen können, die ganze Nacht hindurch. Und in diesen Stuhl darf ich mich nicht setzen, weil sie mich durchs Fenster sehen.“
Sie steht auf, setzt sich auf den Stuhl neben dem Bett, das an der Rückwand steht. Die Tapeten an den Wänden sind mit Blutflecken übersät, als hätte sie Mücken totgeschlagen. Vermutlich aber hat sie sich ihre Hände an der Wand wund gerieben. Jedenfalls erkenne ich zwischen grossen, braunen Leberflecken aufgeschürfte Stellen.
„Seit heute Morgen suchte ich mein Portemonnaie. Ich habe Gott gestellt: Entweder zeigst du mir, wo mein Portemonnaie ist, oder ich bete nicht mehr. Heilige haben Gott auch gestellt, also darf ich das auch tun.“
Sie zieht ihre schwarzen Schuhe an.
„Meine Grossnichte hat mir zwei Paar schwarze Schuhe gekauft. Vierhundert Franken hat sie dafür abgerechnet. Vierhundert Franken!“
Wir gehen in ein Café, sie hakt mir unter.
Sie bestellt einen Milchkaffee.
„Sie sind ein typisches Kriegskind, hat mir der Arzt gesagt, sie haben zu wenig Milch bekommen. Abends stellte meine Mutter eine Blechschale in den Milchkasten, am Morgen nahm sie sie heraus. Es war immer zu wenig Milch drin, immer weniger als wir hätten bekommen sollen. Und jetzt bin ich 90. Aber ich klage nicht, ich klage nie, nur vor Gott.“
Sie fasst die Kaffeetasse, die wegen ihres Zitterns in der Vertiefung des Untertellers zu klappern beginnt.
„Sehen Sie? – ich schäme mich.“
Sie holt die zweite Hand zur Hilfe, hält die Tasse mit beiden Händen, nimmt einen grossen Schluck, verschluckt sich, hustet, als müsse sie sich übergeben, verliert für eine Weile ihre Stimme.
„Jeden Samstag hat meine Mutter zu mir gesagt: du hast gut gearbeitet. Und hat mir einen Milchkaffee gekocht und einen Gipfel gegeben. Ich habe ihr schon als kleines Mädchen beim Putzen von Büroräumen geholfen.“
Sie beugt sich vor und flüstert mir ins Ohr: „Es ist schlimmer als in einem KZ-Lager. Ich kann in meiner Wohnung nichts tun, ohne dass sie es wissen. Einmal habe ich meiner Nachbarin meine Wäsche gegeben. Da hörte ich sie sagen – sie hat es extra laut gesagt, damit ich es höre: diese Drecksau! Wen sie damit gemeint hat? Mich natürlich. Aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich manchmal zu spät auf die Toilette komme.“
Im Sonnenstrahl, der durch das Butzfenster fällt, sehe ich die Speicheltröpfchen, die sie bei jedem Verschlusslaut versprüht; ein Tropfen fliegt bis zu mir herüber. Sie nimmt meine Hand und zieht sie zu sich: „Manchmal frage ich mich: Wie lange noch?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Zum Glück habe ich den Fernseher
Ich besuche Frau M. im Betagtenheim. Nachdem wir einige Dinge betreffend Verwaltung der Einkünfte und Ausgaben geregelt haben, beginnt Frau M. zu erzählen:
„Mein Mann und ich waren 16 Jahre verheiratet. Dann hat er sich in eine andere Frau verliebt. Das ist eine zeitlang so gegangen. Ich konnte es aber nicht haben – noch eine andere Frau neben mir. Als er nicht bereit war „die andere“ aufzugeben, habe ich mich scheiden lassen. Er hat wieder geheiratet und nach 8 Jahren ist er da draußen im Westen der Stadt über die Brücke gesprungen. Als ich das erfahren habe, hat es mir schon einen Stich ins Herz gegeben – aber so richtig wehgetan hat es nicht.
Ich habe über 40 Jahre in derselben Firma in St. Gallen gearbeitet, davon 19 Jahre als Abteilungsleiterin. In der Firma habe ich Anni kennen gelernt. Wir haben 38 Jahre lang am selben Tisch zu Mittag gegessen. Anni hat nie viel geredet. Sprechen war nicht ihr Ding. Ich habe oft zu ihr gesagt: Anni, so wirst du nie einen Mann finden. Wenn du einen Mann kennen lernst, mit ihm ausgehst und nicht sprichst, „kratzt der doch sofort die Kurve“!
Nach der Scheidung habe ich mit Anni die Ferien verbracht. Das ging sehr gut. In der Nacht hat sie nicht geschnarcht und am Tag hat sie immer das gemacht was ich wollte.
Anni kommt mich im Heim regelmäßig besuchen. Sie ist immer noch nicht sehr gesprächig. Aber treu ist sie!
Manchmal denke ich, da habe ich ein Leben lang gearbeitet, mein Geld verdient und selbständig gelebt. Und was ist mir geblieben? Nichts. Ein Fernsehapparat, ein paar Bilder, meine Kleider. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Ich darf gar nicht zu viel denken.
Zum Glück habe ich den Fernseher! Am Morgen schaue ich mir gerne Tierfilme an. Am späteren Nachmittag kommt dann zum Beispiel „Um Himmels Willen“. Das ist sehr lustig. Da streiten eine Nonne und ein Bürgermeister immer miteinander. Am liebsten sind mir aber Krimis. Beim „Tatort“ kann ich mich so richtig reinhängen. Und wenn er fertig ist, ist alles vorbei. Den „Fröhlichen Feierabend“ verpasse ich nie und beim „10 vor 10“ schlafe ich meistens schon.
Ich bin hier nicht zu Hause. Endstation. Mir „stinkt’s“! Als es in diesen Tagen draußen wieder so grau und trüb war und meine Stimmung im Keller habe ich mir gesagt: Jetzt zieh’ ich mir alles rein, was mir Freude macht. Ich trinke Wein, genieße in der Cafeteria einen Kaffee, schaue mir im Fernseher gute Filme an und freue mich auf den Frühling. Dann kann ich endlich wieder nach draußen gehen und an die Sonne sitzen.“
Frau M. fragt mich, bevor ich gehe: „Bringen Sie mir, wenn Sie das nächste Mal kommen, bitte wieder mal die Kommunion?“ Sie schaut einen flüchtigen Moment innig zum Himmel und sagt: „Das gibt mir so viel.“
Brigitta Holenstein, kath. Sozialdienst Ost
Zämenäh
Etwas rauschte in den Wänden. Wäre es nicht mitten im Sommer gewesen, ich hätte die Heizung vermutet. Oder fliessendes Wasser?
Eine Stille, als flögen wir durchs All, umgeben von diesem Rauschen. In der Kapsel aber, in der wir flogen, war das leiseste Geräusch hörbar: Glucksen und Gurgeln aus ihren Gedärmen, mit jedem Atemzug das Reiben ihres frisch gewaschenen Nachthemds am ebenso frisch gewaschenen Deckenüberzug. Sie öffnete ihren Mund, ein Laut, als fiele ein Tropfen.
Kein Wort.
Auch nach meinem dritten Anlauf, wie es ihr gehe, sagte sie kein Wort.
Ihre Lippen rot, als hätte sie sie mit einem Lippenstift nachgezogen. Wächsern ihre Haut, etwas heller um die Augen, übersät mit Leberflecken. Im schmalen Lidspalt glitzerte vom Fenster widergespiegeltes Licht. „Kann ich etwas für Sie tun?“ Im Badezimmer ging das Licht aus, das zuvor wegen des Sensors, der die kurz hereingetretene Schwester registriert hatte, gebrannt hatte.
Mit ihrem bleichen Gesicht und ihren roten Lippen strahlte die Alte eine entrückte Schönheit aus, die sie ihr Leben lang vor der Welt verborgen gehalten schien.
Ich unternahm einen weiteren Anlauf: „Wo ist ihre Schwester?“ Jetzt öffnete sie den Mund: „Zäme isch …“ „Zäme sii …“ „Zäme näh …“ Zämenäh (zusammennehmen) glaubte ich deutlich zu verstehen. Ihre Worte schmerzten mich, als erführe ich am eigenen Leib, was es heisst, sich ein Leben lang zusammennehmen zu müssen.
Aus ihrem linken Augenwinkel glitt glitzernd eine Träne und fiel aufs Kissen. Ihr Gesicht blieb bewegungslos.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Die grosse Reise
Säuerlicher Schweissgeruch beisst in die Nase. Geknüpfte Teppiche liegen am Boden, teilweise in zwei Lagen, und an der Wand hangen orthodoxe Heiligenbilder. Sie liegt im Bett wie ein gestrandeter Wal. Sie reicht mir ihre schweissfeuchte Hand, hält meine Hand fest, umfasst sie mit ihrer Linken. Sie schweigt und hält fest. Lange. Als ich meine Hand zurückziehen will, verstärkt sie ihren Druck, ich meinerseits auch und ziehe schliesslich die Hand aus ihrem schwabbelig-feuchten Griff.
„Ich habe Darmkrebs“, sagt sie und öffnet zum Beweis ihren Hosenbund. Unterhalb ihres Bauchnabels klebt ein Stoma.
„Wenn ich ihn lange nicht leere, platzt er. Deshalb konnte ich nicht zu Ihnen ins Büro kommen. Ich bin froh, dass Sie da sind … Bin ich gelb im Gesicht? Wissen Sie, immer, wenn es schlimmer wird mit dem Krebs, werde ich gelb.“
Bücher liegen auf ihrem Bett.
„Ich lese, um die Krankheit zu vergessen. Weg mit der Krankheit!“
Dann erzählt sie mir ihre Geschichte:
„Meine Mutter war Nonne. Mit 37 Jahren wurde sie schwanger. Das Kind war ich, geboren 1939 in der Nähe von Budapest. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, aber irgendwie haben sie sich trotzdem verstanden. Erst kam Hitler, dann kam Stalin. Stalin hat uns alles genommen, bis er endlich krepierte. Verstehen Sie, bis er endlich 1953 krepierte. Wir hatten wenig zu essen, 100 g Brot und einige Kartoffeln pro Tag und Person. Dann erhängte sich mein Vater, das war 1949. Ich heiratete einen Mann und zog mit ihm in die Schweiz. Ich arbeitete in Altersheimen und Restaurants. Dann starb mein Mann. Sein Bruder war alleine und ich war alleine. Also sagten die Verwandten: Warum heiratet ihr nicht? Und so heirateten wir. Aber er war gewalttätig. Wir schieden uns, er lebt jetzt in Ungarn, hat Kinder.
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Im Spital lag ich im selben Zimmer wie eine Italienerin, Giovanna, 39 Jahre alt. Sie hatte auch Darmkrebs, alles hatten sie ihr rausgenommen, aber ihr Bauch war dick, dick von Geschwülsten und Geschwüren. Wenn ich sterbe, werde ich dich beschützen, sagte sie. Das hat mir die Angst vor dem Tod genommen.
Bevor ich das Spital verliess, sagte sie zu mir, ich solle für sie beten, für ihre grosse, grosse Reise. Zwei Tage später, nachts um drei, erschien sie mir in weissem Gewand. Ich gehe auf die grosse, grosse Reise, sagte sie. Am Morgen rief mich ihr Mann an, sie sei gestorben, morgens um drei.“
Wir schweigen lange. Ich taste wie ein Blinder in einem Raum, in dem ich nur der Vergänglichkeit gewahr bin.
„Gehen Sie jetzt“, sagt sie.
Wie ich ihr die Hand zum Abschied reiche, zieht sie diese an ihr Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger auf ihre Wange.
„Pusserl.“
Ich küsse sie auf die schweissfeuchte, klebrige Wange, sie zieht mich mit beiden Händen zu sich herab und küsst mich. Lange hält sie mich fest. Langsam löse ich mich aus ihrer Umarmung. Sie strahlt mich an, immer noch meine Hand haltend. „Sie haben eine Schöne Seele! Ich sehe ihre Ausstrahlung, hellblau und rosa, hellblau und rosa.“
Im Fahrtwind auf dem Velo fühlen sich Gesicht und Wange klebrig an. Beim ersten Brunnen halte ich an und wasche mich. Eine schöne Seele? Hellblau und rosa, denke ich, sind die Farben des frühen Morgens.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Es ist viel zu schnell gegangen
„Morgens um fünf hat es mich wie angesprungen“, erzählt die alte Frau.
Morgens um fünf schimmerte grau die Morgendämmerung durch das knotige Geäst einer Esche. Die Knospen sind noch nicht aufgebrochen. Morgens um fünf ist die Zeitungsausträgerin in der Mitte ihrer Tour angelangt. Morgens um fünf kriegt man am Bahnhofkiosk einen Kaffee im Plastikbecher.
„Habe ich nichts vergessen?“, fragt sie sich unablässig.
Habe ich den Termin für die Physiotherapie eingeschrieben? Hätte ich für die Sitzung heute Nachmittag nicht das Protokoll durchlesen sollen? Muss ich für das Abendessen einkaufen?
„Mich plagt das Gefühl, einen Wunsch meiner Schwester vergessen zu haben“, meint sie.
Wessen Wünsche könnte ich vergessen? Erwartungen ja. Verpflichtungen ja. Aber wessen Wünsche?
„Die Abdankung war schön. Die Engländerinnen sind auch gekommen. Wissen Sie, die mit ihr den Englischkurs besuchten. Überhaupt waren viele Leute gekommen, obwohl ich ja keine Todesanzeige aufgegeben habe. Sie hat gewünscht, Todesanzeige und Danksagung in einem aufzugeben.“
Eine schöne Abdankung? Zum ersten Mal fällt mir das Wort Dank darin auf. Ich habe Abdankung bisher als trotziges Verduften verstanden. Aber als Dank?
„Sie fehlt mir, meine Schwester, obwohl wir während der letzten Monate nicht mehr miteinander reden konnten. Es ist so leer hier.“
Sie sitzt neben mir in einem weissen Hemd und schwarzer Hose. Ihre Hände liegen in ihrem Schoss, knotig vor Gicht. Ihre Haut hat sich von den Knochen abgelöst, ist dünn wir Pergament – auf das sie ihre letzten Worte schreiben wird? Oder keine Worte mehr? Nur die bleiche Einfärbung ihres letzten Atemzugs?
„Es ist so schnell gegangen. Alles ist viel zu schnell gegangen.“
Ihre Schwester hatte an Parkinson und einem Tinnitus gelitten. Das letzte Jahr war sie bettlägerig. Gleicht das Menschenleben im Rückblick dem Verglühen eines Meteoriten, der nur ganz kurz in die Erdatmosphäre eintaucht?
„Sie haben sie im Grab der Unbekannten beerdigt, neben dem Weiher. Wie sie es gewünscht hat. Habe ich nichts vergessen? Mich plagt das Gefühl, einen ihrer Wünsche vergessen zu haben. Die Abdankung war schön. Sie fehlt mir, obwohl wir nicht mehr miteinander sprechen konnten. Es ist so leer hier. Alles ist viel zu schnell gegangen.“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Persönlicher Brief
Endlich wieder einmal ein von Hand geschriebener, an sie persönlich adressierter Brief. Mit blauen und roten Streifen umrandet. Air mail, abgestempelt in Phnom Penh. Phnom Penh? Vielleicht von einer Enkelin. Welche Enkelin? Vielleicht von einem bisher unbekannten Verwandten.
Ich bringe ihr den Brief zusammen mit anderer Post ins Pflegeheim. Ich öffne ihn für sie. Ein knapp zehnjähriges Mädchen strahlt uns, auf einem Tisch sitzend, an. Ihr rechtes Bein ist ein Stummel, an den Tisch gelehnt steht eine Prothese.
Ich kann nichts mehr für sie tun, sagt die alte Frau, ausser Beten.
Auch heute noch, zehn Jahre nach dem Krieg, verstümmeln diese barbarischen Waffen allein in Kambodscha jedes Jahr Hunderte von unschuldigen Menschen, überfliege ich einen fettgedruckten Satz des Briefes.
Ich habe Angst vor Weihnachten, sagt die alte Frau. Zum ersten Mal bin ich nicht mehr in meiner Wohnung. Es gebe hier ein gutes Essen, hat die Pflegerin gesagt. Was soll ich mit einem guten Essen, ich schmecke ja gar nichts mehr.
58 Franken kostet eine Prothese, weniger als ein guter Schuh in ihrem Land. Mit 58 Franken können sie einem Menschen in Kambodscha helfen.
Ich wollte, ich wäre nicht mehr, sagt die alte Frau.
Das regelmässige Klacken der Pendeluhr. Ein Vogel fliegt über die verschneiten Dächer der Stadt. Aus dem Rauschen des Verkehrs der Ruf eines Kindes.
Sie müssen ins Büro, sagt die alte Frau, ich habe sie schon viel zu lange aufgehalten.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Da ist etwas, woran ich haften bleibe
Ja, holen Sie sich einen Stuhl, setzen Sie sich. Kennen Sie das Bild dort? Es ist von Macke, August Macke, Spaziergang am Thunersee, eine Skizze zum Bild, aber schöner als das Bild selbst. Da gibt es Leute, denen ist der Namen wichtig, die fragen sich, wie viel das Bild kostet. Aber mir ist das gleich. Ich schaue das Bild tagelang an. Sie verstehen deren Schönheit nicht. Man muss es tagelang anschauen, um seine Schönheit zu sehen. Nebenan hängt ein Bild von Gabriele Müntner. In einer Auktionsausschreibung von Koller wird es für 360'000 Euro angeboten. Ein ähnliches Bild, dieselbe Grösse. Was die Gauner heutzutage für solche Bilder verlangen. Gefällt es Ihnen? Es ist komplizierter als das andere, man meint zuerst, es sei einfach nur ein Haus und ein Garten. Aber man muss es länger anschauen. In meinem Rücken hängt ein Bild von Molliet, Louis Molliet, sehen Sie es? Diese Farben! War da nicht noch ein viertes Bild? Ach ja, der Rembrandt, Jesus lehrt am Ölberg. Auch eine Skizze zum Bild, aber sie ist echt, glauben Sie mir. Das kann ich belegen. Alle Bilder zusammen sind über zwei Millionen Franken wert … Der Baulärm draussen? Der stört mich nicht, wissen Sie, ich habe die Gabe zu verdrängen. Was ich nicht hören will, höre ich nicht. Das ist von Macke, sehen Sie das Bild? Ich kann es tagelang anschauen. Man sieht die Schönheit nur, wenn man es tagelang anschaut. Sie sehen die Schönheit nicht, da ist so viel drin, das verstehen Sie nicht. Ich habe es ausgeschrieben gesehen für 320'000 Euro... ich weiss nicht mehr genau, aber diese Halsabschneider wollen mir nichts dafür bezahlen. Boff, er müsse es zuerst abklären lassen. Warum helfen Sie mir nicht? Sie müssten mir helfen, diese Bilder zu verkaufen. Gut, ich brauche jetzt kein Geld. Aber wenn ich es brauchen würde? Was meinen Sie? Wenn sie verkauft wären, würden sie nicht mehr hier hangen? Hören Sie auf damit! Diese Halsabschneider. Ich kenne ihre Pläne genau. Warten, bis ich abgekratzt bin, dann kommen sie ganz billig zu den Bildern. Gehören Sie auch zu denen? Haben nicht Sie mich hierher gebracht? Hier ist es wie im Gefängnis! Nein, schlimmer als im Gefängnis, im Gefängnis kann man wenigstens noch selber auf die Toilette gehen. Was?! Ich soll selbst gesagt haben, ich wolle ins Pflegeheim? Stimmt doch nicht! Ich mache noch alles selbstständig! – Ich bin müde. Ich liege den ganzen Tag im Bett, weil ich so müde bin. Und schaue mir die Bilder an. Das ist von August Macke. Gefällt es Ihnen? Ein wunderbares Bild, ich kann es tagelang anschauen. Und dort hängt ein Bild von Gabriele Müntner, können Sie die Initialen lesen? GB, nein GM. In einem Auktionskalender ist es einmal für 320'000 Euro angegeben worden. Waren da nicht noch andere Bilder? Ach ja, der Rembrandt und der Molliet, das Geviert. Es ist ein Geschenk, dass Sie gekommen sind. Ja, ich meine, dass ich über meine Bilder reden kann. Da ist etwas, woran ich haften bleibe … Ich bin müde ... Haben Sie mich hierher gebracht? Sie gehören doch auch zu denen, die nur darauf warten, bis ich abgekratzt bin. Deshalb helfen Sie mir nicht, die Bilder zu verkaufen. Was?! Sie kennen sich nicht aus! Sie wollen sagen, dass sie nicht echt sind! Die sind echt! Alle zusammen sind über 2 Millionen Franken wert. Allein das Bild von Gabriele Müntner habe ich für 360'000 Euro ausgeschrieben gesehen. Fast das gleiche Bild wie dieses, gleiche Grösse. Es ist komplizierter als jenes von Macke. Auf den ersten Blick meint man, nur ein Haus und einen Garten zu sehen. Aber man muss es länger anschauen. Ich schaue das Bild tagelang an. Man muss es tagelang anschauen, um seine Schönheit zu erkennen ... Gut, dass Sie da sind. Dass ich über meine Bilder reden kann. Wissen Sie, vielen Leuten ist nur der Name wichtig. Die fragen sich, wie viel ein Bild kostet. Ich bin so müde … aber da ist etwas, woran ich haften bleibe.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Für die andern ist man dann …
Man wird nichts mehr inne.
Niemand kommt mehr vorbei und erzählt mir, was so läuft.
Wo sind denn die vom Arbeiterverein?
Was? Den gibt es nicht mehr?
Welcher Tag ist denn heute?
Sie sollten Ihren Kalender aufhängen!
Man kommt eben nicht mehr so recht draus.
Der Arzt ist auch noch nie dagewesen.
Doch? Ich weiss es gar nicht mehr.
Man kommt eben nicht mehr so recht draus.
Man sitzt oft allein im Zimmer.
Der Heimleiter hat sich auch noch nie vorgestellt.
Doch? Ich weiss es gar nicht mehr.
Die nebenan sagt, ich sei streitsüchtig.
Und erzählt es allen weiter.
Das macht mich so wütend, ich würde ihr am liebsten die Faust ins Gesicht schlagen.
Früher konnte ich noch in die Kirche rennen.
Jetzt kann ich nicht mehr.
Für die andern ist man dann wie tot.
Notiert von Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Hochzeitskleid für Prinzessin Caroline
Ich besuche Frau M., 79-jährig, im Betagtenheim. Nachdem sie in ihrer Wohnung in der Nacht zweimal gestürzt ist und sich verletzt hat, lebt sie nach einem längeren Spitalaufenthalt auf der Pflegestation eines Betagtenheimes.
Frau M. schwärmt gerne von vergangenen Zeiten, vor allem von ihrer Arbeit als Motivnäherin bei einer Stickereifirma. Sie habe dort 35 Jahre lang gearbeitet. Wunderschöne Stoffe habe sie mit Blumenmotiven benäht – von Hand und mit einer speziellen Nähmaschine. Mühsam sei es gewesen, wenn es „krr“ gemacht habe. Dann sei nämlich die Nadel gebrochen.
Eine wunderschöne Arbeit sei das Hochzeitskleid für Prinzessin Caroline von Monaco gewesen. Jawohl, den Stoff - eine traumhaft schöne weiße Seide - habe sie mit anderen Motivnäherinnen mit unzähligen weißen Rosen benäht. Am Schluss hätten sie die Röschen mit weisser Watte ausgefüllt. Das habe wunderbar ausgesehen!
Ich sitze mit der Frau auf der Bank vor ihrem Zimmer. Sie sagt etwas enttäuscht, das sei schon komisch. „Ich war ein Leben lang selbständig, habe gearbeitet und gearbeitet und jetzt sitze ich da und habe gar nichts mehr.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Mit den Augen der Alten
Ich verlasse die Pflegestation. In mir trage ich das Bild von Männern und Frauen, die in Rollstühlen sitzen, warten, vor sich hinstarren, schlafen. Mit ihren Augen schaue ich aus den Fenstern der Eingangshalle, sehe einen Lampenschein widerspiegeln, gelb wie der Mond, bevor er untergeht. Hinter Sträuchern fahren Autos vorbei, verschwinden in dichtem Blätterwerk. Ich versuche, mir die Innenwelt der alten Menschen vorzustellen und denke an Winter, an Schnee auf Ästen.
Ich gehe der Strasse entlang mit suchenden, tastenden Schritten. In mir trage ich immer noch die Bilder der alten Menschen, als sähe ich die Welt da draussen durch ihre Spiegelung: die Arbeiter, welche die Strasse teeren, Maschinen, die zischen und knattern, die Wolkendecke, die in meinem Gang hinter den Häusern hinab sinkt. Ich werde eingehüllt vom Geruch der dampfenden schwarzen Masse.
Aus einer Bäckerei riecht es nach Brot.
Ein metallisiertes Auto spiegelt glasig die Umgebung, verzerrt sie in Wölbungen und Ausbuchtungen.
Eine Frau, die etwas sucht, bleibt auf dem Trottoir stehen. Ich nehme den Geruch ihrer Hautcreme wahr.
Flickflecken auf dem Teer, Überlappungen, Risse.
Ich reibe mich ab an meinen Wahrnehmungen bis sie transparent zu werden scheinen.
Plötzlich öffnet sich eine tiefe Stille in jedem Ding, jedem Wesen.
In mir.
Wie die Alten warte ich, schaue in mich hinein, bis meine Spiegelung zur Ruhe kommt, ganz zur Ruhe kommt. Und versuche zu erwachen aus der Illusion, dass um die Ecke ein Unsterblichkeitsversprechen auf mich wartet.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Weihnachtsgeschenke für meine Enkel
„Ich bin grad ehrlich. Ich habe den Betrag von Fr. 232.50.— Mitte Dezember von der Krankenkasse erhalten.“
Sie schaut mich verlegen an und fährt fort:
„Ich hätte damit die Rechnung der Ärztekasse bezahlen müssen. Aber eben - so kurz vor Weihnachten …“
„Wissen Sie, ich habe sechs Enkelkinder! Mit dem Geld, habe ich Geschenke gekauft. Ich wollte meinen Enkelkindern halt etwas bieten!“
Einen Moment sehe ich in ihren Augen einen Anflug von Stolz aufblitzen. Dann wechselt ihr Gesichtsausdruck und sie erzählt mit leiser Stimme weiter:
„Ich weiss, es war ein Fehler, das Geld für die Geschenke auszugeben …“
Nach einer kurzen Pause erklärt Frau M.:
„Wissen Sie, normalerweise reicht das Geld bis Ende Monat. Nur zum Sparen reicht es nicht. Ich muss gut einteilen. Sobald ich die Renten erhalte, bezahle ich die Rechnungen und mache mir eine Liste mit den teuren Einkäufen, wie zum Beispiel Olivenöl, Kaffee, Bouillon, Haarspray und wenn nötig, Kehrichtsäcke etc.. Danach weiss ich, wie viel ich für Lebensmittel ausgeben darf.“
„Und manchmal, da reicht das Geld sogar noch für eine oder zwei Zeitschriften. Ich habe eben gerne wahre Geschichten, wie zum Beispiel ‚Mein Leben/Das packende Erlebnismagazin‘ oder ‚Meine Wahrheit/Schicksalsreporte‘. Ich lese diese Geschichten gerne, weil sie mich nicht belasten. Viel lieber eine solche Geschichte lesen als einen Krimi schauen im Fernsehen.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Kaffeestube an Weihnachten
Auf den gerillten Biberschwanzziegeln des Daches, Eiskristalle
wie winzige Menhire, die jemand über Nacht dorthin gesetzt hat;
im schmalen Sonnenstreifen funkeln sie für wenige Minuten lang.
Ob sie mir eine Karte schreiben dürfe, fragte sie mit leuchtenden Augen aus einem mit Sommersprossen übersäten Gesicht.
„Selbstverständlich“, sagte ich und schrieb meine Adresse in der mir schönst möglichen Schrift, in weiten und gerundeten Bögen.
Seit zwei Jahren wohne sie wieder bei ihren Eltern. Das Wohnheim, in dem sie gelebte habe, sei geschlossen worden.
„Ich habe die Menschen dort richtig lieb gewonnen. Ich wäre vor lauter Trauer am liebsten im Boden versunken, als ich gehen musste.“
Plötzlich spürte ich ihre Trauer.
In den Boden versinken.
Wo es dunkel ist.
Gleichzeitig erahnte ich, welche Bedeutung es für sie haben könnte, jemandem, der das Leuchten in ihren Augen wahrgenommen hat, eine Karte zu schreiben.
„Sie müssen aber Geduld haben“, sagte sie mit mädchenhaftem Lächeln, „bis Sie eine Karte erhalten.“
Auf dem Dachgestänge, welches den Schnee am Rutschen hindert,
ein Eiskristall, das hell funkelt, im Gang er Sonne aber übergangslos
die Grundfarben durchspielt und nach wenigen Minuten verglimmt.
Er habe im Dom Weihwasser geholt und dabei das Plakat mit der offenen Kaffeestube entdeckt. Da sei er schnell reingekommen.
„Seit meine Frau vor sechs Jahren gegangen ist ...“
„Ist sie gestorben?“
„Nein.“
Er lächelte ironisch und fügte hinzu: „Sie wollte sich selbst verwirklichen ... Hätte die Gebenedeite Mutter Maria je ihre Familie verlassen, um sich selbst zu verwirklichen? Wo doch die Verwirklichung im Kind selbst liegt“, empörte er sich.
Inzwischen verstünden sie sich gut, morgen feierten sie Weihnachten gemeinsam mit den Kindern.
Es blieb lange Zeit still. Um die Beklemmung zu durchbrechen, fragte ich ihn, was er denn sonst im Leben mache.
„Ich bin pensioniert.“
„Tatsächlich? Sie sehen aber sehr rüstig aus für einen pensionierten Mann!“
„Wissen Sie, man sieht nur von aussen heran, aber nicht hinein.“
Vor sechs Jahren, ja, es sei Monate nach der Trennung gewesen, habe er sich plötzlich so komisch gefühlt, irgendwie sei ihm übel gewesen. Er habe sich ins Bett gelegt und im Magen einen Klumpen gespürt, als habe er Fondue gegessen und danach kaltes Wasser getrunken. Am nächsten Morgen habe er den Arzt angerufen, der habe ihn von der Arztpraxis direkt in den Notfall bringen lassen. Es sei ein Herzinfarkt gewesen und er habe noch am gleichen Tag einen Bypass erhalten.
„Vor drei Jahren musste ich mich wieder operieren lassen: Raucherbein, eine typische Diabetikerkrankheit. Sie mussten mir eine künstliche Arterie einsetzen. Im Neuen Jahr muss ich wieder in den Spital. Vielleicht müssen sie mir einen Herzschrittmacher einsetzen ... Da rauchst du nicht, da trinkst du nicht, du frisst auch nicht unter dem Haag durch – und jetzt das.“
Die Einsamkeit, nachts, von Glockenschlag zu Glockenschlag, Angst vor dem Klumpen im Magen, Angst, das Bein könnte abfaulen, Angst, das Herz könnte plötzlich stillstehen.Die Strassenlampen löschen, der Schatten des Fensterkreuzes an der Decke ist verschwunden, diffuses Licht bleibt im Sonnenvorhang hängen.
Angst vor dem Verglimmen ohne dass jemand das Licht, das Spektrum des eigenen Lichts, überhaupt wahrgenommen hätte.
„Irgendwann bin ich trotzdem eingeschlafen. Ich weiss nicht, wie lange ich liegen geblieben bin. Was sollte ich, am Weihnachtstag, alleine? Schliesslich bin ich trotzdem aufgestanden, wollte mich mit geweihtem Wasser bekreuzigen – aber das Weihwassergefäss mit der heiligen Mutter Gottes war leer.“
Wenn du nachts durch die Stadt gehst, leuchten sie vom Teer,
die Eiskristalle, als gingest du über einen Sternenhimmel,
dessen Sternenbilder mit jedem Schritt sich verwandeln.
Wegen ihrer fortgeschrittenen Polyarthritis kann sie die Stöcke nicht mehr halten; sie braucht horizontal geführte Unterarmstützen, die sie mit einem Klettverschluss befestigt. Wenn es sehr kalt ist, kann sie ihre Haustüre nicht öffnen, dann muss sie warten ...
„ ... bis ein Gentleman mir die Türe öffnet -
Sagen Sie, bin ich unfreundlich? Kürzlich im Bus hat mich eine angeschnauzt, ich könne sie auch in einem anständigen Ton fragen. Ich stand im Gang zwischen den Sitzreihen und wusste, der Bus fährt gleich ab. Da wandte ich mich an die erstbeste Frau, die ich sitzen sah – mag sein, dass es ein wenig barsch klang, unfreundlich sogar, aber ich hatte doch Angst, ich falle hin, wenn der Bus losfährt, und purzle durch den Gang.“
Vor der Haustüre warten, bis jemand die Türe öffnet, im Bus warten, bis jemand aufsteht, morgens warten, bis die Pflegefachfrau von der Spitex kommt. Immer einen freundlichen Ton finden. Immer stark bleiben im Hilfe erbitten. Immer sich bedanken. Und an Weihnachten in einer Kaffeestube alleine an einem Tisch sitzen.
„Sagen Sie, bin ich unfreundlich?“
Sie überziehen die Ziegel mit hauchdünner weisser Schicht,
die Eiskristalle, an anderen Stellen des Dachs wachsen
sie zu Splittern empor: Welcher Luftströmungen wegen?
Mit leicht vorgebeugtem Oberkörper und einer dicken Glasbrille auf der Nase, die in er Wärme anlief, betrat er die Kaffeestube. Erst jetzt bemerkte ich seinen Rucksack und den Mann hinter ihm, der älter war und zur Begrüssung nur kurz Augenkontakt mit mir aufnahm, um gleich wieder auf den Boden zu schauen.
Ob sie hier übernachten könnten, fragte der Mann mit der Brille in gebrochenem Englisch. Er putzte seine Brille und setzte sie wieder auf.
Wir seien eine Kaffeestube, antwortete ich, aber sie sollten doch hereinkommen, einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen.
„Ich komme Ungarn“, erzählte er. „Ungarn schlecht. Ich Automechaniker, verdiene zweihundert bis zweihundertfünfzig Euro im Monat. Wenig, sehr wenig. Ich gespart, nach Portugal gefahren, Arbeit suchen, Spanien, Frankreich, Schweiz, aber keine Arbeit finden. Ich überall zuhause, aber ohne Arbeit?“
Sie hätten nur noch wenig Geld, ein Hotel in St. Gallen sei viel zu teuer. Gestern seien sie in der Weihnachtsmesse gewesen, das sei schön gewesen, sie hätten zwar kein Wort verstanden aber die Lichter und Wärme hätten ihnen wohl getan. Sie seien wohl die einzigen im Dom gewesen, die gespürt hätten, wie warm die anderen Menschen geben. Danach seien sie durch die Stadt geirrt, hätten einen warmen Platz gesucht, ja, wenn sie nur ein bisschen von dem Stroh gehabt hätten, das für die Krippen in den Schaufenstern verwendet wird. Im Bahnhof hätten sie sich auf eine Bank gelegt, seien dann aber von dort wieder vertrieben worden.Der ältere Mann sagte kein Wort, schaute nur auf den Teller, der inzwischen leer war.Sie seien sich unterwegs begegnet, er komme auch aus Ungarn, spreche aber kein Wort Englisch oder Deutsch. Er sei Lastwagenfahrer, suche auch Arbeit.
„Ich überall zuhause. Mutter mag mich nicht, Vater kenne ich nicht. Meine Grossmutter habe ich vor zehn Tagen besucht, und wieder losgereist, über Wien. Jede Haltestelle ausgestiegen, weil Kondukteur mich erwischt. Ich kein Geld für Billett. Und jetzt hier.“
In der Herberge zur Heimat war noch ein Zimmer frei für zwei Personen. Sie bedankten sich herzlich, der ältere Mann mit Kopfnicken, und verabschiedeten sich nach dem zweiten Stück Kuchen. Sie seien müde, sie wollten sich jetzt nur hinlegen und schlafen.
Bei stabiler Hochdrucklage sind die Temperaturen leicht angestiegen,
die Eiskristalle verschwunden, aber zwischen Grasbüscheln liegen sie zusammengeklumpt, Grashalme mit dünner Eisschicht umschliessend
Mit neun sei sie bei einem Wettrennen von der Kletterstange gefallen, sie hätte tot sein können. Stattdessen sei sie im Rollstuhl gelandet, habe alles wieder lernen müssen: aufstehen, sich anziehen, gehen, einfach alles. Die Ärzte hätten ihr ein Jahr vorausgesagt, sie habe es in einem halben geschafft. Mit sechzehn habe sie auf einem Bauernhof gearbeitet, mit Metzgerei und Restaurant. Mit zwanzig habe sie geheiratet. Ihr Mann habe eine kleine Firma gehabt, viel mehr als eine Werkbank sei es nicht gewesen; er habe Teile gedreht für grössere Firmen. Sie habe fünf Kinder grossgezogen, gekocht, gewaschen und ihrem Mann in der Firma geholfen, Lieferscheine geschrieben und später die Büros geputzt. Als dank dafür habe er sich eine andere angelacht. Der Jüngste sei zwanzig gewesen, als sie sich habe scheiden lassen. Mit dem zweiten Mann habe sie nicht viel mehr Glück gehabt. Er sei zwar ein netter gewesen und sie hätten ganz schön was zusammengespart, aber nach drei Jahren Ehe sei ausgekommen, dass er in seinem Herkunftsland bereits eine Familie habe. Vor einem Jahr sei er in sein Land gereist, als ob er gespürt hätte, dass er bald sterben würde. Er habe einen Herzstillstand gehabt, sei plötzlich tot umgefallen. Ihr gehe es zwar gut, aber eben, mit dem Alter liessen die Kräfte nach und die verschiedenen Operationen seien auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
„Aber Morgen“, sagte sie lächelnd, „morgen bin ich bei meinem jüngsten Sohn eingeladen. Er kocht besser als seine Frau. Ich habe eben bei der Erziehung darauf geachtet, dass sie putzen, waschen und kochen können.“
Jeder Augenblick ist von dem einen Autor des einen Buches.
Wenn der Augenblick vergangen ist, ist er nicht ausgelöscht.
Er setzt über den Strom des Vergehens, indem er neu sich übersetzt.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Entschlüsseln
Mein Besuch bei den zwei alten Frauen hätte eigentlich eine kurzes angenehmes Unterfangen werden sollen, denn sie hatten zwei Steuererklärungen zu unterschreiben, die ähnlich waren wie letztes Jahr, nur dass ihr Vermögen um 3'000.- Franken angewachsen war. Und das, obwohl sie nicht einmal die ganze AHV-Rente erhielten. Nachdem ich an der Haustüre, wie vereinbart, zweimal geläutet hatte, mir ein Summton Einlass gewährte, drückte ich die Klingel neben der Wohnungstüre. Diese öffnete sich einen Spaltweit und als die alte Frau mich erkannte, wollte sie die Türe ganz öffnen, doch schlug diese metallisch klingend an. Mit einem Ruck versuchte sie, die Türe nochmals zu öffnen, die abermals anschlug, noch lauter, sodass es durch den ganzen Block hallte.
„Was ist?“, hörte ich ihre Schwester krächzen.
„Ich bringe die Türe nicht auf!“
„Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Sicherheitsschloss sein lassen!“
Jetzt versuchte sie die Türe aufzureissen, der Bolzen aber, der seitlich an der Türe befestigt war, glitt durch den Spalt eines metallenen Teils, das am Türrahmen befestigt war, und schlug an. Es vibrierte durch den ganzen Block, sodass ich sogar glaubte, die in den Beton eingelegten Eisenstangen zu hören.
„Was soll ich denn tun?!“, quiekte die kleine Frau, riss nochmals und nochmals an der Türe.
„Ganz ruhig“, sagte ich und glaubte, einen schlauen Plan zu besitzen. Es müsste doch irgendwie gelingen, den Bolzen aus dem Spalt zu drücken. Ich bat sie, die Türe nur einen klitzekleinen Spalt offen zu lassen, damit ich von der Seite das metallene Teil herausdrücken könne. Es gelang einmal, zweimal, dreimal, viermal nicht.
„Jetzt kommen wir nicht mehr aus der Wohnung“, krächzte die Schwester aus ihrem Zimmer.
„Was soll ich den tun?“ brüllte die andere zurück.
„Der Polizei anrufen.“
„Warten Sie, warten Sie ...“, bat ich, ohne eine Idee zu haben.
„Telefoniere der Hauswartin!“
„Ist sie hier im Haus?“, fragte ich.
„Gleich im oberen Stock.“
„Ich bin gleich zurück.“
Ich stieg die Treppe hoch, hörte die Türe immer heftiger gegen das metallene Teil schlagen, hörte die beiden immer lauter keifen. Mich überraschte, dass niemand im Block nachschauen wollte, was los war. Die Hauswartin war nicht da.
Ich rannte die Treppe hinunter und versuchte, die kleine Frau hinter der Türe zu beruhigen.
„Du verstehst nichts, nie verstehst du etwas!“, schrie die Schwester aus ihrem Zimmer.
Wenn ich verstünde, wie das Schloss funktionierte! Ich versuchte mich zu erinnern, wie die Türe von innen aussieht, jedoch kein klares Bild wollte sich einstellen. Wahrscheinlich war ich jeweils so sehr damit beschäftigt, die stickige Wohnung zu verlassen, dass ich das Sicherheitsschloss nicht achtete. Es blieb mir nichts anderes übrig, als bei den Nachbarn zu fragen. Auf demselben Stock niemand. Auf dem nächsten Stock niemand. Einen Stock höher dann hörte ich Schritte hinter der Türe. Ein Mann öffnete einen Spaltweit und ich, begierig zu sehen, wie das Sicherheitsschloss funktionierte, näherte mich ihm zu schnell, bemerkte es, erklärte, ich wolle nur wissen, wie das Sicherheitsschloss funktioniere, und sah plötzlich nackte Angst in seinen Augen.
Ich wich zurück und versuchte zu beschwichtigen:„Wissen Sie, ich bin Sozialarbeiter und betreue zwei alte Frauen, die im selben Block wohnen und die Türe nicht mehr aufbringen.“
Durch den Türspalt erklärte er mir, wie ich das Sicherheitsschloss öffnen könne.
Ich stieg die Treppe hinab und erklärte der alten Frau hinter der Türe, auf deren linken Brillenglas das Licht des Ganges spiegelte, sodass ich ihr Auge nicht sehen konnte, links oben befinde sich ein Drehknopf, den sie nach rechts drehen müsse – aber erst nachdem sie die Türe geschlossen habe. Zwei-, dreimal probierten wir, dann gelang es, die Türe öffnete sich und ich fühlte mich wie Ali Baba, der sich durch ein Zauberwort den Zugang zu einem überwältigenden Schatz verschafft hat.
„Das haben Sie gut gemacht“, sagte ich.
Sie strahlte wie ein Mädchen, das vom Lehrer dafür gelobt wird, dass es ein Gedicht völlig korrekt bis zur letzten Zeile aufgesagt hat.
„Aber morgen hast du es wieder vergessen“, krächzte ihre Schwester aus dem Zimmer.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Krankenzimmer Nummer 326
Ein Glitzern durch den Spalt ihrer Augenlider. Ihr Mund eingesackt zwischen hervorstehendem Kinn und Nase. War diese immer schon leicht nach rechts gebogen? Die Gesichtsfarbe fahl wie ein staubiger Landweg, den Grautönen der Haare schon sehr nah. Ein Gerät lässt aus blubberndem Gefäss Dampfschwaden durch einen Schlauch vor ihr Gesicht strömen. Vor ihrem Zimmer steht eine Hagenbuche, hoch und mächtig, ihr Wipfel auf der Höhe ihres Fensters, ihre Knospen klaffen hellgrün auf. Würde ich dies ertragen, angesichts meines Todes, dieses aufblühende Leben vor dem Fenster? Empfände ich es nicht als Spottlied über alle meine Anstrengungen, die ich in meinem Leben unternommen habe? Zumal mir die Gründe für meine Anstrengungen wohl kaum mehr bewusst wären.Ihre Arme liegen schlaff neben ihrem Körper auf der Bettdecke. Ich berühre ihre Hand, streichle ihren Unterarm. Ihre frisch gecrèmte Haut scheint von den Knochen wie abgelöst zu sein. Ich spreche mit ihr, sie reagiert nicht. Einmal atmet sie tief ein, ich habe Angst, Angst, sie könnte jetzt gleich ihr ganzes Leben ausatmen. Dann atmet sie wieder, regelmässig. Ihr Tod ist schon lange erwartet worden. Der Arzt meinte vor vier Wochen, sie würde das Wochenende nicht überleben. Wie ist es möglich, dass ein Mensch so lange von Wasser allein lebt? „Sie hat ein starkes Herz“, sagte eine Bekannte, „das schlägt und schlägt und schlägt ...“ Inzwischen hat auch die Krankenkasse interveniert: Die Kostengutsprache gelte noch für eine Woche. Sie lebt. Im Krankenzimmer Nummer 326. Auf einer Insel der Stille. Ich höre Verkehrslärm von draussen, Stimmen jetzt, Rufen eines Kindes. Putzgeräusche von der Nasszelle nebenan. Das Rauschen des Dampfgerätes. Über ihr, am sogenannten "Galgen", hängt eine Hahn. Das Stofftier hatte sie nächtelang in Armen gehalten. Diese Stille wie ein Spiegel, auf dem jede Wahrnehmung im Formlosen entschwindet. Das einzige Wort, das sie noch sagen kann, ist nein. Nein, nein, wenn sie Albträume plagen. Nein, nein, wenn sie umgelagert wird.
Ihr Herz schlägt. Es braucht Widerstand, auch den Widerstand der Gefässe, die ihr Blut zirkulieren lassen. Würde sie ohne dieses Nein sterben? Leben wir so lange, bis wir unser letztes Nein aufgeben?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Ich möchte Klavier spielen lernen
Gestern kam eine Frau in die Beratung, um den Fragebogen mit mir auszufüllen. Sie ist mit dreiundzwanzig Jahren in die Schweiz gekommen und arbeitet seit Jahrzehnten als Fabrikarbeiterin. Ihre Träume, einen Mann zu finden, haben sich zerschlagen. Sie lebt allein, besucht alle drei bis vier Jahre ihre Verwandten im Heimatland.Der Fragebogen, erzählt sie, habe ihr den Kindertraum bewusst gemacht: Sie habe immer schon Klavier oder Akkordeon spielen wollen. Aber die Eltern seien sehr arm gewesen, mit vierzehn Jahren habe sie arbeiten müssen. Jetzt habe sie genügend Geld, um sich Klavier- oder Akkordeonunterricht zu leisten. Ob ich ihr helfen könne, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu finden?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Man rechnet eben doch nicht damit
Wir haben es gut gehabt miteinander. Er war ein guter Mann. Da ich in meiner Kindheit als älteste immer zu meinen sechs Geschwistern schaute, wollte ich mit meinem Mann keine Kinder haben. Er war damit einverstanden.
Mein Mann ging zur Arbeit – ich machte den Haushalt. Er machte das Budget. Er konnte es nicht leiden, wenn ich ihm Fragen stellte über die Einzahlungen oder den Lohn. Dafür war er zuständig.
Manchmal waren wir körperlich beieinander. Aber das war in unserer Ehe nicht so wichtig. Wir haben vor allem viel miteinander geredet. Wir konnten gut sprechen miteinander – das war schön.
Und jetzt ist er gestorben. Klar, er war schon älter, 82-jährig, aber man rechnet eben doch nicht damit.
Ich vermisse ihn. Er fehlt in jeder Ecke meiner Wohnung. Es ist, als sei ein Stück aus mir herausgerissen worden.
Bisher konnte ich ihn nicht besuchen an seinem Grab, ich hatte Angst davor. Letzte Woche war ich zum ersten Mal. Es hat mir gut getan, ihn zu besuchen da oben im Ostfriedhof – und mit ihm zu sprechen.
Es ist sehr schwer dieser Abschied – aber jetzt spüre ich, das Gröbste ist vorbei.
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Weihnachtszeit - Bettelbriefzeit
Wie ist die Geschichte entstanden? - All die Absender von Bettelbriefen, die einem emotional – oft auch mit Bildern – zu erreichen versuchen, die um Mitgefühl, Betroffenheit und Solidarität werben, sich dabei aber des Adressaten gar nicht bewusst sind - diesem Widerspruch möchte ich Luft verschaffen.
Die 99-jährige Frau lebt alleine. Dreimal am Tag kommt eine Gesundheitsschwester von der Spitex vorbei. Ab und zu besucht sie eine Nachbarin. Und ich alle vierzehn Tage, um ihre finanziellen Angelegenheiten zu erledigen.
Sie sitzt am Küchentisch, breitet die Arme wie zum Segen aus, als sie mich unter der Türe stehen sieht. Worte purzeln durch ihr Gehirn, aber sie kann sie nicht mehr fangen und aneinanderreihen zu einem Satz.
Ich setze mich zu ihr. Sie legt meinen Handrücken in ihre linke Hand, legt ihre Rechte darauf, streift darüber, klatscht auf meine Hand, verweilt, streift darüber, klatscht, verweilt.
„Der Mann, der mich besucht“, krächzt sie heiser wie eine Türe, die schon lange nicht mehr geöffnet wurde.
Mit dem Mittelfinger zeichnet sie eine Spirale in die Luft. Vor einem Jahr hätte sie dazu gesagt: „Ich dumme, alte Schachtel.“, inzwischen hat sie die Worte vergessen.
Wir stecken unser Köpfe zusammen, Stirn an Stirn. Die Zeit steht still, wie ein ruhender Weiher, der die Vergänglichkeit spiegelt. Nur das Ticken der Uhr auf dem Küchentisch.
Sie legt ihre rechte Hand auf den Küchentisch, ich meine auf die ihre, sie legt ihre linke drauf, ich die meine – und so bauen wir in unterschiedlichen Rhythmen am Turm unserer Hände.
Draussen gehen Knaben und Mädchen vorbei, werfen sich Schneebälle nach.
Ich stehe auf, hole die Post in der Stube.
Jedes Kind zählt, Kindernothilfe
Hilfe für die Pfarrei St. German Rechthalten FR, Erhaltung von Schweizer Kirchen
Machen Sie mit uns Dampf, dampfbahn furka bergstrecke
100'000 Menschen leben in der Schweiz mit einer Hirnverletzung, fragile suisse
Kein Mädchen darf mehr genital beschnitten werden, unicef
BioVision sagt der Malaria den Kampf an, ist das vermessen?, BioVision
Für die Freunde und Förderer der Weltkinderdörfer der „Schwestern Maria“
Jede zehnte Frau ist betroffen, gemeinsam gegen Brustkrebs, IBCSG
Jugendliche retten eine Wasserleitung im Tessin, Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz
Weil unsere Kraft nicht mehr ausreicht, Wiederaufbau der Kirche San Giuliano
Es braucht wenig, um einem an Lepra erkrankten Menschen zu helfen, evangelische Lepra-Mission
Ein Herz für Tiere, Schweizer Tierschutz
Ich will an Weihnachten zuhause sein, Krebsliga
Zuviele Neuinfektionen an Aids betreffen Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren,
Das Bildungssystem kann eine präventive Rolle spielen, Unesco
Ein neues Zuhause – ein Leben ohne Angst, Missionsbrüder des hl. Franziskus
Wissen ermöglicht Zukunft – auch für die Bauern in Moldawien, Heks
Schenken wir den Kindern ein Weihnachtsfest, Hilfe für Kinder im Nordosten
Brasiliens
Überall auf dieser Welt brechen neue Konflikte auf, Stiftung Welt ohne Minen
Das Kloster Maria Zuflucht in Weesen braucht weiterhin Ihre Hilfe, Erhaltung von Schweizer Kirchen
Weihnachten in unseren Kinderheimen in Fatima und Lissabon, Stiftung Kinderwerk Lissabon
Herbergsuche heute, Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind
Ich wünsche mir, dass mein Mami wieder einmal lacht, Aids-Hilfe Schweiz
Epilepsie und Medikamente, Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Viele Cleft-Kinder warten in Bombai auf ein neues Gesicht, Hilfe für Kinder mit
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
Babys das Leben sichern, unicef
Wir bitten Sie um ihren Passiv-Mitgliederbeitrag, Samariterverein
Die umfangreichen Arbeiten für die künftige Bibliothek und das Archiv sind im Gang, Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair GR
Wir bitten Sie um Hilfe für die Überschwemmungsopfer in Nordkorea, Flüchtlingshilfe der christlichen Ostmission
Als Dienst am Glauben leidgeprüften Menschen beistehen, Kirche in Not, Luzern
Es gibt keine Worte, die Qual, die Angst und das Eldend der Tiere auf ihren
Höllenfahrten zu beschreiben, Fondation Franz Weber
Gefrorene Embryos suchen Wärme, Verein Mamma
Erfüllen Sie Abels Wunsch, in die Schule gehen zu können, Internationales
Katholisches Missionswerk
Bildung wird immer wertvoller, Stiftung pro Stiftschule Einsiedeln
Im Dienste der Armen, Missionare des heiligen Franz von Sales
Wie Laetitia wieder lachen lernte, Leprahilfe Emmaus Schweiz
Kirche in Mund – wegen Asbest geschlossen, Stiftung Pro Conservatione Sacri
Kampf gegen die unmenschliche Vivisektion, Schweizer Liga gegen Vivisektion
Damit sich auch die Bergbevölkerung in der Schweiz auf das kommende Jahr freuen kann, Patenschaft Berggemeinden
Hilfe für die Kirche St. Sebastian in Silgin im Lugnez (GR), Erhaltung von Schweizer Kirchen
Doch die Chorherrengemeinschaft möchte nicht ruhen, da weitere Bauten auf die Rettung warten, Stift St. Michael Beromünster
Sommerzeit: Hochbetrieb bei der Tierambulanz, Tierambulanz-Verein, Hüttikon
Ein riesiges Dankeschön und eine Bitte, Stiftung zur Erhaltung schweizerischen
Kulturgutes
Die Alpen – unberührte Natur?, Schweizerische Vogelwarte Sempach
Ich setze mich wieder zu ihr an den Küchentisch. Sie legt meinen Handrücken in ihre linke Hand, legt ihre Rechte darauf, streift darüber, klatscht auf meine Hand, verweilt, streift darüber, klatscht, verweilt.
Mit dem Mittelfinger zeichnet sie eine Spirale in die Luft. Sie nickt, ich nicke, wir wissen beide, dass sie die Worte vergessen hat. Sie legt ihre rechte Hand auf den Küchentisch, ich meine auf die ihre, sie legt ihre linke drauf, ich die meine – und so bauen wir in unterschiedlichen Rhythmen am Turm unserer Hände.
Wir stecken unser Köpfe zusammen, Stirn an Stirn. Die Zeit steht still, wie ein ruhender Weiher, der die Vergänglichkeit spiegelt. Nur das Ticken der Uhr auf dem Küchentisch. Es ist Zeit für mich zu gehen, im Büro wartet Arbeit. Die 99-jährige Frau lebt alleine. Dreimal am Tag kommt eine Gesundheitsschwester von der Spitex vorbei. Ab und zu besucht sie eine Nachbarin. Und ich alle vierzehn Tage. Aber ihr Briefkasten ist stets voll.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Goldadern im sozialen Gefüge
Wie ist die Geschichte entstanden? – Zu jener Zeit, als ich die Geschwister besuchte, las ich meinem Sohn eine Geschichte über die Goldgräber am Yukon vor. Plötzlich schien mir „nach Goldadern graben“ eine treffende Metapher zu sein für das, was ich bei meiner Arbeit tue. Und ich versuchte, die Hartnäckigkeit und Geduld jener Goldgräber auf meine Arbeit zu übertragen.
Sozialarbeiterinnen als Goldgräber?
Manchmal scheint mir, es fehle mir an Geduld, um wie die Goldgräber ein Claim abzustecken, einen Stollen zu graben und das Gestein sorgfältig zu sieben bis endlich einmal – wenn überhaupt – einige Goldnuggets im Wasser glitzern.
Nach vielen Besuchen bei zwei älteren Geschwistern, die beide das achtzigste Lebensjahr überschritten haben, nach vielen Gesprächen, die sich um Krankenkassenselbstbehalte, Umgang mit der Postomat-Karte, Steuererklärungen, Wäscheplan und ähnliches drehten, erzählten sie mir, sie hätten beide einmal Akkordeon gespielt.
Streng sei der Lehrer gewesen, aber sie hätten viel gelernt.
„Wunderschön ist es, wenn Akkordeons zusammenklingen!“
Zum ersten Mal erlebte ich die beiden Schwestern entspannt, auch zueinander, zum ersten Mal sah ich ein Leuchten in ihren Augen.
„Aber jetzt können wir beide nicht mehr spielen.“
Ob sie wieder einmal Akkordeonmusik hören wollten, fragte ich sie.
„Ja, das wäre schön. Am liebsten etwas Klassisches.“
Des Goldgräbers Hoffnung, der Claim, war abgesteckt. Im Verlauf der Woche ging ich in ein Musikgeschäft und grub – weil die beiden Schwestern nur einen Kassettenrekorder besassen – nach einer Kassette mit klassischer Akkordeonmusik, fand aber keine, nur eine CD. Ich kaufte sie trotzdem, schliesslich bin ich als Goldgräber gut ausgerüstet, sprich: ich habe Zugang zu einem alten CD-Gerät, das ich tags darauf zu den beiden schleppte.
Voll freudiger Erwartung schob ich die CD ins Gerät, drückte play und sah innerlich bereits, wie die Goldnuggets im Sieb sich verfingen, wie ihre Augen aufleuchteten, wie rhythmisch wellende Bewegungen ihre Körper erfassten. Stattdessen hockten sie bocksteif da, auch nach zwei Minuten noch, und die ältere Schwester schaute stets auf die jüngere.
„Sie hört nichts“, krächzte sie laut.
„Ich höre nichts“, sagte die Jüngere und schüttelte den Kopf.
„Wissen Sie, wenn sie nichts hört, dann kann ich auch nicht zuhören.“
Ich stellte das Musikgerät ab. Vielleicht lag der Claim am richtigen Ort, aber die Goldader tiefer im Berg. Es wird wieder viele Gespräche benötigen, um die jüngere Schwester dazu zu bewegen, zur Hörmittelzentrale zu gehen – wenn sie sich überhaupt überzeugen lässt. Jedoch weshalb sollte ein sozialer Goldschürfer früher aufgeben als die Goldgräber von dazumal?
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Aber versuchen will ich ihn
Wie ist die Geschichte entstanden? – Noch bevor ich in einen zweimonatigen Urlaub fuhr, drängte mich etwas, diese Geschichte niederzuschreiben. Ich wollte trotzig dem Tod ein Schnippchen schlagen, denn wenn ich zurückkäme und er wäre schon tot, bliebe kaum eine Spur von ihm.
Der alte Mann sitzt auf dem Bett vor dem Fernseher mit einem Kopfhörer an. Ich bin überrascht, dass er mich trotzdem klopfen gehört hat.
Vom Zimmer aus sieht man den Kirchturm, dessen Glocke er mit anderen Jungen vor über siebzig Jahren hochgezogen hatte.
Am Fernseher Frauen mit tiefen Ausschnitten, glitzernden Kleidern und einem Lächeln, das ihm eine Zeit vorschmeichelt, als ihm die Frauen noch verführerisch und geheimnisvoll erschienen.
An der Wand hängt ein Bild von Molliet, eines von Macke, beide echt, wie er mir versicherte, als sie noch in seiner Wohnung hingen und er mir eine Mappe mit Skizzen von Schiele auf dem Stubentisch ausbreitete, alle echt, für jede einzelne bekäme er mindestens zehntausend Euro.
Gestern hat mich seine Enkelin angerufen: sie sei froh, für den ganzen Plunder in seiner Wohnung wenigstens ein paar Franken zu erhalten.
„Sollen wir ins Bistrot gehen?“, schlägt er vor.
Er steht auf, zieht seine Hosen hoch, bleibt stehen, schnallt den Gürtel enger, der ihm dann doch wieder zu eng ist und steckt den Dorn durch dasselbe Loch wie vorher. In kleinen Schritten tippelt er zur Zimmertüre, vergisst, seinen Kopfhörer abzulegen, wird durch das Zurückhalten des Kabels daran erinnert.
Im Bistrot sitzen alte Frauen, die vor sich hinrauchen, Augen, welche die Schatten eines verengenden Tals spiegeln, Mundwinkel, die das Gewicht unverziehener Erfahrungen hängen lassen.
Der alte Mann braucht eine Weile, bis er eine Zigarette aus dem Päckchen geklaubt hat, zündet sie an mit einer Geste, die unglaublich schnell und gewandt wirkt, als hätte jemand für einen kurzen Augenblick den Film schneller laufen lassen. Er pafft den Rauch aus, zieht einen Teil in die Lunge und bläst ihn über den Tisch.
„Hier tut es weh“, sagt er und kneift sich in die rechte Hüfte unterhalb der Rippenbögen. Er nimmt einen Zug, pafft den Rauch aus und kneift sich wieder in die Seite als wollte er mir sagen:
„Vertreibe endlich diesen lästigen Schmerz!“
Ich beuge mich vor und er führt meine rechte Hand zu der schmerzenden Stelle.
„Hier“, sagt er.
Ich spüre eine Verhärtung, einen Knollen. Mir schauderts, als hätte diese Berührung ausgelöst, dass ich vor mir die Diagnose des Arztberichtes sehe:
Inoperabler Dickdarmkrebs.
Es ist dieselbe Stelle, die mir oft weh tut, deretwegen ich vor Jahren meinen Dickdarm habe spiegeln lassen. Der Knollen jetzt, als sässe er in mir.
Nachdem ich ihm die Zahlungsaufträge vorgelegt habe und er die Kündigung für den Telefonanschluss unterschrieben hat, frage ich ihn:
„Sollen wir spazieren gehen?“
Ein geteerter Weg mäandert durch eine frühlingsgrüne Wiese hinab zu einem Bach. Er bleibt stehen, zieht seine Hosen hoch, will seinen Gürtel enger schnallen und steckt den Dorn schliesslich wieder in dasselbe Loch wie vorher. Er gräbt in seiner Hosentasche nach dem Päckchen Zigarette, zieht es heraus und steckte sich – dieses Mal gleitet die Zigarette auf Fingerdruck aus dem Päckchen – eine an. Sein Blick fällt auf die Dachterrasse des Altersheims, hinter der sich der Kirchturm erhebt.
„Als bildeten sie eine Einheit“, sagt er, pafft den Rauch aus und tippelt weiter.
Eine Einheit. Der Kirchturm, in dem er vor über siebzig Jahren den Glockenturm hochgezogen hatte, und die Terrasse des Alterheims, in dem er jetzt lebt.
Ist es die Angst vor dem Tod, die uns das Leben als Einheit, als in sich schliessender Kreis interpretieren lässt, oder ist es die Nähe des Todes, die uns Verkrümmtes als in sich geschlossen, als vollkommen erkennen lässt?
Ich erinnere mich an ein Gedicht von Rilke:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen
aber versuchen will ich ihn
und glaube die Zeit reif für ein philosophisches Gespräch, weshalb ich ihm jene Frage stelle, die mich in ähnlichen Situationen schon oft zu unterwarteten Schätzen geführt hat:
„Welchen Rat würden Sie einem jungen Schnösel wie mir geben, worauf soll ich achten?“
„Ich weiss es nicht.“
Wir setzen uns auf eine Bank. Er kneift sich in die Hüfte.
„Ich bin ein bisschen plem-plem“, sagt er und spricht plem-plem aus, als mache er eine Sprechübung, bei der es darum geht, Zunge und Lippen möglichst locker zu lassen.
Es ist der erste warme Frühlingstag nach einem langen Winter. Ein Schwarm weisser Blumen steht in der Wiese nahe einer Tanne – Waldanemonen? Ihre Blüten zittern im Wind – zittern? Kitschig erscheint mir das Wort in diesem Zusammenhang, es müsste doch ein besseres Wort geben.
„Schauen Sie, nein, schon zu spät – jetzt wieder!“
Er deutet auf den Schwarm weisser Blumen im Wind und beginnt mit brüchiger Stimme zu singen:
„Die weissen Blümchen zittern...“
Sein fahlfarbenes Gesicht fügt sich unscheinbar in die Parkanlage ein. Er stösst seine Zungenspitze durch die Lippen wie eine Echse, die auf Beute lauert. Meine Gedanken, die sich ewig glauben, haben die Echse nicht bemerkt und werden wie fette Alltagsfliegen vor meinen Augen weggefressen.
„Ich habe Durst“, sagt er, „ich könnte einen ganzen Fluss in mir verschwinden lassen.“
„Sollen wir ins Bistrot etwas trinken gehen?“
„Nein, gehen wir ein Stück weiter.“
Nach wenigen Schritten bleibt er stehen, zieht seine Hosen hoch, öffnet den Gürtel, versucht ihn enger zu schnallen und schliesst ihn wieder im selben Loch. Er kneift sich in die Seite, dort, wo die Geschwulst wächst.
„Haben Sie Angst vor dem Tod?“
„Nein. – Warum, Sie schon?“
„Ja.“
„Dann haben Sie was angestellt.“
„Nein, es ist vielmehr seine Endgültigkeit, die mir Angst macht. Alles nimmt er mir aus der Hand.“
Vor dem Bach, welcher die Südseite des Parks begrenzt, hält er inne.
„Schön“, sagt er.
Er sagt dies aus einer Tiefe, die sein ganzes Leben zu umfassen scheint, alle Volkslieder und Gedichte, welche die Schönheit eines Baches beschwören, alle Augen, welche die Schönheit eines Baches gesehen oder sie erahnt haben, und das Wort schön, kaum hat er es gesagt, löst sich auf im Murmeln des Baches, auf der zwirnenden Oberfläche, auf der sich Bäume und Büsche spiegeln, auf seinem durch Wellen verzerrten, steinigen Grund.
Er klaubt eine Zigarette aus dem zerknitterten Päckchen und zündet sie an. Ein Dame mit Hündchen kommt uns entgegen:
„Sie dürfen immer noch rauchen?“
„Ja...“, sagt der Alte, ein langgezogenes Ja mit einer Mischung aus Ärger und Was-soll-diese-Frage.
„Ich habe vor zehn Jahren aufgehört, der Arzt hatte es mir verboten. Seither geht es mir viel besser.“
Der Hund wartet hechelnd vor ihr, bis sie das Holzstück mit ihren spitzigen Schuhen wegkickt.
„Er ist vierundachtzig und hat noch kein graues Härchen, ihm geht es viel zu gut. Er hat noch nie Hundefutter bekommen – ich habe immer für ihn gekocht.“
Die Augen des Alten wandern ratlos vom Hund zur Dame, überfliegen den Park und wortlos geht er weiter, noch ein bisschen langsamer jetzt, weil der geteerte Weg sanft ansteigt, so langsam, dass ich Zeit genug habe, der glitzernden Spur einer Schnecke zu folgen, die im schwarzen Punkt ihres ausgedorrten Leibes endet, Zeit genug, um den Ameisen zuzuschauen, wie sie einen ausgetrockneten Wurmansatz über den Teer schleppen.
Vor der Treppe bleibt er stehen, zieht seine Hosen hoch, lässt seine Arme wieder sinken:
„Ich muss dringend auf die Toilette.“
„Wir sind gleich da.“
„Mir ist schwindlig.“
Auf der Schwelle zum Altersheim fällt er mir in die Arme.
Ich begleite ihn zur Toilette.
„Ich habe Urlaub, in zwei Monaten sehen wir uns wieder.“
„In zwei Monaten“, sagt der Alte, „bin ich nicht mehr da.“
Und verschwindet in der Toilette.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter