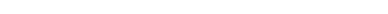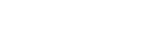Brief an mein Leben
Es ist okay.
Kennst du das ... wenn du an einem Punkt bist, wo sich nichts mehr schlecht oder gut anfühlt?
Kennst du das ... wachsende, beruhigende Gefühl von Nichts?
Warst du auch schon einmal hier?
Und weisst du ... was es heisst ... zu wollen und doch nicht zu können?
Kennst du das ... das Gefühl von Schmerz? Weisst du, wie es ist, die Kontrolle zu verlieren?
Warst du auch hier ... als du mich suchtest?
Den Mond zurückholen
ich war in der wohnung, als ich hinausschaute, und sah den mond rot und es schien so, als würde er weggefegt, und auf einmal flog er davon. ein paar stunden danach erschienen mir aliens, die bewohner des mondes, und sie haben mich auserwählt, den mond zurückzuholen. danach erschienen geister und naturwesen.
was hier geschah, war eine simple reaktion meines verstandes auf meine vergangenheit, denn ich fühlte mich stehts wertlos und als versager. mein kopf hat dafür gesorgt, dass ich dinge sehe und erlebe, in denen ich mich wohl und wichtig fühle. ich hatte glück, dass es nicht zu einer psychose gekommen war. mein leben lang habe ich viele therapien gemacht, bis irgendwann das resultat war, dass ich mir selbst helfen muss. die letzte therapie dauerte fast 2 jahre, und während dieser zeit habe ich viel über mich gelernt und herausgefunden, dass ich mir sogar klavier spielen selbst beibringen kann. ein wichtiger punkt wäre noch die diagnose, die bei mir gestellt wurde: eine vermeidend unsichere persönlichkeitsstörung. das bedeutet, dass ich stets unsicher bin gegenüber anderen leuten, also musste ich herausfinden, wie ich das stabilisieren kann. ich muss arbeiten und ich meditiere, mache sport und schaue auf die ernährung, ich brauche auch freunde, denn nur so kann ich mich selbst heilen.
was hier geschah, war eine simple reaktion meines verstandes auf meine vergangenheit, denn ich fühlte mich stehts wertlos und als versager. mein kopf hat dafür gesorgt, dass ich dinge sehe und erlebe, in denen ich mich wohl und wichtig fühle. ich hatte glück, dass es nicht zu einer psychose gekommen war. mein leben lang habe ich viele therapien gemacht, bis irgendwann das resultat war, dass ich mir selbst helfen muss. die letzte therapie dauerte fast 2 jahre, und während dieser zeit habe ich viel über mich gelernt und herausgefunden, dass ich mir sogar klavier spielen selbst beibringen kann. ein wichtiger punkt wäre noch die diagnose, die bei mir gestellt wurde: eine vermeidend unsichere persönlichkeitsstörung. das bedeutet, dass ich stets unsicher bin gegenüber anderen leuten, also musste ich herausfinden, wie ich das stabilisieren kann. ich muss arbeiten und ich meditiere, mache sport und schaue auf die ernährung, ich brauche auch freunde, denn nur so kann ich mich selbst heilen.
Die Geschichte von Hadi Abbass
Ich bin am 1.2.1958 in Bagdad geboren, besuchte dort die Grundschule, das Gymnasium und bildete mich zum Mechaniker aus.
1980 brach der erste Golfkrieg mit dem Iran aus, der bis 1988 dauerte. Ich war beim Militär Mechaniker. 1990 brach der Krieg mit Kuwait aus, den Saddam Hussein als Mutter aller Kriege bezeichnete. Er behauptete, dass Irak diesen Krieg gewinnen werde. Alle Männer wurden eingezogen. Im November 1990 bin ich geflüchtet, zuerst in einem Auto, dann mit Lastwagen oder Traktor über Nordirak, Kurdistan bis nach Istanbul. Die Grenzen waren gesperrt, oft mussten wir die Grenzwächter schmieren. Wo immer wir anhielten, wir blieben nur kurz: Toilettengang, etwas essen und weiter. Selten übernachteten wir in einer Pension. Ich war in einer kleinen Gruppe von zwei Familien unterwegs.
Mit dem Zug fuhr ich nach Bulgarien und schliesslich Jugoslawien, wo ich Verwandte hatte. Doch brach der Jugoslawienkrieg aus, und ich musste das Land verlassen. Alleine flüchtete ich nach Ungarn, das damals noch keine strenge Grenzkontrolle hatte. Über Budapest erreichte ich Wien. Ich war fasziniert von der Schweiz, ev. wäre ich auch nach Deutschland gegangen. Im September 1991 stellte ich in der Schweiz einen Antrag auf Asylverfahren, das abgelehnt wurde. Ich wurde provisorisch aufgenommen. Ich liess mein Diplom übersetzen und fand schliesslich eine Anstellung bei der Forma Vitrum, wo ich zum Vorarbeiter befördert wurde.
1999 – 2005 Arbeit bei der Firma Glas Trösch
2000 Erhalt der B-Bewilligung
2002 Frau bekommt Visum für die Schweiz
2003 Mustafa kommt auf die Welt
2006 Turaje
2009 Dibe
2006 – 2009 Arbeit bei der Firma Technometal, Ausbildung zum Logistiker
2008 Unfall: Von einer Konsole fiel eine Kiste auf meine Schulter. Ich musste operiert werden.
2009 – 2011 arbeitslos; also begann ich mit der Taxiausbildung
2011 bis heute Taxifahrer.
Natürlich war ich gegen Saddam (ohne Gewalt), aber nach der Invasion war das politische System noch unstabiler und führte ins Chaos.
2004 besuchte ich zum ersten Mal meine Eltern, meine sieben Brüder und meine Schwester. Ein Bruder ist im Krieg gestorben. Inzwischen sind alle verheiratet, meine Familie umfasst mehr als zweihundert Menschen. Ihnen geht es gut, aber die Politik ist korrupt. Die Hälfte der jetzigen Politiker waren Asylanten in Europa, lebten von der Sozialhilfe, und jetzt leiten sie die Geschicke vom Irak. 99 % von ihnen ist korrupt, ja, es ist noch schlimmer als unter Saddam. Dass in Bagdad wöchentlich eine Bombe explodiert, ist für die meisten Menschen ganz normal.
Bei jedem Besuch im Irak war es noch schlimmer: Es gibt kein sauberes Wasser, keinen Strom. Die Menschen, die nach Nordirak geflüchtet sind, werden zum Glück von christlichen Missionen und dem Roten Kreuz mit Nahrung und Medikamenten unterstützt.
Es tut mir weh, wenn ich daran denke, welche Hochblüte Bagdad unter Harun al Raschid um das 8. Jahrhundert erlebt hat. Bagdad war die Wiege der Dichtkunst. Viele Wissenschaftler lebten dort, wie zum Beispiel der Mathematiker al-Chwarizmi, der die Null ins arabische Zahlensystem integriert hat. Oder der Arzt, Physiker und Philosoph Avicenna. Auch von den Märchen in Tausend und einer Nacht stammen viele aus Bagdad. Ich wünschte mir, die Menschen würden das mitbedenken, wenn sie von Bagdad oder dem Irak sprechen.
1980 brach der erste Golfkrieg mit dem Iran aus, der bis 1988 dauerte. Ich war beim Militär Mechaniker. 1990 brach der Krieg mit Kuwait aus, den Saddam Hussein als Mutter aller Kriege bezeichnete. Er behauptete, dass Irak diesen Krieg gewinnen werde. Alle Männer wurden eingezogen. Im November 1990 bin ich geflüchtet, zuerst in einem Auto, dann mit Lastwagen oder Traktor über Nordirak, Kurdistan bis nach Istanbul. Die Grenzen waren gesperrt, oft mussten wir die Grenzwächter schmieren. Wo immer wir anhielten, wir blieben nur kurz: Toilettengang, etwas essen und weiter. Selten übernachteten wir in einer Pension. Ich war in einer kleinen Gruppe von zwei Familien unterwegs.
Mit dem Zug fuhr ich nach Bulgarien und schliesslich Jugoslawien, wo ich Verwandte hatte. Doch brach der Jugoslawienkrieg aus, und ich musste das Land verlassen. Alleine flüchtete ich nach Ungarn, das damals noch keine strenge Grenzkontrolle hatte. Über Budapest erreichte ich Wien. Ich war fasziniert von der Schweiz, ev. wäre ich auch nach Deutschland gegangen. Im September 1991 stellte ich in der Schweiz einen Antrag auf Asylverfahren, das abgelehnt wurde. Ich wurde provisorisch aufgenommen. Ich liess mein Diplom übersetzen und fand schliesslich eine Anstellung bei der Forma Vitrum, wo ich zum Vorarbeiter befördert wurde.
1999 – 2005 Arbeit bei der Firma Glas Trösch
2000 Erhalt der B-Bewilligung
2002 Frau bekommt Visum für die Schweiz
2003 Mustafa kommt auf die Welt
2006 Turaje
2009 Dibe
2006 – 2009 Arbeit bei der Firma Technometal, Ausbildung zum Logistiker
2008 Unfall: Von einer Konsole fiel eine Kiste auf meine Schulter. Ich musste operiert werden.
2009 – 2011 arbeitslos; also begann ich mit der Taxiausbildung
2011 bis heute Taxifahrer.
Natürlich war ich gegen Saddam (ohne Gewalt), aber nach der Invasion war das politische System noch unstabiler und führte ins Chaos.
2004 besuchte ich zum ersten Mal meine Eltern, meine sieben Brüder und meine Schwester. Ein Bruder ist im Krieg gestorben. Inzwischen sind alle verheiratet, meine Familie umfasst mehr als zweihundert Menschen. Ihnen geht es gut, aber die Politik ist korrupt. Die Hälfte der jetzigen Politiker waren Asylanten in Europa, lebten von der Sozialhilfe, und jetzt leiten sie die Geschicke vom Irak. 99 % von ihnen ist korrupt, ja, es ist noch schlimmer als unter Saddam. Dass in Bagdad wöchentlich eine Bombe explodiert, ist für die meisten Menschen ganz normal.
Bei jedem Besuch im Irak war es noch schlimmer: Es gibt kein sauberes Wasser, keinen Strom. Die Menschen, die nach Nordirak geflüchtet sind, werden zum Glück von christlichen Missionen und dem Roten Kreuz mit Nahrung und Medikamenten unterstützt.
Es tut mir weh, wenn ich daran denke, welche Hochblüte Bagdad unter Harun al Raschid um das 8. Jahrhundert erlebt hat. Bagdad war die Wiege der Dichtkunst. Viele Wissenschaftler lebten dort, wie zum Beispiel der Mathematiker al-Chwarizmi, der die Null ins arabische Zahlensystem integriert hat. Oder der Arzt, Physiker und Philosoph Avicenna. Auch von den Märchen in Tausend und einer Nacht stammen viele aus Bagdad. Ich wünschte mir, die Menschen würden das mitbedenken, wenn sie von Bagdad oder dem Irak sprechen.
Meine Lebensgeschichte
Mein Name ist Markus Maier und ich hatte bis zu meinem 30. Lebensjahr ein unbeschwertes, glückliches Leben. Ich hatte eine gute berufliche Ausbildung als Automechaniker und alles verlief so, dass ich positiv in die Zukunft blickte.
Als sich mein jüngster Bruder das Leben nahm, änderte sich von einem Monat auf den anderen alles. Als ich mich dann langsam wieder motivierte und alles seinen Lauf nahm, bekam ich drei Jahre später einen Anruf, dass mein Vater verstorben sei. Dann versuchte ich es zu akzeptieren und meine restlichen Geschwister gaben mir Halt. Dann kam das nächste Schicksal und meine Schwester nahm sich das Leben. Dann versuchte ich mit meinen Kollegen auf Reisen zu gehen, um Distanz zu dem Geschehenen zu bekommen. Aber genau in dieser Zeit ereilte mich ein Unfall, der mich in die Invalidität brachte. Aber das Schicksal wollte noch keine Ruhe geben, und ich musste das nächste schwere Kreuz tragen, als mein Bruder starb im Januar 2009. Und das war mein Lieblingsbruder, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Und da hinterfragte ich mich, ob es einen Gott gibt. Ein Jahr später starb mein letzter Bruder an Herzversagen.
Aber die grösste Katastrophe und die schlimmste Zeit ereilte mich, als meine Tochter im Jahr 2017 verstarb. Da begann ich, an allem zu zweifeln. Mein eigenes Fleisch und Blut war weg, und meine gesamte Familie auch. Da bekam ich Suizidgedanken und kämpfte mich jeden Tag durchs Leben. Und diese Erlebnisse beschäftigen mich jeden Tag aufs Neue. Und begab ich mich in psychiatrische Behandlung.
Markus Maier
Als sich mein jüngster Bruder das Leben nahm, änderte sich von einem Monat auf den anderen alles. Als ich mich dann langsam wieder motivierte und alles seinen Lauf nahm, bekam ich drei Jahre später einen Anruf, dass mein Vater verstorben sei. Dann versuchte ich es zu akzeptieren und meine restlichen Geschwister gaben mir Halt. Dann kam das nächste Schicksal und meine Schwester nahm sich das Leben. Dann versuchte ich mit meinen Kollegen auf Reisen zu gehen, um Distanz zu dem Geschehenen zu bekommen. Aber genau in dieser Zeit ereilte mich ein Unfall, der mich in die Invalidität brachte. Aber das Schicksal wollte noch keine Ruhe geben, und ich musste das nächste schwere Kreuz tragen, als mein Bruder starb im Januar 2009. Und das war mein Lieblingsbruder, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Und da hinterfragte ich mich, ob es einen Gott gibt. Ein Jahr später starb mein letzter Bruder an Herzversagen.
Aber die grösste Katastrophe und die schlimmste Zeit ereilte mich, als meine Tochter im Jahr 2017 verstarb. Da begann ich, an allem zu zweifeln. Mein eigenes Fleisch und Blut war weg, und meine gesamte Familie auch. Da bekam ich Suizidgedanken und kämpfte mich jeden Tag durchs Leben. Und diese Erlebnisse beschäftigen mich jeden Tag aufs Neue. Und begab ich mich in psychiatrische Behandlung.
Markus Maier
Schlüsseltrauma
Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Hatte heftige Drogenprobleme 25 Jahre lang. Da liegt nahe, dass ich immer mehr begann, auch Drogen zu verkaufen. Nach fünf Jahren wurde ich zum ersten Mal verhaftet, weil ich das Koks von den Hells Angels hatte und dass pro Woche 250g. Also wurde mir schnell klar, ich sollte besser nichts sagen, sonst habe ich ein Loch im Kopf.
Zum ersten Mal in Untersuchungshaft, d.h. 24h in einer Zelle von 12m2 in einem Gebäude, das über 100 Jahre alt war. Darin nur eine 3cm Klapppritsche am Boden. WC und Lavabo und einen eingebauten Radio in der Wand. 24h da drin, etwa eine halbe Stunde im Tag im Kreis laufen mit 3 Mithäftlingen, aber man durfte nichts reden, sonst hörten wir von den Bewachern „Halt die Fresse!“ Ich war immer der einzige Schweizer habe ich dann immer mehr bemerkt. Das ist anscheinend normal, denn im Schweizer Strafvollzug sind über 70% Ausländer. Als ich dann meine Aussage verweigerte bekam ich Beugehaft, d.h. keine Bücher, Zigaretten, nichts zu schreiben, ja ich wurde in eine kahle Betonzelle gebracht und das im Kanton St. Gallen Klosterhof. Ein Gebäude, das bei Amnesty International schon lange auf der Liste der menschenunwürdigen Bedingungen steht.
Was für mich am schlimmsten war, ist der Freiheitsentzug. Die ersten zwei Monate waren öfters nahe des psychischen Wahnsinns. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wie beim Militär, da gewöhnte ich mich auch an die harten Bedingungen. Ich war Gebirgsfüsilier, etwas vom härtesten.
Aber an was ich mich nicht gewöhnen konnte, war der Schlüsselbund von den Wärtern. Nach sieben Monaten wurde ich entlassen bis zur Gerichtsverhandlung. Zuhause hatte ich Schlafstörungen, weil mich dieses Schlüsselgeräusch verfolgt hat. Als ich dann professionelle Hilfe bei einem Psychiater beizog, wurde mir ein Schlüssel-Trauma diagnostiziert. Jahrelang wachte ich mehrmals in der Nacht auf deswegen.
Untersuchungshaft dient allein dazu, den Willen zu brechen, um die Taten so rauszubekommen. Aber bei mir hat das nicht funktioniert. Die Vollzugstrafen in den offenen Strafanstalten sind ein Ferienlos, da verdient man sogar noch gutes Geld.
Zum ersten Mal in Untersuchungshaft, d.h. 24h in einer Zelle von 12m2 in einem Gebäude, das über 100 Jahre alt war. Darin nur eine 3cm Klapppritsche am Boden. WC und Lavabo und einen eingebauten Radio in der Wand. 24h da drin, etwa eine halbe Stunde im Tag im Kreis laufen mit 3 Mithäftlingen, aber man durfte nichts reden, sonst hörten wir von den Bewachern „Halt die Fresse!“ Ich war immer der einzige Schweizer habe ich dann immer mehr bemerkt. Das ist anscheinend normal, denn im Schweizer Strafvollzug sind über 70% Ausländer. Als ich dann meine Aussage verweigerte bekam ich Beugehaft, d.h. keine Bücher, Zigaretten, nichts zu schreiben, ja ich wurde in eine kahle Betonzelle gebracht und das im Kanton St. Gallen Klosterhof. Ein Gebäude, das bei Amnesty International schon lange auf der Liste der menschenunwürdigen Bedingungen steht.
Was für mich am schlimmsten war, ist der Freiheitsentzug. Die ersten zwei Monate waren öfters nahe des psychischen Wahnsinns. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wie beim Militär, da gewöhnte ich mich auch an die harten Bedingungen. Ich war Gebirgsfüsilier, etwas vom härtesten.
Aber an was ich mich nicht gewöhnen konnte, war der Schlüsselbund von den Wärtern. Nach sieben Monaten wurde ich entlassen bis zur Gerichtsverhandlung. Zuhause hatte ich Schlafstörungen, weil mich dieses Schlüsselgeräusch verfolgt hat. Als ich dann professionelle Hilfe bei einem Psychiater beizog, wurde mir ein Schlüssel-Trauma diagnostiziert. Jahrelang wachte ich mehrmals in der Nacht auf deswegen.
Untersuchungshaft dient allein dazu, den Willen zu brechen, um die Taten so rauszubekommen. Aber bei mir hat das nicht funktioniert. Die Vollzugstrafen in den offenen Strafanstalten sind ein Ferienlos, da verdient man sogar noch gutes Geld.
Doppelt unterstrichen
Wieder ein Angstanfall. Getraue mich kaum, die Wohnung zu verlassen. Der Wein ist alle, habe die letzte Tetra-Packung in den Kübel geschmissen. Cola habe ich auch keines mehr. Ich mische es mit Wein, Korea-Drink nenne ich das.
Was, ich soll einer Sozialarbeiterin gedroht haben, mich umzubringen, wenn sie mir nicht sofort Geld gibt?
Angstzustände wie angeworfen. Wenn ich durch die Strassen gehe, habe ich das Gefühl, jeder kann durch mich hindurchschauen. Schwarze Löcher ohne Grund.
Gestern hatte ich einen Traum. Ich will den Teddybär, den ich als Kind sehr geliebt habe, auf dem Trödlermarkt verkaufen. Plötzlich merke ich, dass der Teddybär an meinen Händen klebt. Ich will ihn loswerden, doch zieht er lange, klebrige Fäden. Ich gehe zurück in meine Wohnung und werfe ihn auf den Boden. Der Teddybär zerfällt in zwei Teile, die Teile teilen sich weiter, wuchern, bis meine ganze Wohnung voll ist mit dem klebrigen Zeug.
Ob der Absturz etwas mit dem Brief zu tun hat? Nein, meine Abstürze haben keinen Auslöser. Ich könnte Ihnen schon eine Geschichte dazu erzählen, aber Geschichten sind Konstrukte, die erklären, was sich nicht erklären lässt, und verdecken, was offensichtlich ist.
Was steht denn in dem Brief?
Verwaltungsgemeinschaft „Goldene Aue“
Zu Ihrer Anfrage erteilen wir Ihnen folgende Auskunft:
Herr Manfred Lieder, zuletzt gemeldet in Hohlstedt, Strasse des Friedens 127 ist seit 12.02.1990 verstorben.
Sterbedatum ist der 12.2.1990
Diese Auskunft wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dann hat er also nur noch wenige Jahre gelebt nach unserer ersten und einzigen Begegnung. 1987 wollte ich ihn kennen lernen, meinen Vater. Ich traf ihn heimlich in Stuttgart. Meine Mutter und Grosseltern sollten nichts davon erfahren. Ich schlief auf einer Bank in einem Park, weil wir morgens in der Früh abgemacht hatten. Da stand er vor mir. Ich hielt es nach den ersten Gesten, nach den ersten Sätzen kaum für möglich, wie sehr mir dieser Mann vertraut war. Als hätte ich ein Buch über ihn gelesen und sähe ihn jetzt aus Fleisch und Blut vor mir. Er verdiente ein wenig Geld, indem er in der damaligen DDR vor einem Regierungsgebäude für einen Beamten Autonummern notierte.
Einige Monate später erhielt ich ein Karte von ihm:
Du fauler Sack, warum meldest du dich nicht?
Ich hatte damals soviel am Hut, war verheiratet, schon bald in Scheidung. Es war meine Schuld, dass die Beziehung wieder abgebrochen ist.
Mit neunzehn Jahren wurde meine Mutter schwanger. Es muss im November 1959 passiert sein, weil neun Monate später ich zur Welt kam. Der Mann, mein Vater, habe ihr etwas in den Wein gemischt, um sie willig zu machen, hiess es. Meine Mutter sei ein braves Mädchen gewesen. Jahre später habe ich erfahren, dass sie es bunt getrieben haben musste.
1963 hatte mich mein Vater anerkannt, lesen Sie selbst die Randnotiz auf meiner Geburtsurkunde:
Stuttgart, den 7. März 1963
Auf Antrag des Jugendamtes Stuttgart wird vermerkt, dass Manfred Lieder, wohnhaft in Hohlstedt, Kreis Sangerhausen, deutscher Staatsangehöriger, am 21. Januar 1963 vor dem Rat des Kreises Sangerhausen das Kind M. B. als von ihm erzeugt anerkannt hat.
Der Standesbeamte
Mein Therapeut meinte, ich solle nachforschen, ob mein Vater noch lebe. Jetzt weiss ich es:
Herr Lieder ist seit 12.02.1990 verstorben
Sterbedatum ist der 12.02.1990
Als müssten sie seinen Tod doppelt unterstreichen. Es bleibt sein Name: Manfred Lieder. Manfred bedeutet Mann des Friedens. Ist es nicht eigenartig, dass er zuletzt an der Strasse des Friedens gelebt hat?
Aber wissen Sie, eigentlich berührt mich sein Tod nicht mehr.
Was, ich soll einer Sozialarbeiterin gedroht haben, mich umzubringen, wenn sie mir nicht sofort Geld gibt?
Angstzustände wie angeworfen. Wenn ich durch die Strassen gehe, habe ich das Gefühl, jeder kann durch mich hindurchschauen. Schwarze Löcher ohne Grund.
Gestern hatte ich einen Traum. Ich will den Teddybär, den ich als Kind sehr geliebt habe, auf dem Trödlermarkt verkaufen. Plötzlich merke ich, dass der Teddybär an meinen Händen klebt. Ich will ihn loswerden, doch zieht er lange, klebrige Fäden. Ich gehe zurück in meine Wohnung und werfe ihn auf den Boden. Der Teddybär zerfällt in zwei Teile, die Teile teilen sich weiter, wuchern, bis meine ganze Wohnung voll ist mit dem klebrigen Zeug.
Ob der Absturz etwas mit dem Brief zu tun hat? Nein, meine Abstürze haben keinen Auslöser. Ich könnte Ihnen schon eine Geschichte dazu erzählen, aber Geschichten sind Konstrukte, die erklären, was sich nicht erklären lässt, und verdecken, was offensichtlich ist.
Was steht denn in dem Brief?
Verwaltungsgemeinschaft „Goldene Aue“
Zu Ihrer Anfrage erteilen wir Ihnen folgende Auskunft:
Herr Manfred Lieder, zuletzt gemeldet in Hohlstedt, Strasse des Friedens 127 ist seit 12.02.1990 verstorben.
Sterbedatum ist der 12.2.1990
Diese Auskunft wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dann hat er also nur noch wenige Jahre gelebt nach unserer ersten und einzigen Begegnung. 1987 wollte ich ihn kennen lernen, meinen Vater. Ich traf ihn heimlich in Stuttgart. Meine Mutter und Grosseltern sollten nichts davon erfahren. Ich schlief auf einer Bank in einem Park, weil wir morgens in der Früh abgemacht hatten. Da stand er vor mir. Ich hielt es nach den ersten Gesten, nach den ersten Sätzen kaum für möglich, wie sehr mir dieser Mann vertraut war. Als hätte ich ein Buch über ihn gelesen und sähe ihn jetzt aus Fleisch und Blut vor mir. Er verdiente ein wenig Geld, indem er in der damaligen DDR vor einem Regierungsgebäude für einen Beamten Autonummern notierte.
Einige Monate später erhielt ich ein Karte von ihm:
Du fauler Sack, warum meldest du dich nicht?
Ich hatte damals soviel am Hut, war verheiratet, schon bald in Scheidung. Es war meine Schuld, dass die Beziehung wieder abgebrochen ist.
Mit neunzehn Jahren wurde meine Mutter schwanger. Es muss im November 1959 passiert sein, weil neun Monate später ich zur Welt kam. Der Mann, mein Vater, habe ihr etwas in den Wein gemischt, um sie willig zu machen, hiess es. Meine Mutter sei ein braves Mädchen gewesen. Jahre später habe ich erfahren, dass sie es bunt getrieben haben musste.
1963 hatte mich mein Vater anerkannt, lesen Sie selbst die Randnotiz auf meiner Geburtsurkunde:
Stuttgart, den 7. März 1963
Auf Antrag des Jugendamtes Stuttgart wird vermerkt, dass Manfred Lieder, wohnhaft in Hohlstedt, Kreis Sangerhausen, deutscher Staatsangehöriger, am 21. Januar 1963 vor dem Rat des Kreises Sangerhausen das Kind M. B. als von ihm erzeugt anerkannt hat.
Der Standesbeamte
Mein Therapeut meinte, ich solle nachforschen, ob mein Vater noch lebe. Jetzt weiss ich es:
Herr Lieder ist seit 12.02.1990 verstorben
Sterbedatum ist der 12.02.1990
Als müssten sie seinen Tod doppelt unterstreichen. Es bleibt sein Name: Manfred Lieder. Manfred bedeutet Mann des Friedens. Ist es nicht eigenartig, dass er zuletzt an der Strasse des Friedens gelebt hat?
Aber wissen Sie, eigentlich berührt mich sein Tod nicht mehr.
Geschichte einer Klientin
Einen Monat lang ist sie durch Skandinavien gewandert und hat stets draussen oder im Zelt geschlafen. In der Einsamkeit hat sie viel Zeit zum Nachzudenken und stösst dabei auf ein Wort: Danke.
Ich habe auch nur etwas Kleines zu sagen. Ein kleines Wort, das meiner Meinung nach zu oft vergessen wird. Ein kleines, aber sehr wichtiges Wort. Es ist das Wort "Danke“. Ich möchte daran erinnern, dass wir manchmal einfach „Danke“ sagen sollten. Es gibt so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, weil sie schliesslich immer da sind und wir sie dadurch nicht mehr sehen und nicht mehr schätzen. Ob bewusst oder unbewusst. Fakt ist aber, es ist nichts selbstverständlich! Ich habe gelernt, dass die meisten vergessen haben, bewusst wahrzunehmen, und für mich beschlossen, mich bei all diesen Dingen zu bedanken. Damit meine ich keine Autos, Häuser oder irgendetwas Materielles. Nein. Damit meine ich die wirklich wichtigen Dinge! So dankte ich als erstes dem immer wiederkehrenden Morgenlicht für die Hoffnung, die es gibt an jedem neuen Tag. Der Sonne dafür, dass sie den Weg erhellt, der Erde dafür, dass sie alles trägt, den Wolken, den Wiesen und auch jedem einzelnen Grashalm! Jedem Baum dafür, dass er die Luft, die wir zum Leben brauchen, einfach schenkt! Dem Wind dafür, dass er auf allen Wegen stets furchtloser Begleiter ist. Dem Meer und den Wellen dafür, dass sie niemals still stehen. Dem Strand und dem Himmel für seine Endlosigkeit. Jedem Stein und den Wäldern für alle Ruhe und jedem einzelnen Wesen darin. Den Wölfen für ihre Rufe, die uns manchmal erwachen lassen. Jedem einzelnen Stern in der Nacht und den silbernen Fragmenten, die sie als Bilder, wie wir sie sehen, zusammenhalten. Dem Mond dafür, dass er die Nacht erhellt. Dem Regen für die Klarheit, die er in die Luft bringt. Dem Blitz und dem Donner einfach nur für ihre mächtige Anwesenheit! Dem Eis und dem Schnee für die Stille, die sie aufs Land zaubern. Den Vögeln für jedes ihrer Lieder, das sie für uns singen. Ich dankte der Zeit dafür, dass sie relativ ist. Dem Tag und der Nacht dafür, dass sie genutzt werden können. Dem Regenbogen für seine Farben und für sein Leuchten und dafür, dass er existiert! Ganz besonders dankte ich dem ganzen komplexen Universum, dass es alle diese Elemente und Phänomene perfekt aufeinander abstimmt und existent hält; es ist ein Wunder. Dieses Wunder hat einen Namen. Die Natur. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, dass ich etwas verstanden habe, nachdem ich mich bei all diesen Dingen bedankt habe. Ein kluger Mann sagte einmal: „ Der Mensch ist die dümmste Spezies! Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass die Natur, die er vernichtet, dieser unsichtbare Gott ist, den er verehrt!“
Früher habe ich das nicht verstanden. Jetzt tue ich es.
C.
Ich habe auch nur etwas Kleines zu sagen. Ein kleines Wort, das meiner Meinung nach zu oft vergessen wird. Ein kleines, aber sehr wichtiges Wort. Es ist das Wort "Danke“. Ich möchte daran erinnern, dass wir manchmal einfach „Danke“ sagen sollten. Es gibt so viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, weil sie schliesslich immer da sind und wir sie dadurch nicht mehr sehen und nicht mehr schätzen. Ob bewusst oder unbewusst. Fakt ist aber, es ist nichts selbstverständlich! Ich habe gelernt, dass die meisten vergessen haben, bewusst wahrzunehmen, und für mich beschlossen, mich bei all diesen Dingen zu bedanken. Damit meine ich keine Autos, Häuser oder irgendetwas Materielles. Nein. Damit meine ich die wirklich wichtigen Dinge! So dankte ich als erstes dem immer wiederkehrenden Morgenlicht für die Hoffnung, die es gibt an jedem neuen Tag. Der Sonne dafür, dass sie den Weg erhellt, der Erde dafür, dass sie alles trägt, den Wolken, den Wiesen und auch jedem einzelnen Grashalm! Jedem Baum dafür, dass er die Luft, die wir zum Leben brauchen, einfach schenkt! Dem Wind dafür, dass er auf allen Wegen stets furchtloser Begleiter ist. Dem Meer und den Wellen dafür, dass sie niemals still stehen. Dem Strand und dem Himmel für seine Endlosigkeit. Jedem Stein und den Wäldern für alle Ruhe und jedem einzelnen Wesen darin. Den Wölfen für ihre Rufe, die uns manchmal erwachen lassen. Jedem einzelnen Stern in der Nacht und den silbernen Fragmenten, die sie als Bilder, wie wir sie sehen, zusammenhalten. Dem Mond dafür, dass er die Nacht erhellt. Dem Regen für die Klarheit, die er in die Luft bringt. Dem Blitz und dem Donner einfach nur für ihre mächtige Anwesenheit! Dem Eis und dem Schnee für die Stille, die sie aufs Land zaubern. Den Vögeln für jedes ihrer Lieder, das sie für uns singen. Ich dankte der Zeit dafür, dass sie relativ ist. Dem Tag und der Nacht dafür, dass sie genutzt werden können. Dem Regenbogen für seine Farben und für sein Leuchten und dafür, dass er existiert! Ganz besonders dankte ich dem ganzen komplexen Universum, dass es alle diese Elemente und Phänomene perfekt aufeinander abstimmt und existent hält; es ist ein Wunder. Dieses Wunder hat einen Namen. Die Natur. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, dass ich etwas verstanden habe, nachdem ich mich bei all diesen Dingen bedankt habe. Ein kluger Mann sagte einmal: „ Der Mensch ist die dümmste Spezies! Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass die Natur, die er vernichtet, dieser unsichtbare Gott ist, den er verehrt!“
Früher habe ich das nicht verstanden. Jetzt tue ich es.
C.
Abenteuer auf den Philippinen
Ich war nun schon zwei Wochen bei meinem Bruder im Dorf. Das Leben hier war einfach und natürlich, Fischer, Bauern und ein kleiner Laden für alles. Nur um einiges kleiner als in der Schweiz. Da ich etwas erleben wollte, begab ich mich auf eine Fähre und fuhr blindlings ins Abenteuer.
Ich staunte über die schönen Inseln, an denen die Fähre vorbeifuhr, noch mehr erfreute mich der Anblick von meinem Ziel. Eine Insel wie aus der Werbung. Weisse Sandstrände, Palmen und klares Meerwasser mit verschiedensten Korallen, Riffen und bunten Fischen. Als ich am Ufer stand, freute ich mich auf ein kühles Bier und einen scharfen Mangosalat.
Nach dem Essen bezog ich mein Zimmer, eher eine Bambushütte mit Strohdach, in dem einen Hängematte mit Insektennetz baumelte. Dafür war der Strand nur zehn Meter entfernt mit dem wunderbaren Wasser. Am nächsten Tag ging ich tauchen, dabei sah ich einen kleinen Katzenhai und bunte Clownfische, dann fuhren wir noch zu einem japanischen Schiffsfrack und tauchten hinunter. Da sah ich eine Wasserschlange, die im Bullauge des Schiffes verschwand. Das Schiff war schön anzusehen, da die Natur überall ihren bunten Zauber hinterliess, Fische, Korallen und Algen. Ich wollte gar nicht mehr auftauchen, aber ich musste, da mir die Luft langsam ausging.
Später am Abend genossen ich und die anderen Taucher einen acht Kilo schweren Rifffisch mit Knoblauchreis und scharfem Mangosalat. Nach einer langen Nacht erwachte ich mit einem schweren Kopf und müden Gliedern. Ich musste mich beeilen, die Fähre noch zu erwischen. Eine Weile lang sah das Wetter gut aus. Dann wurde es schwarz am Himmel und es begann zu regnen wie aus Eimern. Die Wellen schlugen über die Reling. Die Passagiere bekamen Schwimmwesten. Ich zog meine über und ging zum Heck des Schiffes, wo ich mir eine Zigarette und ein Bier genehmigte und dachte, es könnte auch schlimmer sein. Ob es Zufall war oder einfach nur schlecht gewartete Motoren, kann ich nicht sagen. Es gab vor mir einen Knall, dass mir die Ohren pfiffen, und ich sah, wie ein Motor zu brennen anfing. Das Feuer war schnell gelöscht, doch wir sassen dem Sturm ausgesetzt ohne Motor hilflos treibend im Meer. Nach einer Viertelstunde liess der Sturm nach und die Sonne kam hervor. Nach einer Stunde kam die Küstenwacht und zog uns im Schlepptau in den nächsten Hafen, wo ich froh war, wieder Land unter den Füssen zu haben. Von da aus ging ich zurück zu meinem Bruder und hatte noch einige ruhige Wochen.

Ich staunte über die schönen Inseln, an denen die Fähre vorbeifuhr, noch mehr erfreute mich der Anblick von meinem Ziel. Eine Insel wie aus der Werbung. Weisse Sandstrände, Palmen und klares Meerwasser mit verschiedensten Korallen, Riffen und bunten Fischen. Als ich am Ufer stand, freute ich mich auf ein kühles Bier und einen scharfen Mangosalat.
Nach dem Essen bezog ich mein Zimmer, eher eine Bambushütte mit Strohdach, in dem einen Hängematte mit Insektennetz baumelte. Dafür war der Strand nur zehn Meter entfernt mit dem wunderbaren Wasser. Am nächsten Tag ging ich tauchen, dabei sah ich einen kleinen Katzenhai und bunte Clownfische, dann fuhren wir noch zu einem japanischen Schiffsfrack und tauchten hinunter. Da sah ich eine Wasserschlange, die im Bullauge des Schiffes verschwand. Das Schiff war schön anzusehen, da die Natur überall ihren bunten Zauber hinterliess, Fische, Korallen und Algen. Ich wollte gar nicht mehr auftauchen, aber ich musste, da mir die Luft langsam ausging.
Später am Abend genossen ich und die anderen Taucher einen acht Kilo schweren Rifffisch mit Knoblauchreis und scharfem Mangosalat. Nach einer langen Nacht erwachte ich mit einem schweren Kopf und müden Gliedern. Ich musste mich beeilen, die Fähre noch zu erwischen. Eine Weile lang sah das Wetter gut aus. Dann wurde es schwarz am Himmel und es begann zu regnen wie aus Eimern. Die Wellen schlugen über die Reling. Die Passagiere bekamen Schwimmwesten. Ich zog meine über und ging zum Heck des Schiffes, wo ich mir eine Zigarette und ein Bier genehmigte und dachte, es könnte auch schlimmer sein. Ob es Zufall war oder einfach nur schlecht gewartete Motoren, kann ich nicht sagen. Es gab vor mir einen Knall, dass mir die Ohren pfiffen, und ich sah, wie ein Motor zu brennen anfing. Das Feuer war schnell gelöscht, doch wir sassen dem Sturm ausgesetzt ohne Motor hilflos treibend im Meer. Nach einer Viertelstunde liess der Sturm nach und die Sonne kam hervor. Nach einer Stunde kam die Küstenwacht und zog uns im Schlepptau in den nächsten Hafen, wo ich froh war, wieder Land unter den Füssen zu haben. Von da aus ging ich zurück zu meinem Bruder und hatte noch einige ruhige Wochen.
Der Waldmeister
Er sieht aus, als wäre er einem Märchenbuch entsprungen:
Wuschelig-weisses Haar, weisser Bart bis auf die Brust, und ein Glasauge.
Wie ein Waldgeist vielleicht oder ein gutmütiger Pirat,
der Menschen ihrer vermeintlichen Reichtümer entledigt,
um ihnen ihre kindliche Verspieltheit wieder zurückzugeben.
Er brauche dreihundert Franken, weil die Bank sonst sein Konto,
das im Minus ist, nicht entsperren würde und
das Sozialamt ohne Konto kein Geld auszahle.
Es gibt keine Lösung wie vor drei Monaten,
als er auch kein Geld mehr hatte und ein Kollege ihm vorschlug,
mit ihm nach Südfrankreich zu fahren,
um dort beim Umbau eines Bauernhofes mitzuhelfen.
Er zimmerte am Dachstuhl, ersetzte kaputte Ziegel,
zog Mauern hoch und abends …
jedenfalls war am Ende seines Einsatzes der Verdienst aufgebraucht,
und er hatte kein Geld mehr für die Rückreise.
Also beschloss er, zu Fuss heimzukehren mit seinem Hund,
von Hof zu Hof, wo er manchmal etwas zu essen bekam.
Manchmal bettelte er in einer Stadt oder in einem Laden
kurz vor Ladenschluss um ein Sandwich.
Über tausend Kilometer, Nacht für Nacht draussen schlafen,
nur der Hund neben ihm.
Plötzlich wird mir bewusst, weshalb es mir scheint,
er wäre einem Märchenbuch entsprungen:
Er hat meinen Jugendtraum verwirklicht,
allein durch Frankreich zu wandern.
Ich war damals nach zehn Kilometern,
nach einer Nacht im Wald,
wieder heimgekehrt.
Wuschelig-weisses Haar, weisser Bart bis auf die Brust, und ein Glasauge.
Wie ein Waldgeist vielleicht oder ein gutmütiger Pirat,
der Menschen ihrer vermeintlichen Reichtümer entledigt,
um ihnen ihre kindliche Verspieltheit wieder zurückzugeben.
Er brauche dreihundert Franken, weil die Bank sonst sein Konto,
das im Minus ist, nicht entsperren würde und
das Sozialamt ohne Konto kein Geld auszahle.
Es gibt keine Lösung wie vor drei Monaten,
als er auch kein Geld mehr hatte und ein Kollege ihm vorschlug,
mit ihm nach Südfrankreich zu fahren,
um dort beim Umbau eines Bauernhofes mitzuhelfen.
Er zimmerte am Dachstuhl, ersetzte kaputte Ziegel,
zog Mauern hoch und abends …
jedenfalls war am Ende seines Einsatzes der Verdienst aufgebraucht,
und er hatte kein Geld mehr für die Rückreise.
Also beschloss er, zu Fuss heimzukehren mit seinem Hund,
von Hof zu Hof, wo er manchmal etwas zu essen bekam.
Manchmal bettelte er in einer Stadt oder in einem Laden
kurz vor Ladenschluss um ein Sandwich.
Über tausend Kilometer, Nacht für Nacht draussen schlafen,
nur der Hund neben ihm.
Plötzlich wird mir bewusst, weshalb es mir scheint,
er wäre einem Märchenbuch entsprungen:
Er hat meinen Jugendtraum verwirklicht,
allein durch Frankreich zu wandern.
Ich war damals nach zehn Kilometern,
nach einer Nacht im Wald,
wieder heimgekehrt.
Der Tunnelbauer
Er hat den Tunnel gebaut,
durch den jetzt Autos rasen,
erinnert sich noch,
wie man an einem Wintermorgen
Handschuhe anziehen musste,
weil einem das kalte Metall die Haut
von der Hand riss,
erinnert sich
an das Rütteln des Presslufthammers,
das noch lange in Schultern und Armen blieb,
sodass er abends warten musste,
bis er endlich den Teller mit Spaghetti
hinunterschlingen konnte,
erinnert sich
an die Kiste Bier,
die er nach der Arbeit mit seinen Kumpels trank
und sich wieder leicht und licht fühlte.
Ja, hier oben ist Licht!
Doch jetzt ist sein Rücken kaputt,
die Invalidenversicherung zahlt noch nicht
und das Sozialamt viel weniger als der Lohn von damals,
sodass ihm das Geld fehlt,
seine kranke Mutter zu besuchen.
Plötzlich weint er
als wäre er beim Tunnelbau
auf eine Wasserader gestossen:
Vor seinem inneren Auge sieht er das Grab seiner Mutter
und das seine neben ihr.
durch den jetzt Autos rasen,
erinnert sich noch,
wie man an einem Wintermorgen
Handschuhe anziehen musste,
weil einem das kalte Metall die Haut
von der Hand riss,
erinnert sich
an das Rütteln des Presslufthammers,
das noch lange in Schultern und Armen blieb,
sodass er abends warten musste,
bis er endlich den Teller mit Spaghetti
hinunterschlingen konnte,
erinnert sich
an die Kiste Bier,
die er nach der Arbeit mit seinen Kumpels trank
und sich wieder leicht und licht fühlte.
Ja, hier oben ist Licht!
Doch jetzt ist sein Rücken kaputt,
die Invalidenversicherung zahlt noch nicht
und das Sozialamt viel weniger als der Lohn von damals,
sodass ihm das Geld fehlt,
seine kranke Mutter zu besuchen.
Plötzlich weint er
als wäre er beim Tunnelbau
auf eine Wasserader gestossen:
Vor seinem inneren Auge sieht er das Grab seiner Mutter
und das seine neben ihr.
Die schlechten sieben Jahre
Ein Mann mittleren Alters erzält, wie er nach einem Unfall seinen Arbeitsplatz verlor und durch unglückliche Verknüpfungen immer mehr an sozialen Kontakten und Selbstwert einbüsste. Trotz Verlusterfahrungen hat er die Hoffnung auf glücklichere Jahre nicht verloren.
Als das Unglück begann, war ich gerade mal 36 Jahre alt und stand mit beiden Füssen im Arbeitsleben. Es war an einem Dienstagmorgen. Ich ging wie üblich zur Arbeit, dann begann das Unheil seinen Lauf zu nehmen. Ich stürzte eine Treppe hinunter und blieb liegen. Ich konnte mich kaum mehr bewegen und hatte Angst, eine schwere Verletzung erlitten zu haben. Als das Notfallauto mich in das Spital brachte, wurde ein Bruch der ersten 3 Halswirbel festgestellt. In der anschließenden Operation wurde mir eine Metallplatte mit 6 Schrauben zur Stabilisierung implantiert. Ich war 4 Tage auf der Intensivstation, danach folgte ein Spitalaufenthalt von 5 Wochen. Nach 8 wöchiger Rehaklinik musste ich wieder zuerst lernen, richtig zu sprechen und zu essen. Meine Beweglichkeit wollte einfach nicht mehr zurückkommen. Als nach 45 Physiotherapien die Schmerzen immer noch vorhanden waren, bekam ich immer mehr Schmerztabletten. Doch diese machten mich abhängig und es wurde auch nicht besser mit der Beweglichkeit. Es kam wie es kommen musste und ich erhielt von da an eine IV-Rente und wurde vom Sozialamt unterstützt. Ich versuchte, wieder eine Arbeit zu finden, jedoch missglückte dies 3 Mal. Ich musste feststellen, dass ich immer mehr Freunde verlor und ich mich aus dem sozialen Umfeld entfernte. Ich fühlte mich nutzlos, da nach 2 Jahren eine erneute Operation der zwei unteren Bandscheiben anfiel. Ich dachte manchmal daran, warum immer ich! Ich fragte mich öfters, wo bleibt mein Glück! Als meine Mutter danach selber schwer erkrankte, hatte ich das Gefühl, dies könne doch nicht wahr sein. Sie hatte Diabetes und ihr musste ein Bein amputiert werden. Ein halbes Jahr später wurde bei ihr Krebs festgestellt. Von da an kümmerte ich mich jeden Tag um meine Mutter, da mein Vater arbeitstätig war. Ich stand jeden Morgen um 5.00 Uhr auf und machte mich auf den Weg zu meiner Mutter und pflegte sie, bis mein Vater nach Hause kam. Der Zustand meiner Mutter verschlechterte sich schnell und sie ging im Spital ein und aus. Eines Tages, als ich meine Mutter mit meinem Vater im Spital besuchte, sagte man uns, dass meine Mutter eine Lebenserwartung von maximal 3 Wochen habe und wir einen Platz suchen müssten, wo meine Mutter die letzte Zeit verbringen konnte. Diese Worte waren für mich und meinen Vater ein schockierendes Erlebnis! Für uns war klar, dass wir meine Mutter nach Hause nahmen, um in ihrer gewohnten Umgebung einschlafen zu können und mein Vater ging von da an nicht mehr Arbeiten. Meine Mutter war glücklich, wieder zuhause zu sein. Wir verbrachten alle zusammen noch 11 glückliche Tage zusammen. Wie immer war ich von morgens früh bis abends spät am Bett meiner Mutter. Es war an einem Freitagabend. Ich wollte meiner Mutter noch eine „Gute Nacht“ wünschen und gab ihr einen Kuss. Mein Vater war daneben und hielt ihre Hand. Meine Mutter schaute mich noch an und schlief friedlich ein. Nun war mein Vater alleine und wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Seit diesem Freitag war mein Vater ein gebrochener Mann! Ich konnte von Tag zu Tag mit ansehen, wie er seinen Glauben verlor. Er wurde wie meine Mutter von Krebs heimgesucht! Gleichzeitig hatte er innert 2 Jahren 2 Herzinfarkte und ging im Spital ein und aus. Für mich war es schon fast normal, dass ich nun die Aufgabe hatte, jeden Tag meinen todkranken Vater zu pflegen und rund um die Uhr für ihn da zu sein. Es waren nun 6 Jahre vergangen, seit ich meine Mutter verloren hatte. Meinem Vater ging es so schlecht, dass er zu mir sagte: „Mein Sohn, nimm mich bitte mit nach Hause“. Ich merkte selber, dass er in absehbarer Zeit sterben würde. Für mich war klar, dass mein Vater zu mir nach Hause kommt, um bei mir die letzte Ruhe zu finden. Es verging eine Woche und meinem Vater ging es immer schlechter. Er bekam starke Medikamente und hatte so viel Morphium, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Ich schlief auf dem Boden und er in meinem Bett. Es war Mittwochabend und ich lag neben ihm am Boden, als ich ein Husten hörte. Ich sah sofort nach ihm und nahm ihn in meine Arme, wo er für immer einschlief. Für mich brach in diesem Moment die Welt zusammen und ich fragte mich: „Gott, warum nur. “
Heute bin ich 48 Jahre alt und nehme Psychopharmaka und andere Schlaf- und Schmerzmittel. Mein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, dennoch habe ich die Hoffnung, dass alles gut wird. Denn die verflixten sieben schlechten Jahre habe ich nun hinter mir und glaube fest daran, dass das Glück auch mal wieder bei mir vorbeischaut.
HP Metzger
Als das Unglück begann, war ich gerade mal 36 Jahre alt und stand mit beiden Füssen im Arbeitsleben. Es war an einem Dienstagmorgen. Ich ging wie üblich zur Arbeit, dann begann das Unheil seinen Lauf zu nehmen. Ich stürzte eine Treppe hinunter und blieb liegen. Ich konnte mich kaum mehr bewegen und hatte Angst, eine schwere Verletzung erlitten zu haben. Als das Notfallauto mich in das Spital brachte, wurde ein Bruch der ersten 3 Halswirbel festgestellt. In der anschließenden Operation wurde mir eine Metallplatte mit 6 Schrauben zur Stabilisierung implantiert. Ich war 4 Tage auf der Intensivstation, danach folgte ein Spitalaufenthalt von 5 Wochen. Nach 8 wöchiger Rehaklinik musste ich wieder zuerst lernen, richtig zu sprechen und zu essen. Meine Beweglichkeit wollte einfach nicht mehr zurückkommen. Als nach 45 Physiotherapien die Schmerzen immer noch vorhanden waren, bekam ich immer mehr Schmerztabletten. Doch diese machten mich abhängig und es wurde auch nicht besser mit der Beweglichkeit. Es kam wie es kommen musste und ich erhielt von da an eine IV-Rente und wurde vom Sozialamt unterstützt. Ich versuchte, wieder eine Arbeit zu finden, jedoch missglückte dies 3 Mal. Ich musste feststellen, dass ich immer mehr Freunde verlor und ich mich aus dem sozialen Umfeld entfernte. Ich fühlte mich nutzlos, da nach 2 Jahren eine erneute Operation der zwei unteren Bandscheiben anfiel. Ich dachte manchmal daran, warum immer ich! Ich fragte mich öfters, wo bleibt mein Glück! Als meine Mutter danach selber schwer erkrankte, hatte ich das Gefühl, dies könne doch nicht wahr sein. Sie hatte Diabetes und ihr musste ein Bein amputiert werden. Ein halbes Jahr später wurde bei ihr Krebs festgestellt. Von da an kümmerte ich mich jeden Tag um meine Mutter, da mein Vater arbeitstätig war. Ich stand jeden Morgen um 5.00 Uhr auf und machte mich auf den Weg zu meiner Mutter und pflegte sie, bis mein Vater nach Hause kam. Der Zustand meiner Mutter verschlechterte sich schnell und sie ging im Spital ein und aus. Eines Tages, als ich meine Mutter mit meinem Vater im Spital besuchte, sagte man uns, dass meine Mutter eine Lebenserwartung von maximal 3 Wochen habe und wir einen Platz suchen müssten, wo meine Mutter die letzte Zeit verbringen konnte. Diese Worte waren für mich und meinen Vater ein schockierendes Erlebnis! Für uns war klar, dass wir meine Mutter nach Hause nahmen, um in ihrer gewohnten Umgebung einschlafen zu können und mein Vater ging von da an nicht mehr Arbeiten. Meine Mutter war glücklich, wieder zuhause zu sein. Wir verbrachten alle zusammen noch 11 glückliche Tage zusammen. Wie immer war ich von morgens früh bis abends spät am Bett meiner Mutter. Es war an einem Freitagabend. Ich wollte meiner Mutter noch eine „Gute Nacht“ wünschen und gab ihr einen Kuss. Mein Vater war daneben und hielt ihre Hand. Meine Mutter schaute mich noch an und schlief friedlich ein. Nun war mein Vater alleine und wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Seit diesem Freitag war mein Vater ein gebrochener Mann! Ich konnte von Tag zu Tag mit ansehen, wie er seinen Glauben verlor. Er wurde wie meine Mutter von Krebs heimgesucht! Gleichzeitig hatte er innert 2 Jahren 2 Herzinfarkte und ging im Spital ein und aus. Für mich war es schon fast normal, dass ich nun die Aufgabe hatte, jeden Tag meinen todkranken Vater zu pflegen und rund um die Uhr für ihn da zu sein. Es waren nun 6 Jahre vergangen, seit ich meine Mutter verloren hatte. Meinem Vater ging es so schlecht, dass er zu mir sagte: „Mein Sohn, nimm mich bitte mit nach Hause“. Ich merkte selber, dass er in absehbarer Zeit sterben würde. Für mich war klar, dass mein Vater zu mir nach Hause kommt, um bei mir die letzte Ruhe zu finden. Es verging eine Woche und meinem Vater ging es immer schlechter. Er bekam starke Medikamente und hatte so viel Morphium, dass er keine Schmerzen mehr hatte. Ich schlief auf dem Boden und er in meinem Bett. Es war Mittwochabend und ich lag neben ihm am Boden, als ich ein Husten hörte. Ich sah sofort nach ihm und nahm ihn in meine Arme, wo er für immer einschlief. Für mich brach in diesem Moment die Welt zusammen und ich fragte mich: „Gott, warum nur. “
Heute bin ich 48 Jahre alt und nehme Psychopharmaka und andere Schlaf- und Schmerzmittel. Mein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, dennoch habe ich die Hoffnung, dass alles gut wird. Denn die verflixten sieben schlechten Jahre habe ich nun hinter mir und glaube fest daran, dass das Glück auch mal wieder bei mir vorbeischaut.
HP Metzger
Flucht aus Algerien
Er wollte sich nicht beim Sozialamt melden, da er hoffte, der IV-Entscheid würde nächstens fallen. Aber es dauerte Monate länger als erwartet und plötzlich konnte er die Miete nicht mehr bezahlen, hatte zu wenig Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Deshalb meldete er sich beim katholischen Sozialdienst – und erzählte seine Geschichte.
Ich wurde im Januar 1954 in Kabylie, einer Gegend in Algerien, geboren. Ich wuchs auf bei den Eltern von meinem Vater und seinen Cousins, weil er selbst als Kommandant gegen Frankreich für die Unabhängigkeit Algeriens kämpfte. Meine Mutter lebte mal hier, mal dort, weil sie als Frau eines Kommandanten gesucht wurde. Erst nach 1962, der Unabhängigkeit Algeriens, konnte sie frei leben. Ich habe meinen Vater ein einziges Mal gesehen, im Februar 1958. Frere Jean hatte dieses Treffen damals arrangiert, indem er vorgab, er müsse mit mir in ein Spital in einer Stadt 150 km entfernt, wo mein Vater mit seiner Truppe war. Ich habe nur vage Erinnerungen an ihn, sehe ihn noch vor mir, den Mann in Uniform, der mir eigentlich fremd war. Kurz darauf ist er im Krieg gestorben.
Als dreijähriger Knabe kam ich zu den Pères blancs, die bald zu meiner Familie wurden. Als wäre ich dort geboren! Die drei Monate Schulferien, während denen ich bei den Eltern meines Vaters und seinen Cousins lebte, waren für mich die Hölle, weil eine andere Kultur herrschte, eine Kultur der Auseinander- und Durchsetzung, des „jeder für sich“, während ich bei den Pères blancs einen respektvollen Umgang, andere Sitten und andere Gewohnheiten gelernt hatte. Besonders Père Jean war wie mein Vater, ein ausserordentlicher Mensch, der sein Herz auf der Hand trug und mit einem milden Lächeln die Konflikte löste. Ich habe vier ältere Schwestern, aber wie gesagt, meine Familie war die Schule der Pères blancs. Ich lernte dort viele praktische Dinge wie Mauern hochziehen, Elektrisches reparieren, Feldarbeit oder mit Tieren umgehen. Wenn Père Jean mich mal fünf Minuten nicht sah, suchte er mich, er liess mich ein Bedürfnis nie länger haben. Wenn andere spielten, zog ich mich zurück und las Molière, Baudelaire und andere, hätte gerne Theater gemacht, merkte aber bald, dass ich darin kein Talent hatte. Nachdem meine Grossmutter 1972 gestorben war, wollte mich meine Familie zurückholen, aber ich wollte bei den Pères blancs bleiben.
Im Jahr 1978 wanderte ich nach Frankreich aus. Grossvater gab mir ein bisschen Geld, damit ich mir dort eine Existenz aufbauen konnte. Natürlich gab es Vorurteile gegenüber Algeriern, da ich aber die französische Kultur gut kannte, gelang mir die Integration in Paris sehr gut. Ich arbeitete in der Küche und in der Bar oder als Garçon, und eröffnete schliesslich ein eigenes Restaurant, eine Couscoussière mit französischen und algerischen Spezialitäten. Acht Personen arbeiteten für mich, ich hatte aber trotzdem viel Arbeit, musste alles andere vergessen, ich war mit meiner Arbeit verheiratet. Ich wollte keine Kunden verlieren, deshalb war mir der Empfang ganz wichtig, die Gäste sollten sich von Anfang an wohl fühlen. Oui, j’ai jouer sur l’acceuil. Das Restaurant existierte noch bis 2012, danach wurde es an eine Versicherungsgesellschaft verkauft.
Während meiner Zeit in Frankreich hatte ich drei Liebesbeziehungen, aber die ersten beiden scheiterten, weil ich zu viel arbeitete, die dritte daran, dass sie mir nicht nach Algerien folgen wollte, denn nach dem Tod meines Grossvaters, 1992, kehrte ich heim, um den Hof zu übernehmen. Die Verbindung zu meinem Grossvater war die ganze Zeit über sehr eng gewesen, wenn wir nicht alle vier Tage miteinander telefonierten, wurden wir krank. Er war Ingenieur in Agronomie und vertraute mir voll und ganz. Er starb in meinen Armen. Am tiefsten aber war meine Beziehung zu Pére Jean, ihm öffnete ich mein ganzes Herz. Wenn ich ihm Vater sagte, kamen ihm die Tränen.
Nach meiner Rückkehr begann ich den Hof zu modernisieren, kaufte einen Traktor und legte Bewässerungssysteme an. Ich liebe Tiere und Pflanzen. Meines Erachtens ist es ein Verbrechen, Tiere zu kastrieren. Ich hatte im Winter 10‘000 Hühner und im Sommer 15‘000, über 80‘0000 Kücken und 500 bis 1000 Schafe. Doch schon im Jahr 1993 begann die algerische Mafia aktiv zu werden und verlangte Geld von mir. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1997 haben sie in Betalha ein Massacker angerichtet. Es wird berichtet, die Mörder seien Islamisten gewesen, aber die algerische Armee stand dem Massacker Pate, indem sie die Stadt vor möglicher Hilfe abriegelte und die Mörder entkommen liess. Die Regierung unter Liamine Zeroual produzierte Terroristen.
Seit Dezember 1991 war das Leben in Algerien sehr schwierig, 1992 brach der Bürgerkrieg aus. 5 Tage vor den ersten freien Parlamentswahlen putschte die Armee und brachte die islamische Heilsfront (FIS) um den sicheren Sieg. Dieser Partei angehörige Menschen wurden in die Wüste deportiert und gefoltert. Die Armee schoss auf Menschen, niemand durfte etwas sagen, und wenn jemand etwas sagte, wurde er deportiert. Überall war die Polizei, die Regierung proklamierte, alle Ausländer müssten das Land verlassen. Ich erinnere mich, dass Menschen T-shirts mit folgender Aufschrift trugen: on ne peut pas nous tuer, nous sommes deja mort. 1994 wurde Père Jean und drei andere Pères blancs in Tizi Ouzou getötet. Es war ein Schock für mich. An die Beerdigung kamen viele Menschen, weil die Pères blancs so viel Gutes getan hatten. Sie führten eine Art Sekretariat für Menschen, die nicht schreiben konnten und, weil sie von weit her kamen, im Schulhaus übernachteten duften. Sie gaben Kleider und Schuhe ab an Menschen, die kaum etwas besassen. Tausende kamen an die Beerdigung. Wir sagten vor ausländischen Journalisten, dass sie nicht von Terroristen, sondern von der Spezialeinheit der Armee umgebracht wurden. Seither galt ich als gefährlich. Ich wurde eingesperrt, war 21 Monate lang im Gefängnis, wurde von einem ins andere Gefängnis gebracht und immer hiess es, das Dossier ist noch nicht da, wir können noch nichts entscheiden. Wir waren 63 Gefangene auf 40 bis 50 Quadratmeter, sahen kein Licht den ganzen Tag. Am 1. November 2001 wurde ich endlich aus dem Gefängnis entlassen, da erfuhr ich, dass sie meine Tochter, die ich mit meiner französischen Frau gehabt hatte und die mit mir nach Algerien gekommen war, umgebracht hatten. Zur Abschreckung, um mich zu warnen! Ich verliess Algerien mit meiner Frau und zwei Kindern, bekam am 15. August 2002 den Status B humanitaire. Über die Asylheime Vallorbe und Kreuzlingen bin ich nach St. Gallen gekommen. Ich hatte keine Probleme mit der Sprache und mit der Kultur, im Gegenteil, ich hatte von den Pères blancs eine Kultur des gegenseitigen Respektes gelernt. Ich erlebte auch keinen Rassismus in der Schweiz wie zum Beispiel in Frankreich. Ich habe im Restaurant Marktplatz als Küchenhilfe gearbeitet, dann im Restaurant Bäumli, manchmal über 50 Stunden die Woche. Dann, als Lagerist bei der Migros, erlitt ich einen Arbeitsunfall. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, bekomme eine IV-Rente, aber ich empfinde das Leben ohne Arbeit wie eine Strafe. Ich war wie zerschlagen nach dem Unfall, muss jetzt all die Stücke wieder zusammenbringen. Zum Glück hatte ich den Unfall nicht in Algerien. Dort wird nach dem Geldbeutel operiert und die Ratten kriechen durch die Gänge. Säuglinge liegen bis zu viert in einem kleinen Bett.
Meine Tochter hat eine gute Stelle in einer Apotheke, meinem Sohn geht es nicht gut, er hat Probleme mit dem Alkohol.
Ich habe ähnlich wie Hiob einige Schicksalsschläge erlitten. Erst als Waisenkind, da haben mir die Pères blancs geholfen. Dann, als meine Tochter umgebracht und mein Hof zerstört wurde. Und jetzt mit dem Unfall, der meine Rückenwirbel zerschlagen hat.
Ich muss mir immer wieder sagen, doch, mein Leben ist gelungen, die Pères blancs haben mich geliebt, in Frankreich habe ich ein Restaurant geführt, in Algerien einen Hof übernommen und modernisiert und auch in der Schweiz fleissig meine Arbeit gemacht.
Unsere beiden ältesten Kinder, die in Algerien geblieben sind, haben den Hof übernommen und führen ihn jetzt weiter. Wenn ich arbeiten könnte, würde ich wieder nach Algerien gehen und meinen Kindern auf dem Hof helfen. Ich könnte das Gemüse sortieren, das schöne für den Markt, das andere für die Armen oder für die eigene Küche.
anonym
Ich wurde im Januar 1954 in Kabylie, einer Gegend in Algerien, geboren. Ich wuchs auf bei den Eltern von meinem Vater und seinen Cousins, weil er selbst als Kommandant gegen Frankreich für die Unabhängigkeit Algeriens kämpfte. Meine Mutter lebte mal hier, mal dort, weil sie als Frau eines Kommandanten gesucht wurde. Erst nach 1962, der Unabhängigkeit Algeriens, konnte sie frei leben. Ich habe meinen Vater ein einziges Mal gesehen, im Februar 1958. Frere Jean hatte dieses Treffen damals arrangiert, indem er vorgab, er müsse mit mir in ein Spital in einer Stadt 150 km entfernt, wo mein Vater mit seiner Truppe war. Ich habe nur vage Erinnerungen an ihn, sehe ihn noch vor mir, den Mann in Uniform, der mir eigentlich fremd war. Kurz darauf ist er im Krieg gestorben.
Als dreijähriger Knabe kam ich zu den Pères blancs, die bald zu meiner Familie wurden. Als wäre ich dort geboren! Die drei Monate Schulferien, während denen ich bei den Eltern meines Vaters und seinen Cousins lebte, waren für mich die Hölle, weil eine andere Kultur herrschte, eine Kultur der Auseinander- und Durchsetzung, des „jeder für sich“, während ich bei den Pères blancs einen respektvollen Umgang, andere Sitten und andere Gewohnheiten gelernt hatte. Besonders Père Jean war wie mein Vater, ein ausserordentlicher Mensch, der sein Herz auf der Hand trug und mit einem milden Lächeln die Konflikte löste. Ich habe vier ältere Schwestern, aber wie gesagt, meine Familie war die Schule der Pères blancs. Ich lernte dort viele praktische Dinge wie Mauern hochziehen, Elektrisches reparieren, Feldarbeit oder mit Tieren umgehen. Wenn Père Jean mich mal fünf Minuten nicht sah, suchte er mich, er liess mich ein Bedürfnis nie länger haben. Wenn andere spielten, zog ich mich zurück und las Molière, Baudelaire und andere, hätte gerne Theater gemacht, merkte aber bald, dass ich darin kein Talent hatte. Nachdem meine Grossmutter 1972 gestorben war, wollte mich meine Familie zurückholen, aber ich wollte bei den Pères blancs bleiben.
Im Jahr 1978 wanderte ich nach Frankreich aus. Grossvater gab mir ein bisschen Geld, damit ich mir dort eine Existenz aufbauen konnte. Natürlich gab es Vorurteile gegenüber Algeriern, da ich aber die französische Kultur gut kannte, gelang mir die Integration in Paris sehr gut. Ich arbeitete in der Küche und in der Bar oder als Garçon, und eröffnete schliesslich ein eigenes Restaurant, eine Couscoussière mit französischen und algerischen Spezialitäten. Acht Personen arbeiteten für mich, ich hatte aber trotzdem viel Arbeit, musste alles andere vergessen, ich war mit meiner Arbeit verheiratet. Ich wollte keine Kunden verlieren, deshalb war mir der Empfang ganz wichtig, die Gäste sollten sich von Anfang an wohl fühlen. Oui, j’ai jouer sur l’acceuil. Das Restaurant existierte noch bis 2012, danach wurde es an eine Versicherungsgesellschaft verkauft.
Während meiner Zeit in Frankreich hatte ich drei Liebesbeziehungen, aber die ersten beiden scheiterten, weil ich zu viel arbeitete, die dritte daran, dass sie mir nicht nach Algerien folgen wollte, denn nach dem Tod meines Grossvaters, 1992, kehrte ich heim, um den Hof zu übernehmen. Die Verbindung zu meinem Grossvater war die ganze Zeit über sehr eng gewesen, wenn wir nicht alle vier Tage miteinander telefonierten, wurden wir krank. Er war Ingenieur in Agronomie und vertraute mir voll und ganz. Er starb in meinen Armen. Am tiefsten aber war meine Beziehung zu Pére Jean, ihm öffnete ich mein ganzes Herz. Wenn ich ihm Vater sagte, kamen ihm die Tränen.
Nach meiner Rückkehr begann ich den Hof zu modernisieren, kaufte einen Traktor und legte Bewässerungssysteme an. Ich liebe Tiere und Pflanzen. Meines Erachtens ist es ein Verbrechen, Tiere zu kastrieren. Ich hatte im Winter 10‘000 Hühner und im Sommer 15‘000, über 80‘0000 Kücken und 500 bis 1000 Schafe. Doch schon im Jahr 1993 begann die algerische Mafia aktiv zu werden und verlangte Geld von mir. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1997 haben sie in Betalha ein Massacker angerichtet. Es wird berichtet, die Mörder seien Islamisten gewesen, aber die algerische Armee stand dem Massacker Pate, indem sie die Stadt vor möglicher Hilfe abriegelte und die Mörder entkommen liess. Die Regierung unter Liamine Zeroual produzierte Terroristen.
Seit Dezember 1991 war das Leben in Algerien sehr schwierig, 1992 brach der Bürgerkrieg aus. 5 Tage vor den ersten freien Parlamentswahlen putschte die Armee und brachte die islamische Heilsfront (FIS) um den sicheren Sieg. Dieser Partei angehörige Menschen wurden in die Wüste deportiert und gefoltert. Die Armee schoss auf Menschen, niemand durfte etwas sagen, und wenn jemand etwas sagte, wurde er deportiert. Überall war die Polizei, die Regierung proklamierte, alle Ausländer müssten das Land verlassen. Ich erinnere mich, dass Menschen T-shirts mit folgender Aufschrift trugen: on ne peut pas nous tuer, nous sommes deja mort. 1994 wurde Père Jean und drei andere Pères blancs in Tizi Ouzou getötet. Es war ein Schock für mich. An die Beerdigung kamen viele Menschen, weil die Pères blancs so viel Gutes getan hatten. Sie führten eine Art Sekretariat für Menschen, die nicht schreiben konnten und, weil sie von weit her kamen, im Schulhaus übernachteten duften. Sie gaben Kleider und Schuhe ab an Menschen, die kaum etwas besassen. Tausende kamen an die Beerdigung. Wir sagten vor ausländischen Journalisten, dass sie nicht von Terroristen, sondern von der Spezialeinheit der Armee umgebracht wurden. Seither galt ich als gefährlich. Ich wurde eingesperrt, war 21 Monate lang im Gefängnis, wurde von einem ins andere Gefängnis gebracht und immer hiess es, das Dossier ist noch nicht da, wir können noch nichts entscheiden. Wir waren 63 Gefangene auf 40 bis 50 Quadratmeter, sahen kein Licht den ganzen Tag. Am 1. November 2001 wurde ich endlich aus dem Gefängnis entlassen, da erfuhr ich, dass sie meine Tochter, die ich mit meiner französischen Frau gehabt hatte und die mit mir nach Algerien gekommen war, umgebracht hatten. Zur Abschreckung, um mich zu warnen! Ich verliess Algerien mit meiner Frau und zwei Kindern, bekam am 15. August 2002 den Status B humanitaire. Über die Asylheime Vallorbe und Kreuzlingen bin ich nach St. Gallen gekommen. Ich hatte keine Probleme mit der Sprache und mit der Kultur, im Gegenteil, ich hatte von den Pères blancs eine Kultur des gegenseitigen Respektes gelernt. Ich erlebte auch keinen Rassismus in der Schweiz wie zum Beispiel in Frankreich. Ich habe im Restaurant Marktplatz als Küchenhilfe gearbeitet, dann im Restaurant Bäumli, manchmal über 50 Stunden die Woche. Dann, als Lagerist bei der Migros, erlitt ich einen Arbeitsunfall. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, bekomme eine IV-Rente, aber ich empfinde das Leben ohne Arbeit wie eine Strafe. Ich war wie zerschlagen nach dem Unfall, muss jetzt all die Stücke wieder zusammenbringen. Zum Glück hatte ich den Unfall nicht in Algerien. Dort wird nach dem Geldbeutel operiert und die Ratten kriechen durch die Gänge. Säuglinge liegen bis zu viert in einem kleinen Bett.
Meine Tochter hat eine gute Stelle in einer Apotheke, meinem Sohn geht es nicht gut, er hat Probleme mit dem Alkohol.
Ich habe ähnlich wie Hiob einige Schicksalsschläge erlitten. Erst als Waisenkind, da haben mir die Pères blancs geholfen. Dann, als meine Tochter umgebracht und mein Hof zerstört wurde. Und jetzt mit dem Unfall, der meine Rückenwirbel zerschlagen hat.
Ich muss mir immer wieder sagen, doch, mein Leben ist gelungen, die Pères blancs haben mich geliebt, in Frankreich habe ich ein Restaurant geführt, in Algerien einen Hof übernommen und modernisiert und auch in der Schweiz fleissig meine Arbeit gemacht.
Unsere beiden ältesten Kinder, die in Algerien geblieben sind, haben den Hof übernommen und führen ihn jetzt weiter. Wenn ich arbeiten könnte, würde ich wieder nach Algerien gehen und meinen Kindern auf dem Hof helfen. Ich könnte das Gemüse sortieren, das schöne für den Markt, das andere für die Armen oder für die eigene Küche.
anonym
Trinken Sie ihren Tee mit oder ohne Zucker
Ich werde von einer alleinerziehenden Mutter, Äthiopierin, zu einer Tasse Tee eingeladen. Plötzlich tut sich mir eine neue Welt auf.
Frau F., ruft beim Kath. Sozialdienst Ost an. Sie möchte einen Termin vereinbaren. Sie ist Äthiopierin, alleinerziehende Mutter einer 5-jährigen Tochter, geschieden, wohnt seit 13 Jahren in St. Gallen und arbeitet als Reinigungsangestellte. Sie fragt mich, ob ich ihr helfen könne beim Ausfüllen eines Formulars für das Migrationsamt. Es geht um die Aufenthaltsbewilligung. Zudem möchte sie den Betrag, den sie nach der Scheidung vom Sozialamt erhalten habe zurückbezahlen. „Keine Schulden mehr beim Staat haben,- auf eigenen Füssen stehen“,- das ist ihr Ziel. Ich vereinbare mit dem Sozialamt Ratenzahlungen.
Frau F. möchte mich unbedingt einladen zu Tee und Kuchen. Sie wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich besuche sie. Am Tisch sitzen ihre Freundinnen – ebenfalls Äthiopierinnen. Die Frauen plaudern angeregt. Als ich mich hinsetze, bemühen sie sich deutsch zu sprechen. Die Atmosphäre ist herzlich, fröhlich und unkompliziert. Ich sitze in dieser „fremden“ Wohnung. Die Sprache, der Duft, die farbigen Kleider erinnern mich an ferne Länder. Und dennoch fühle ich mich irgendwie „zu Hause“. Frau F. giesst Tee in meine Tasse und reicht mir die Zuckerdose. Ich bedanke mich: „Ich nehme keinen Zucker.“ Die Frauen lachen. Eine sagt schalkhaft: „Wenn wir unseren Tee einmal ohne Zucker trinken, sind wir in der Schweiz integriert.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Frau F., ruft beim Kath. Sozialdienst Ost an. Sie möchte einen Termin vereinbaren. Sie ist Äthiopierin, alleinerziehende Mutter einer 5-jährigen Tochter, geschieden, wohnt seit 13 Jahren in St. Gallen und arbeitet als Reinigungsangestellte. Sie fragt mich, ob ich ihr helfen könne beim Ausfüllen eines Formulars für das Migrationsamt. Es geht um die Aufenthaltsbewilligung. Zudem möchte sie den Betrag, den sie nach der Scheidung vom Sozialamt erhalten habe zurückbezahlen. „Keine Schulden mehr beim Staat haben,- auf eigenen Füssen stehen“,- das ist ihr Ziel. Ich vereinbare mit dem Sozialamt Ratenzahlungen.
Frau F. möchte mich unbedingt einladen zu Tee und Kuchen. Sie wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich besuche sie. Am Tisch sitzen ihre Freundinnen – ebenfalls Äthiopierinnen. Die Frauen plaudern angeregt. Als ich mich hinsetze, bemühen sie sich deutsch zu sprechen. Die Atmosphäre ist herzlich, fröhlich und unkompliziert. Ich sitze in dieser „fremden“ Wohnung. Die Sprache, der Duft, die farbigen Kleider erinnern mich an ferne Länder. Und dennoch fühle ich mich irgendwie „zu Hause“. Frau F. giesst Tee in meine Tasse und reicht mir die Zuckerdose. Ich bedanke mich: „Ich nehme keinen Zucker.“ Die Frauen lachen. Eine sagt schalkhaft: „Wenn wir unseren Tee einmal ohne Zucker trinken, sind wir in der Schweiz integriert.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
The first cut is the deepest (erster Teil)
Herr B. erzählt, welches Ereignis bei ihm eine anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere ausgelöst hat.
Frühsommer 1996. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, damals in einem Behindertenheim in Teufen. Noch etwas müde, aber sonst guter Dinge, wollte ich am Kiosk noch Kaffee und Zigaretten kaufen.
Dann, wie ein Hammerschlag von hinten, war die Welt eine andere. Die normale Metapher war ungültig, meine Knie waren nicht wie Pudding. Mein ganzer Körper war kochender Pudding, sodass ich nur noch auf die nächste Bank sinken konnte.
Der Verstand ausgeschaltet, der einzige Gedanke: Du stirbst, in den nächsten Sekunden, Minuten, vielleicht Sunden, aber DU STIRBST.
Die Anzeichen dafür waren klar. Mein Herz schlug nicht mehr oder aber so schnell, dass Sys- und Diastole nicht mehr unterscheidbar waren. Ich atmete nicht mehr oder aber so schnell, dass ich trotzdem keine Luft bekam.
Der einfahrende Zug sah aus wie immer, die Passanten (starrten sie mich nicht alle an) sahen aus wie immer, mein Gefühl sagte mir, dass sie alle aus der Hölle kamen, um mich zu holen.
Ich kannte zwar irrationale Angst seit meiner Jugend, aber das hier war nicht vergleichbar. Ich kam mir vor wie ein 100 m-Läufer, der plötzlich auf dem 41. Kilometer der Marathonstrecke ist, das Laufen ist gleich, die Belastung unendlich anders.
Plötzlich der Gedanke: DU LEBST NOCH.
Damit kam ganz langsam ein Teil meines logischen Denkens zurück.
Ein Check-up hatte ergeben, dass mein Körper erstaunlich gesund war, es gab also keinen Grund zu sterben. Somit musste also die Panik für alle somatischen Reaktionen verantwortlich sein, und, wie jeder Angstpatient bestätigen wird, gibt es nur ein frei erhältliches Medikament gegen Angst: Alkohol.
Nach einiger Zeit traute ich mir zu aufzustehen und ging zum Kiosk. Der Verkäufer starrte mich komisch an, entweder weil ich morgens um sechs drei Underberg kaufte, oder weil mein schweissüberströmtes Gesicht verdächtig wirkte.
Nachdem ich die Schnäpse schnell gekippt hatte, liessen die körperlichen Symptome etwas nach, vor allem aber konnte ich wieder klarer denken. Wenn wenig wenig hilft, hilft viel viel. Also begab ich mich, um besser nachdenken zu können, in die nächste Kneipe und orderte Wodka. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Erstens musste ich am Arbeitsplatz anrufen und mich krankmelden, was einige Zeit später auch möglich war, obwohl meine Angst eigentlich gar keine Handlung erlaubte. Das Zweite war wesentlich schwerer. Ich musste sofort etwas unternehmen, denn das wollte ich nie wieder erleben (ein unerfüllbarer Wunsch, wie ich später noch sehr oft feststellen musste). Das hiess Notfallstation. Ich stärkte mich also – und das ist nicht ironisch gemeint – noch etwa eine Stunde und machte mich auf den Weg. Sobald ich die „sichere“ Beiz verlassen hatte, nahm die Angst wieder zu und als ich beim Spital ankam, war sie wieder so stark, dass ich am liebsten wieder gegangen wäre.
Zu meinem Glück musste ich nicht warten – im Notfall normalerweise unmöglich – und ich muss so mies ausgesehen haben, dass ich nach kurzer Erklärung sofort Valium gespritzt bekam.
Oh segensreiches Benzodiazepin, in kürzester Zeit war ich ein neuer Mensch.
Da ich nie zuvor Benzos bekommen hatte, war die Wirkung verblüffend, mein vorheriger Zustand war nicht mehr spür-, noch nicht einmal nachvollziehbar. Dennoch überredeten mich die Ärzte stationär zu bleiben, was sich auch als sinnvoll erwies, denn sobald das Valium nachliess, musste ich nachschieben.
Und so begann eine bis heute anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere.
anonym
Frühsommer 1996. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, damals in einem Behindertenheim in Teufen. Noch etwas müde, aber sonst guter Dinge, wollte ich am Kiosk noch Kaffee und Zigaretten kaufen.
Dann, wie ein Hammerschlag von hinten, war die Welt eine andere. Die normale Metapher war ungültig, meine Knie waren nicht wie Pudding. Mein ganzer Körper war kochender Pudding, sodass ich nur noch auf die nächste Bank sinken konnte.
Der Verstand ausgeschaltet, der einzige Gedanke: Du stirbst, in den nächsten Sekunden, Minuten, vielleicht Sunden, aber DU STIRBST.
Die Anzeichen dafür waren klar. Mein Herz schlug nicht mehr oder aber so schnell, dass Sys- und Diastole nicht mehr unterscheidbar waren. Ich atmete nicht mehr oder aber so schnell, dass ich trotzdem keine Luft bekam.
Der einfahrende Zug sah aus wie immer, die Passanten (starrten sie mich nicht alle an) sahen aus wie immer, mein Gefühl sagte mir, dass sie alle aus der Hölle kamen, um mich zu holen.
Ich kannte zwar irrationale Angst seit meiner Jugend, aber das hier war nicht vergleichbar. Ich kam mir vor wie ein 100 m-Läufer, der plötzlich auf dem 41. Kilometer der Marathonstrecke ist, das Laufen ist gleich, die Belastung unendlich anders.
Plötzlich der Gedanke: DU LEBST NOCH.
Damit kam ganz langsam ein Teil meines logischen Denkens zurück.
Ein Check-up hatte ergeben, dass mein Körper erstaunlich gesund war, es gab also keinen Grund zu sterben. Somit musste also die Panik für alle somatischen Reaktionen verantwortlich sein, und, wie jeder Angstpatient bestätigen wird, gibt es nur ein frei erhältliches Medikament gegen Angst: Alkohol.
Nach einiger Zeit traute ich mir zu aufzustehen und ging zum Kiosk. Der Verkäufer starrte mich komisch an, entweder weil ich morgens um sechs drei Underberg kaufte, oder weil mein schweissüberströmtes Gesicht verdächtig wirkte.
Nachdem ich die Schnäpse schnell gekippt hatte, liessen die körperlichen Symptome etwas nach, vor allem aber konnte ich wieder klarer denken. Wenn wenig wenig hilft, hilft viel viel. Also begab ich mich, um besser nachdenken zu können, in die nächste Kneipe und orderte Wodka. Zwei Dinge kamen mir in den Sinn. Erstens musste ich am Arbeitsplatz anrufen und mich krankmelden, was einige Zeit später auch möglich war, obwohl meine Angst eigentlich gar keine Handlung erlaubte. Das Zweite war wesentlich schwerer. Ich musste sofort etwas unternehmen, denn das wollte ich nie wieder erleben (ein unerfüllbarer Wunsch, wie ich später noch sehr oft feststellen musste). Das hiess Notfallstation. Ich stärkte mich also – und das ist nicht ironisch gemeint – noch etwa eine Stunde und machte mich auf den Weg. Sobald ich die „sichere“ Beiz verlassen hatte, nahm die Angst wieder zu und als ich beim Spital ankam, war sie wieder so stark, dass ich am liebsten wieder gegangen wäre.
Zu meinem Glück musste ich nicht warten – im Notfall normalerweise unmöglich – und ich muss so mies ausgesehen haben, dass ich nach kurzer Erklärung sofort Valium gespritzt bekam.
Oh segensreiches Benzodiazepin, in kürzester Zeit war ich ein neuer Mensch.
Da ich nie zuvor Benzos bekommen hatte, war die Wirkung verblüffend, mein vorheriger Zustand war nicht mehr spür-, noch nicht einmal nachvollziehbar. Dennoch überredeten mich die Ärzte stationär zu bleiben, was sich auch als sinnvoll erwies, denn sobald das Valium nachliess, musste ich nachschieben.
Und so begann eine bis heute anhaltende Spital- und Psychiatriekarriere.
anonym
Geteilte Angst ist doppelte Angst (zweiter Teil)
Was in Herrn B. vorgeht während jener Zeit, als er Dreh- und Angelpatient der psychiatrischen Klinik war, erzählt er anhand eines Traumes, dem er den Titel „sinnloser Kampf“ gibt.
Ich bin zu Besuch im Haus meiner Kindheit und Jugend. Beim Ausräumen meiner alten Sachen entdecke ich ein Stofftier. Ich beschliesse, es bei einem in der Nähe stattfindenden Flohmarkt zu verschenken. Doch jeder, dem ich es anbiete, sagt, dass es nicht zu ihm passe. Plötzlich merke ich, dass sich das Stoffding in etwas Lebendiges verwandelt. Ich versuche, es loszulassen, aber es klebt an meinen Händen. Spreize ich die Arme auseinander, dehnt es sich entsprechend.
Ich gehe nach Hause in mein Zimmer. Dort wickle ich es um die Türklinke und trete weit zurück, aber das Tierding bleibt kleben. Ab einer gewissen Dehnung reisst es auseinander. Nun stehe ich mit den Füssen auf die herabhängenden Enden, die anderen sind immer noch fest an meinen Händen. Auch hier gibt es wieder einen Riss, manche Teile des noch immer lebenden Wesens kleben nun an anderen Orten meines Körpers, zudem fallen nun kleine Fetzen während des Reissens zu Boden. Dort verwandeln sie sich in eine Art automatisierter Insekten. Da ich sowieso unter einer gut ausgeprägten Entomophobie (Angst vor Insekten) leide, wird die Lage zusehends bedrohlicher.
Immer noch versuchend, mich von den an meinem Körper klebenden, sich windenden Teilen dieses Dinges zu befreien, trete ich nun auf die am Boden befindlichen Stücke. Diese sehen nun aus wie plattbedrückte Kaugummi, teilen sich und wölben sich zu einem neuen Wesen. Voller Ekel und Panik stampfe ich nun hintereinander auf die neu entstandenen Dinger; der Vorgang wiederholt sich und erinnert an die Köpfe der Hydra. Ohne zu überlegen zerre und trete ich weiter. Die Insektendinger werden immer mehr.
Plötzlich merke ich, zu was das alles führen wird. Ich bin in einem geschlossenen Raum, kann mein Tun nicht kontrollieren und mache immer weiter. Da der Boden inzwischen in mehreren Lagen von diesem Zeug bedeckt ist, wird sich das ganze Zimmer in absehbarer Zeit damit füllen und ich werde ersticken. Als mir die Insektenwesen im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Hals stehen, wache ich auf, muss aufstehen, eine rauchen und fernsehen, da ich weiss, wenn ich wieder einschlafe, werden mich die Bilder weiter verfolgen.
Ich bin zu Besuch im Haus meiner Kindheit und Jugend. Beim Ausräumen meiner alten Sachen entdecke ich ein Stofftier. Ich beschliesse, es bei einem in der Nähe stattfindenden Flohmarkt zu verschenken. Doch jeder, dem ich es anbiete, sagt, dass es nicht zu ihm passe. Plötzlich merke ich, dass sich das Stoffding in etwas Lebendiges verwandelt. Ich versuche, es loszulassen, aber es klebt an meinen Händen. Spreize ich die Arme auseinander, dehnt es sich entsprechend.
Ich gehe nach Hause in mein Zimmer. Dort wickle ich es um die Türklinke und trete weit zurück, aber das Tierding bleibt kleben. Ab einer gewissen Dehnung reisst es auseinander. Nun stehe ich mit den Füssen auf die herabhängenden Enden, die anderen sind immer noch fest an meinen Händen. Auch hier gibt es wieder einen Riss, manche Teile des noch immer lebenden Wesens kleben nun an anderen Orten meines Körpers, zudem fallen nun kleine Fetzen während des Reissens zu Boden. Dort verwandeln sie sich in eine Art automatisierter Insekten. Da ich sowieso unter einer gut ausgeprägten Entomophobie (Angst vor Insekten) leide, wird die Lage zusehends bedrohlicher.
Immer noch versuchend, mich von den an meinem Körper klebenden, sich windenden Teilen dieses Dinges zu befreien, trete ich nun auf die am Boden befindlichen Stücke. Diese sehen nun aus wie plattbedrückte Kaugummi, teilen sich und wölben sich zu einem neuen Wesen. Voller Ekel und Panik stampfe ich nun hintereinander auf die neu entstandenen Dinger; der Vorgang wiederholt sich und erinnert an die Köpfe der Hydra. Ohne zu überlegen zerre und trete ich weiter. Die Insektendinger werden immer mehr.
Plötzlich merke ich, zu was das alles führen wird. Ich bin in einem geschlossenen Raum, kann mein Tun nicht kontrollieren und mache immer weiter. Da der Boden inzwischen in mehreren Lagen von diesem Zeug bedeckt ist, wird sich das ganze Zimmer in absehbarer Zeit damit füllen und ich werde ersticken. Als mir die Insektenwesen im wahrsten Sinn des Wortes bis zum Hals stehen, wache ich auf, muss aufstehen, eine rauchen und fernsehen, da ich weiss, wenn ich wieder einschlafe, werden mich die Bilder weiter verfolgen.
Schmerzhafte Heilung (dritter Teil)
Herr B. hat einen Traum, der ihn ganz überraschend von seinen Glieder- und Rückenschmerzen befreit.
Ich wohne ihn einem riesigen Haus, das aussieht, als sei es von Escher und H.R. Giger gemeinsam konstruiert worden. Um von einem Zimmer meiner Wohnung zu einem andern zu kommen, muss ich zum Teil andere Wohnungen durchqueren.
In einer Art Gemeinschaftsraum treffe ich auf meine Oma, die sagt, dass sie in den letzten Jahren mehrere sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte. Auf meine Bemerkung, dass das mit 91 eine respektable Leistung sei, werde ich von den anderen Anwesenden als zynisch beschimpft. Erst jetzt bemerke ich, dass sich sehr viele Leute im Raum befinden. Und zwar sind es Menschen, die ich in meinem Leben mehr oder weniger gut kennengelernt habe. Alle sind der „besseren“ Gesellschaft zuzuordnen, sei es aufgrund von Status – Rechtsanwälte, Zahnärzte, Politiker etc. – oder Intellekt, z.B. viele Mitstudenten oder Dozenten von Früher. Auch Teile meiner Familie sind dabei.
Obwohl sie alle so aussehen wie früher, habe ich das Gefühl, dass sie sich auf irgendeine Art ähneln.
Als die Angriffe gegen mich immer heftiger werden, beschliesse ich, in meine Wohnung zurückzukehren. Dort ankommend stelle ich fest, dass alle meine persönlichen Sachen verschwunden sind. Ebenso wurden meine Schlösser ausgetauscht.
Als ich mit der Polizei wieder komme, ist meine Wohnung in eine Bar umgebaut, deren Besitzer und Gäste „diese Leute“ sind.
Szenenwechsel: ein Ferienort (Spanien?)
Zunächst ist alles schön, ich bin froh, mich erholen zu können. Plötzlich erkenne ich immer mehr mir bekannte Gesichter. Es stellt sich heraus, dass „diese Leute“ auch hier sind. Als sie mich allein finden, schlagen sie mich brutal zusammen, die Polizei sagt mir, sie könne nicht helfen.
In der Hoffnung, irgendwo Zuflucht zu finden, entdecke ich beim Gang durch die Stadt das Haus einer religiösen Gemeinschaft und die netten Menschen dort versichern mir, dass sie mich schützen werden. Mit der Zeit fällt mir auf, dass sich die Mitglieder auf irgendeine Weise ähnlich sind.
In dem Moment entpuppen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes als „diese Leute“. Sie brechen mir mit Baseballschlägern die Glieder, stechen mit Messern auf mich ein und prügeln mich schliesslich zu Tode.
In diesem Moment erwache ich (es wäre mir lieber gewesen, dies wäre früher geschehen).
Epilog
Normalerweise würde jeder – inklusive mir – das Ganze als Ausdruck meiner paranoiden Persönlichkeitsstruktur werten. Das Lustige am Ganzen ist Folgendes: Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich am ganzen Körper solche Schmerzen, dass ich zur Beruhigungszigarette in die Stube kriechen musste. Als ich schliesslich doch noch auf dem Sofa einschlief und wieder erwachte, waren die starken Glieder- und Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, vollkommen verschwunden.
Ich wohne ihn einem riesigen Haus, das aussieht, als sei es von Escher und H.R. Giger gemeinsam konstruiert worden. Um von einem Zimmer meiner Wohnung zu einem andern zu kommen, muss ich zum Teil andere Wohnungen durchqueren.
In einer Art Gemeinschaftsraum treffe ich auf meine Oma, die sagt, dass sie in den letzten Jahren mehrere sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte. Auf meine Bemerkung, dass das mit 91 eine respektable Leistung sei, werde ich von den anderen Anwesenden als zynisch beschimpft. Erst jetzt bemerke ich, dass sich sehr viele Leute im Raum befinden. Und zwar sind es Menschen, die ich in meinem Leben mehr oder weniger gut kennengelernt habe. Alle sind der „besseren“ Gesellschaft zuzuordnen, sei es aufgrund von Status – Rechtsanwälte, Zahnärzte, Politiker etc. – oder Intellekt, z.B. viele Mitstudenten oder Dozenten von Früher. Auch Teile meiner Familie sind dabei.
Obwohl sie alle so aussehen wie früher, habe ich das Gefühl, dass sie sich auf irgendeine Art ähneln.
Als die Angriffe gegen mich immer heftiger werden, beschliesse ich, in meine Wohnung zurückzukehren. Dort ankommend stelle ich fest, dass alle meine persönlichen Sachen verschwunden sind. Ebenso wurden meine Schlösser ausgetauscht.
Als ich mit der Polizei wieder komme, ist meine Wohnung in eine Bar umgebaut, deren Besitzer und Gäste „diese Leute“ sind.
Szenenwechsel: ein Ferienort (Spanien?)
Zunächst ist alles schön, ich bin froh, mich erholen zu können. Plötzlich erkenne ich immer mehr mir bekannte Gesichter. Es stellt sich heraus, dass „diese Leute“ auch hier sind. Als sie mich allein finden, schlagen sie mich brutal zusammen, die Polizei sagt mir, sie könne nicht helfen.
In der Hoffnung, irgendwo Zuflucht zu finden, entdecke ich beim Gang durch die Stadt das Haus einer religiösen Gemeinschaft und die netten Menschen dort versichern mir, dass sie mich schützen werden. Mit der Zeit fällt mir auf, dass sich die Mitglieder auf irgendeine Weise ähnlich sind.
In dem Moment entpuppen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes als „diese Leute“. Sie brechen mir mit Baseballschlägern die Glieder, stechen mit Messern auf mich ein und prügeln mich schliesslich zu Tode.
In diesem Moment erwache ich (es wäre mir lieber gewesen, dies wäre früher geschehen).
Epilog
Normalerweise würde jeder – inklusive mir – das Ganze als Ausdruck meiner paranoiden Persönlichkeitsstruktur werten. Das Lustige am Ganzen ist Folgendes: Nachdem ich aufgewacht war, hatte ich am ganzen Körper solche Schmerzen, dass ich zur Beruhigungszigarette in die Stube kriechen musste. Als ich schliesslich doch noch auf dem Sofa einschlief und wieder erwachte, waren die starken Glieder- und Rückenschmerzen, die ich seit Wochen hatte, vollkommen verschwunden.
Yamabushi (vierter Teil)
Der Mann, der auf dieser Webseite das Pilgertagebuch geschrieben hat, hielt das Leben als Sozialhilfebezüger in der Stadt nicht mehr aus und fand eine günstige Wohnung in einem abgelegenen Tal. Dort lebte er über Monate sehr zurückgezogen und einsam. Dann begann er wieder zu schreiben.
Vor Jahren habe ich in irgendeinem Roman den Begriff Hauptbuch das erste Mal gelesen. Ich vermutete kontextmässig, dass es sich um etwas aus dem Geschäftsleben handelte. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, sollte es vermutlich mal googlen, aber das Wort ging mir nicht aus dem Kopf. Zudem habe ich es irgendwie mit Jungs Rotem Buch assoziiert und gedenke nun jetzt und hiermit etwas Ähnliches für mich und posthum vielleicht für andere zu verfassen.
Es soll Gedanken über grundsätzliche Probleme vor allem meines Lebens, aber auch über einfach alles enthalten.
Bevor ich aber eine ausführliche Vorrede verfasse, was ich in Abständen stückweise auch noch vorhabe, gehe ich direkt zu einem sehr aktuellen und dennoch für mich prinzipiellen Thema.
Die grundlegende Problematik ist, dass ich bei den meisten Dingen weiss, was richtig ist und was ich tun sollte. Aber mir stehen mein Trotz (negativ) und meine Abneigung (positiv) gegen Fremdbestimmung im Weg. Zurzeit geht es um Nicht-Rauchen und Fasten. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich beides kann, dass es mir gut tut und dass ich dadurch andere Probleme besser lösen kann und die Freiheit habe, das zu tun, was ich wirklich will.
Im Moment hält mich Geldmangel ab von meinem Ideal des Yamabushi (japanischer Eremit, der sich der Askese widmet), der ich nach meinem Umzug in die Berge gerne wäre, aber Askese ist nur dann möglich, wenn sie freiwillig geschieht, nicht, wenn ich durch Staatsbürokratie in die Armut gepresst werde.
Dies waren seine letzten Sätze. Der Vermieter fand ihn tot in seiner Wohnung. Die Ärzte vermuteten, dass er an übermässigem Konsum von Medikamenten und Alkohol gestorben war.
Vor Jahren habe ich in irgendeinem Roman den Begriff Hauptbuch das erste Mal gelesen. Ich vermutete kontextmässig, dass es sich um etwas aus dem Geschäftsleben handelte. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, sollte es vermutlich mal googlen, aber das Wort ging mir nicht aus dem Kopf. Zudem habe ich es irgendwie mit Jungs Rotem Buch assoziiert und gedenke nun jetzt und hiermit etwas Ähnliches für mich und posthum vielleicht für andere zu verfassen.
Es soll Gedanken über grundsätzliche Probleme vor allem meines Lebens, aber auch über einfach alles enthalten.
Bevor ich aber eine ausführliche Vorrede verfasse, was ich in Abständen stückweise auch noch vorhabe, gehe ich direkt zu einem sehr aktuellen und dennoch für mich prinzipiellen Thema.
Die grundlegende Problematik ist, dass ich bei den meisten Dingen weiss, was richtig ist und was ich tun sollte. Aber mir stehen mein Trotz (negativ) und meine Abneigung (positiv) gegen Fremdbestimmung im Weg. Zurzeit geht es um Nicht-Rauchen und Fasten. Aus Erfahrung weiss ich, dass ich beides kann, dass es mir gut tut und dass ich dadurch andere Probleme besser lösen kann und die Freiheit habe, das zu tun, was ich wirklich will.
Im Moment hält mich Geldmangel ab von meinem Ideal des Yamabushi (japanischer Eremit, der sich der Askese widmet), der ich nach meinem Umzug in die Berge gerne wäre, aber Askese ist nur dann möglich, wenn sie freiwillig geschieht, nicht, wenn ich durch Staatsbürokratie in die Armut gepresst werde.
Dies waren seine letzten Sätze. Der Vermieter fand ihn tot in seiner Wohnung. Die Ärzte vermuteten, dass er an übermässigem Konsum von Medikamenten und Alkohol gestorben war.
Pogrom von Istanbul
Beim Ausfüllen einer Steuererklärung rollt sich anhand eines türkisch geschriebenen Vornamens der lange Schatten einer Biografie aus.
Im Jahr 1955, als 15-jähriges Mädchen, habe sie das Pogrom von Istanbul erlebt: „Gewalttätige Schläger sind am 6. und 7. September in Zügen und Bussen nach Istanbul gereist und haben die Wohnungen von uns Griechen geplündert und die orthodoxen Schulen und Kirchen niedergebrannt. Die Polizei schaute zu. Seither hat mein Vater die Namen von uns Kindern immer auf Türkisch geschrieben.“
Mit 20 Jahren sei sie in die Schweiz gekommen und habe einen Mann geheiratet, der drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes an einem Gehirntumor gestorben sei. Danach habe sie wieder geheiratet, einen italienischen Einwanderer. Gearbeitet. Gespart. Sie sei Schweizerin geworden. Nach dem Tod ihres Vaters habe sie die Angst um ihre Mutter geplagt, die jetzt allein in Istanbul gewesen sei. Sie habe sie in die Schweiz geholt, gepflegt sie bis ihrem Tod. Kurz darauf sei ihr zweiter Mann an Krebs gestorben.
Morgen gehe sie wieder zu ihrem Sohn in die Klinik. Bringe ihm Zigaretten und Schokolade.
Er mache Geduld, erzählt die ältere Frau von ihrem Sohn, der schon seit zwei Jahren in der Klinik ist. Er sei über neunzig Kilo. Sie bringe ihm Schokolade und Zigaretten. Er glaube an UFOs. Nein, die gibt es doch nicht, sage sie zu ihm. Er würde alles lieber aufgeben als seinen Glauben an UFOs – und an die Scientologen. Mit 17 sei er da reingerutscht.
Ich sehe das 15-jährige Mädchen vor mir, wie es die gewalttätige Horde näher kommen hört und verzweifelt hofft, eine wundersame Macht möge sie und ihre Familie retten.
Er mache Geduld.
Ich sehe den jungen Mann vor mir, als modellierte er die Geduld seiner Mutter und seine eigene, die immer noch auf den Vater wartet. Was wird sein, wenn die Skulptur abgedeckt wird?
Gemeinsam füllen wir die Steuererklärung aus. Während ich Bankauszüge und Rentenbescheinigungen durchblättere, entsteht ein Augenblick der Stille.
„Was kann ich tun“, fragt sie,“ ausser beten?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Im Jahr 1955, als 15-jähriges Mädchen, habe sie das Pogrom von Istanbul erlebt: „Gewalttätige Schläger sind am 6. und 7. September in Zügen und Bussen nach Istanbul gereist und haben die Wohnungen von uns Griechen geplündert und die orthodoxen Schulen und Kirchen niedergebrannt. Die Polizei schaute zu. Seither hat mein Vater die Namen von uns Kindern immer auf Türkisch geschrieben.“
Mit 20 Jahren sei sie in die Schweiz gekommen und habe einen Mann geheiratet, der drei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes an einem Gehirntumor gestorben sei. Danach habe sie wieder geheiratet, einen italienischen Einwanderer. Gearbeitet. Gespart. Sie sei Schweizerin geworden. Nach dem Tod ihres Vaters habe sie die Angst um ihre Mutter geplagt, die jetzt allein in Istanbul gewesen sei. Sie habe sie in die Schweiz geholt, gepflegt sie bis ihrem Tod. Kurz darauf sei ihr zweiter Mann an Krebs gestorben.
Morgen gehe sie wieder zu ihrem Sohn in die Klinik. Bringe ihm Zigaretten und Schokolade.
Er mache Geduld, erzählt die ältere Frau von ihrem Sohn, der schon seit zwei Jahren in der Klinik ist. Er sei über neunzig Kilo. Sie bringe ihm Schokolade und Zigaretten. Er glaube an UFOs. Nein, die gibt es doch nicht, sage sie zu ihm. Er würde alles lieber aufgeben als seinen Glauben an UFOs – und an die Scientologen. Mit 17 sei er da reingerutscht.
Ich sehe das 15-jährige Mädchen vor mir, wie es die gewalttätige Horde näher kommen hört und verzweifelt hofft, eine wundersame Macht möge sie und ihre Familie retten.
Er mache Geduld.
Ich sehe den jungen Mann vor mir, als modellierte er die Geduld seiner Mutter und seine eigene, die immer noch auf den Vater wartet. Was wird sein, wenn die Skulptur abgedeckt wird?
Gemeinsam füllen wir die Steuererklärung aus. Während ich Bankauszüge und Rentenbescheinigungen durchblättere, entsteht ein Augenblick der Stille.
„Was kann ich tun“, fragt sie,“ ausser beten?“
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Flash
Ich fragte den jungen Mann, wie es sich denn anfühle, wenn man einen „Flash reinziehe“, was denn da in einem vorgehe. Zur nächsten Beratung brachte er ein Mundartgedicht mit.
Bimena Flash fühlsch di wiä neu gebora
doch chum i druf hei weiss i, jetzt gits heissi Ohre
doch leider gits au Zita do hesch kei Cash
denn merksch au, du vermissisch da Flash
denn wennd druf bisch, bisch i dinera eigna Welt
doch leider got au druf dis letschti Geld
denn endlich bim ena Neujahrs Ziel han is grafft
Droge bringend nüt und hans mit letschter Chraft
usem Droge Kreis use gschafft –
doch am Kiffe han i no nöd ganz chöna entflücha
i dua jetzt no gern mol amena Joint zücha
Christoph Zanotti
Bimena Flash fühlsch di wiä neu gebora
doch chum i druf hei weiss i, jetzt gits heissi Ohre
doch leider gits au Zita do hesch kei Cash
denn merksch au, du vermissisch da Flash
denn wennd druf bisch, bisch i dinera eigna Welt
doch leider got au druf dis letschti Geld
denn endlich bim ena Neujahrs Ziel han is grafft
Droge bringend nüt und hans mit letschter Chraft
usem Droge Kreis use gschafft –
doch am Kiffe han i no nöd ganz chöna entflücha
i dua jetzt no gern mol amena Joint zücha
Christoph Zanotti
Das Heim hat mich hart gemacht
Der junge Mann kennt seine Eltern nicht. Ab dem 10. Lebenstag kam er zu den Grosseltern. Als sich diese überfordert fühlten, wurde er in ein Heim eingewiesen.
Ab dem 10. Lebenstag bin ich zu den Grosseltern gekommen. Alkohol und Gewaltprobleme waren kein Fremdwort in dieser Familie. Opa war ein Schläger, er war oft besoffen und schlug Oma ab und zu. Er brauchte jeden Tag ein Flasche Wein auf dem Tisch, wenn er von der Schichtarbeit bei der Ems-Chemie nach Hause kam.
Nach seiner Pensionierung wurden die Alkoholexzesse immer schlimmer. Dies sprach sich bei uns im Dorf schnell herum. Auch meine schulischen Leistungen litten dadurch sehr. Niemand half mir bei den Aufgaben. Das Verhalten dieses Schülers ist für unsere Schule nicht mehr akzeptierbar, stand in einem Brief von der Schule. Was ich getan habe? Gefurzt im Klassenzimmer oder an die Lehrerin Liebesbriefe geschrieben. Auch meine damaligen Erziehungsberechtigen kamen mit mir nicht mehr zu Rand. Wenn es hiess, um acht Uhr abends zuhause zu sein, kam ich nach Mitternacht nach Hause. Schliesslich flog ich von der Schule, worauf meinen Grosseltern die elterliche Gewalt entzogen wurde und ich einen Vormund bekam. Wir gingen Heime anschauen, zwei Monate später war ich im Kinderdorf St. Iddaheim in Lütisburg. Im Heim begann es mit Regeln, die vorher für mich ein Fremdwort waren. Hänseleien auf dem Schulplatz wegen meinem Übergewicht waren an der Tagesordnung. Eines Tages kam es sogar soweit, dass ich von einem andern Heiminsassen in der Morgenpause grundlos auf die Fresse bekommen habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich etwas ändern muss. Ich ging auf den zu, der mich hänselte, und sagte: Brauchst du ein Problem, dann sage es. Wenn er ja sagte, haute ich ihm eins in die Fresse. Geh ja nicht rätschen, bläute ich ihm ein. So habe ich mir Respekt verschafft.
Auch das Heim hatte andere Vorstellungen von ihrem neuen Heiminsassen aus dem Bündnerland. Die Leiter beschlossen, dass ich eine Abspeckdiät machen müsse. Wenn es hiess, wer will noch, durften die anderen aufheben, aber mir verweigerten sie einen Zuschlag. Gegessen wurde, was auf den Tisch kam, auch wenn man es nicht gerne hatte. Man bekam das gleiche Essen so lange vorgesetzt, bis man den Teller leer hatte. Erst ab diesem Zeitpunkt bekam man wieder das gleiche Essen wie die andern. Fenchel ass ich trotzdem nie. Ich steckte ihn in die Hosentasche und warf ihn ins WC.
Es gab 2 Mädchenhäuser und 10 Knabenhäuser, über 100 Insassen insgesamt. Händchenhalten war verboten. Ich wollte nur nach Hause. Bis der Hausleiter wie zu meinem Vater wurde, hatte ich ständig Probleme mit meinem Aufenthalt im Heim. Mein Gewicht reduzierte sich sehr stark durch intensives Mitmachen bei sportlicher Betätigung und bei den Freizeitbeschäftigungen. Plötzlich konnte ich wieder essen so viel ich wollte. Trotzdem war es für mich immer noch wie im Gefängnis. Die Grosseltern kamen nur zu meiner Firmung ins Heim. Ab dem sechsten Monat bekam ich den ersten Urlaub. Ich hatte nichts zu erzählen, weil ich nicht im Urlaub und nicht in den Ferien war, keinen Besuch hatte. Jeder Mitschüler hatte normalerweise etwas zu erzählen, ob nun vom Urlaub oder von den schönen Sommerferien. Ich war in den vier Jahren praktisch nur im Heim. Nachdem jener Hausleiter, der für mich wie ein Vater war, das Heim verlassen hatte, liess ich niemanden an mich heran, und fiel wieder in ein Loch. Mein Verhalten gegenüber meinen damaligen Mitinsassen, der Lehrerschaft und auch dem Heimpersonal war nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund flog ich nach meiner 4-jährigen Gefängniszeit aus dem Heim. Einige waren froh, dass ich gegangen war.
Nach dem Rauswurf aus dem Heim entschied sich die Amtsvormundschaft, dass ich wieder zu meiner Familie gehen darf. Allerdings nur so lange, bis ein neuer Ort für mich gefunden wurde. Ein neues Gefängnis wurde schon nach 2 Monaten gefunden. Dieses Mal kein Heim, sondern ein Internat für schwer Erziehbare, das Pestalozziheim in Birr-Lupfig.
anonym
Ab dem 10. Lebenstag bin ich zu den Grosseltern gekommen. Alkohol und Gewaltprobleme waren kein Fremdwort in dieser Familie. Opa war ein Schläger, er war oft besoffen und schlug Oma ab und zu. Er brauchte jeden Tag ein Flasche Wein auf dem Tisch, wenn er von der Schichtarbeit bei der Ems-Chemie nach Hause kam.
Nach seiner Pensionierung wurden die Alkoholexzesse immer schlimmer. Dies sprach sich bei uns im Dorf schnell herum. Auch meine schulischen Leistungen litten dadurch sehr. Niemand half mir bei den Aufgaben. Das Verhalten dieses Schülers ist für unsere Schule nicht mehr akzeptierbar, stand in einem Brief von der Schule. Was ich getan habe? Gefurzt im Klassenzimmer oder an die Lehrerin Liebesbriefe geschrieben. Auch meine damaligen Erziehungsberechtigen kamen mit mir nicht mehr zu Rand. Wenn es hiess, um acht Uhr abends zuhause zu sein, kam ich nach Mitternacht nach Hause. Schliesslich flog ich von der Schule, worauf meinen Grosseltern die elterliche Gewalt entzogen wurde und ich einen Vormund bekam. Wir gingen Heime anschauen, zwei Monate später war ich im Kinderdorf St. Iddaheim in Lütisburg. Im Heim begann es mit Regeln, die vorher für mich ein Fremdwort waren. Hänseleien auf dem Schulplatz wegen meinem Übergewicht waren an der Tagesordnung. Eines Tages kam es sogar soweit, dass ich von einem andern Heiminsassen in der Morgenpause grundlos auf die Fresse bekommen habe. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich etwas ändern muss. Ich ging auf den zu, der mich hänselte, und sagte: Brauchst du ein Problem, dann sage es. Wenn er ja sagte, haute ich ihm eins in die Fresse. Geh ja nicht rätschen, bläute ich ihm ein. So habe ich mir Respekt verschafft.
Auch das Heim hatte andere Vorstellungen von ihrem neuen Heiminsassen aus dem Bündnerland. Die Leiter beschlossen, dass ich eine Abspeckdiät machen müsse. Wenn es hiess, wer will noch, durften die anderen aufheben, aber mir verweigerten sie einen Zuschlag. Gegessen wurde, was auf den Tisch kam, auch wenn man es nicht gerne hatte. Man bekam das gleiche Essen so lange vorgesetzt, bis man den Teller leer hatte. Erst ab diesem Zeitpunkt bekam man wieder das gleiche Essen wie die andern. Fenchel ass ich trotzdem nie. Ich steckte ihn in die Hosentasche und warf ihn ins WC.
Es gab 2 Mädchenhäuser und 10 Knabenhäuser, über 100 Insassen insgesamt. Händchenhalten war verboten. Ich wollte nur nach Hause. Bis der Hausleiter wie zu meinem Vater wurde, hatte ich ständig Probleme mit meinem Aufenthalt im Heim. Mein Gewicht reduzierte sich sehr stark durch intensives Mitmachen bei sportlicher Betätigung und bei den Freizeitbeschäftigungen. Plötzlich konnte ich wieder essen so viel ich wollte. Trotzdem war es für mich immer noch wie im Gefängnis. Die Grosseltern kamen nur zu meiner Firmung ins Heim. Ab dem sechsten Monat bekam ich den ersten Urlaub. Ich hatte nichts zu erzählen, weil ich nicht im Urlaub und nicht in den Ferien war, keinen Besuch hatte. Jeder Mitschüler hatte normalerweise etwas zu erzählen, ob nun vom Urlaub oder von den schönen Sommerferien. Ich war in den vier Jahren praktisch nur im Heim. Nachdem jener Hausleiter, der für mich wie ein Vater war, das Heim verlassen hatte, liess ich niemanden an mich heran, und fiel wieder in ein Loch. Mein Verhalten gegenüber meinen damaligen Mitinsassen, der Lehrerschaft und auch dem Heimpersonal war nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund flog ich nach meiner 4-jährigen Gefängniszeit aus dem Heim. Einige waren froh, dass ich gegangen war.
Nach dem Rauswurf aus dem Heim entschied sich die Amtsvormundschaft, dass ich wieder zu meiner Familie gehen darf. Allerdings nur so lange, bis ein neuer Ort für mich gefunden wurde. Ein neues Gefängnis wurde schon nach 2 Monaten gefunden. Dieses Mal kein Heim, sondern ein Internat für schwer Erziehbare, das Pestalozziheim in Birr-Lupfig.
anonym
Weihnachtsgeschichte
Ob er eine gute Weihnachtsgeschichte kenne, fragte ich den Mann, der vor wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden war. „Natürlich“, sagte er, „eine, die ich selber erlebt habe.“
Weihnachten sei für ihn kein schönes Fest gewesen, denn er habe seine Mutter zweimal verloren. Das erste Mal, als er ins Heim gekommen sei und das zweite Mal, als sie gestorben sei. Er habe jetzt noch zwei Persönlichkeiten in ihm: Jene vom Heim, die sich allein gelassen fühle und sich mit Wutausbrüchen Luft verschaffe, und jene, die es besser machen wolle, zum Beispiel dem eigenen Sohn ein guter Vater sein. Doch die Vergangenheit habe ihn eingeholt, sein Sohn lebe bei seiner Mutter. Er habe ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen.
„Aber nun zu meiner Weihnachtsgeschichte: Als ich wegen unbezahlten Bussen ins Gefängnis musste, begegnete ich meinem Bruder, der dort Wärter war. Er informierte meine Geschwister und Halbgeschwister, die mir Karten schrieben und mich besuchten. Und diese Weihnachten feiern wir zusammen.“
notiert von Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Weihnachten sei für ihn kein schönes Fest gewesen, denn er habe seine Mutter zweimal verloren. Das erste Mal, als er ins Heim gekommen sei und das zweite Mal, als sie gestorben sei. Er habe jetzt noch zwei Persönlichkeiten in ihm: Jene vom Heim, die sich allein gelassen fühle und sich mit Wutausbrüchen Luft verschaffe, und jene, die es besser machen wolle, zum Beispiel dem eigenen Sohn ein guter Vater sein. Doch die Vergangenheit habe ihn eingeholt, sein Sohn lebe bei seiner Mutter. Er habe ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen.
„Aber nun zu meiner Weihnachtsgeschichte: Als ich wegen unbezahlten Bussen ins Gefängnis musste, begegnete ich meinem Bruder, der dort Wärter war. Er informierte meine Geschwister und Halbgeschwister, die mir Karten schrieben und mich besuchten. Und diese Weihnachten feiern wir zusammen.“
notiert von Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Lebensgschicht in einem Gedicht
Früher habe es ihm geholfen, Gedichte zu schreiben, dann sei das Problem auf dem Blatt Papier gewesen und nicht mehr in ihm, sagte der junge Mann. Warum er denn nicht mehr schreibe, ich würde mich sehr freuen über einen Text von ihm. Das war vor einem Jahr. Gestern aber brachte er ein Gedicht
Nach langer Wartezit übergib i ihne es Gedicht
verfasst mitema Teil vo minera Lebensgschicht
i bi nöd immer ein eifachte gsi
doch dia Zitä sind jetzt verbie
i bin oft vo mim Onkel gschlage worde
doch dä isch für mi scho sit längerem gstorbe
drum bin i scho zimlich fruah uf d'Gass
denn es entwicklet sich än grosse Hass
mit da Zit isch es denn nüm guat gange
i ha s'Gfühl gha alli lönd mi hange
spöter hät min Vater sich s'Leba gnoh
i ha alles eifach nöd chöna verstoh
drum bin i ziemlich schnell i d'Droge cho
ha döt d'Geborgenheit gsuacht
han aber ziemlich schnell alli um mi uma verfluacht
danoh han i mit 16 en Bistand übercho
dä hät mir dänn au mini Freiheit gno
i ha glernt mis Leba müässe z'aktzeptiere
eifach nöd z'viel über gwüsse Sache noh studiere
sorry jetzt loht mini Fantasie noh
i wett no säga i bi nöd über alles i mim Leba froh
wenns ihne passt, schrieb i denn no meh
schrieba hani druf, da werded sie den geseh
Christoph Zanotti
Nach langer Wartezit übergib i ihne es Gedicht
verfasst mitema Teil vo minera Lebensgschicht
i bi nöd immer ein eifachte gsi
doch dia Zitä sind jetzt verbie
i bin oft vo mim Onkel gschlage worde
doch dä isch für mi scho sit längerem gstorbe
drum bin i scho zimlich fruah uf d'Gass
denn es entwicklet sich än grosse Hass
mit da Zit isch es denn nüm guat gange
i ha s'Gfühl gha alli lönd mi hange
spöter hät min Vater sich s'Leba gnoh
i ha alles eifach nöd chöna verstoh
drum bin i ziemlich schnell i d'Droge cho
ha döt d'Geborgenheit gsuacht
han aber ziemlich schnell alli um mi uma verfluacht
danoh han i mit 16 en Bistand übercho
dä hät mir dänn au mini Freiheit gno
i ha glernt mis Leba müässe z'aktzeptiere
eifach nöd z'viel über gwüsse Sache noh studiere
sorry jetzt loht mini Fantasie noh
i wett no säga i bi nöd über alles i mim Leba froh
wenns ihne passt, schrieb i denn no meh
schrieba hani druf, da werded sie den geseh
Christoph Zanotti
Obdachlos wegen Feigheit
Du kannst ihn im Spital abholen, habe seine Mutter zur Grossmutter gesagt. Herr K. erzählt dies, als wäre es damals um ein Postpaket gegangen und nicht um ihn selbst. Er sei bei seinen Grosseltern aufgewachsen bis zur Pubertät, dann sei er wohl seinen Grosseltern über den Kopf gewachsen und in ein Heim gekommen. Aus seinem Leben schildert er folgende Episode:
Begonnen hat es damit, dass ich meine Traumfrau verloren habe. Dann die Arbeit. Schlussendlich habe ich die Kündigung erhalten für die Wohnung. Eine Busse über 1‘500.- Franken konnte ich nicht bezahlen, deshalb entschied ich mich, da ich ja sowieso nichts zu verlieren hatte, auf Wanderschaft zu gehen. Die ersten paar Tage bewegte ich mich um und in der Ortschaft Sargans. Ich machte mir keine Gedanken über meine Zukunft, weil ich dachte, dass sowieso alles keinen Wert mehr hat und ich hatte ja noch ein wenig Geld von meinem letzten Gehalt. In der Nähe des Vita-Parcours beim Rheindamm gab es zwei Feuerstellen, die ich sehr oft benutzte. Leute liefen in den Wald oder aus dem Wald heraus und schauten mich manchmal komisch an, weil ich fast jeden Tag dort sass. Plötzlich hatte ich kein Geld mehr, worauf ich mich entschloss, mit meinem Velo in Richtung Lichtenstein zu fahren. In Triesen gibt es einen grossen Spielplatz mit 8 Feuerstellen, die meiste Zeit vegetierte ich dort dahin. Manchmal hatte ich Glück, fand Arbeit für ein paar Stunden bei einem Landwirt (Unkraut jäten, Wiesen mähen usw.). Ich sagte den Leuten, ich bin einer aus der Schweiz, obdachlos und habe kein Geld, um etwas zu essen, haben Sie Arbeit für mich? Geschlafen habe ich in den kleinen Spielhäuschen. Alles, was ich besass, war eine Wolldecke. Als ich merkte, dass es hier keine Arbeit mehr gibt, bin ich Richtung Vaduz gefahren und meldete mich auf dem Caritas-Büro. Sie könnten mir nicht helfen, meinten sie, höchstens ein Billet nach Buchs bezahlen. Aber was sollte ich in der Schweiz, vielleicht wurde ich ja verhaftet wegen der Busse. Ich fuhr weiter Richtung Deutschland, sah plötzlich die Tafel Feldkirch, ist ja nicht möglich, dachte ich, ist ja krass, jetzt bin ich schon in Oestreich. Ich wollte ins Zentrum, fand es aber nicht, fuhr falsch und sah plötzlich den Schweizer Zoll bei Oberriet, kehrte sofort um. Weg von hier. Endlich fand ich die Tafel Richtung Zentrum. Wo schlafen? Ich lernte jemanden kennen, den berühmten Harry, den Obersäufer von Feldkirch, und er meinte, ich könne bei ihm schlafen. Jeden Abend Party, jeden Abend war‘s lustig. Ich fragte beim Pfarramt Levis, ob sie Arbeit hätten. Der Pfarrer meinte, wenn ich Montag um 8 Uhr komme, habe er Arbeit für mich. Montag um 8 Uhr stand ich vor seiner Kirche und arbeitete für 10 Euro pro Stunde als Messmer. Ich machte Gartenarbeiten. Dann ging die Arbeit aus. Eines Tages kurz vor Mitternacht sagte Harry, pack deine Sachen und verschwinde. Vielleicht weil ich nicht mehr so spendabel war. Also ging ich unter die Brücke. Dort war schon jemand, ein Drögeler. Darf ich bei dir einziehen, fragte ich ihn. Mit Hilfe der Gendarmerie holte ich mein Zeug zurück aus Harrys Wohnung. Unter der Brücke hatte es viele Spinnen und Müll. Deshalb begann ich aufzuräumen. Schnaps gab es keinen bei uns, wir haben vor allem Bier getrunken. Mein Leidensgenosse hatte einen KV-Abschluss mit 5.8, er war ein blitzgescheiter Kerl, aber er hatte einen Verfolgungswahn, stand manchmal mitten in der Nacht auf und brüllte: Wir müssen abhauen, sie holen mich ab! Ich brummte nur: Sei ruhig, ich will schlafen! Er ging in die Notschlafstelle, ich war allein unter der Brücke. Jeden Tag suchte ich das Caritas-Café am Bahnhof auf. Dort konnte man duschen, Kleider gratis waschen und Essen für 2 Euro. Nach zwei Wochen allein unter der Brücke drehte ich durch und meldete mich bei der Notschlafstelle und beim Stellenvermittlungsbüro als Arbeitsloser an. Ich habe sogar eine Krankenversicherung abgeschlossen und die sagten trotzdem, ich solle mir mehr Mühe geben. Da bin ich abgehauen und lebte wieder unter der Brücke. Die Autos, die unter der Brücke parkierten, schienen mir manchmal direkt ins Gesicht. Mit der Zeit wurde es kälter, ausserdem vermisste ich meine Traumfrau immer mehr. Also packte ich meine Sachen, setzte mich aufs Velo und fuhr nach Chur. Ging aufs Amt für Justizvollzug und sagte, dass ich meine Haftstrafe antreten möchte. Zwei Stunden später war ich im Knast.
anonym
Begonnen hat es damit, dass ich meine Traumfrau verloren habe. Dann die Arbeit. Schlussendlich habe ich die Kündigung erhalten für die Wohnung. Eine Busse über 1‘500.- Franken konnte ich nicht bezahlen, deshalb entschied ich mich, da ich ja sowieso nichts zu verlieren hatte, auf Wanderschaft zu gehen. Die ersten paar Tage bewegte ich mich um und in der Ortschaft Sargans. Ich machte mir keine Gedanken über meine Zukunft, weil ich dachte, dass sowieso alles keinen Wert mehr hat und ich hatte ja noch ein wenig Geld von meinem letzten Gehalt. In der Nähe des Vita-Parcours beim Rheindamm gab es zwei Feuerstellen, die ich sehr oft benutzte. Leute liefen in den Wald oder aus dem Wald heraus und schauten mich manchmal komisch an, weil ich fast jeden Tag dort sass. Plötzlich hatte ich kein Geld mehr, worauf ich mich entschloss, mit meinem Velo in Richtung Lichtenstein zu fahren. In Triesen gibt es einen grossen Spielplatz mit 8 Feuerstellen, die meiste Zeit vegetierte ich dort dahin. Manchmal hatte ich Glück, fand Arbeit für ein paar Stunden bei einem Landwirt (Unkraut jäten, Wiesen mähen usw.). Ich sagte den Leuten, ich bin einer aus der Schweiz, obdachlos und habe kein Geld, um etwas zu essen, haben Sie Arbeit für mich? Geschlafen habe ich in den kleinen Spielhäuschen. Alles, was ich besass, war eine Wolldecke. Als ich merkte, dass es hier keine Arbeit mehr gibt, bin ich Richtung Vaduz gefahren und meldete mich auf dem Caritas-Büro. Sie könnten mir nicht helfen, meinten sie, höchstens ein Billet nach Buchs bezahlen. Aber was sollte ich in der Schweiz, vielleicht wurde ich ja verhaftet wegen der Busse. Ich fuhr weiter Richtung Deutschland, sah plötzlich die Tafel Feldkirch, ist ja nicht möglich, dachte ich, ist ja krass, jetzt bin ich schon in Oestreich. Ich wollte ins Zentrum, fand es aber nicht, fuhr falsch und sah plötzlich den Schweizer Zoll bei Oberriet, kehrte sofort um. Weg von hier. Endlich fand ich die Tafel Richtung Zentrum. Wo schlafen? Ich lernte jemanden kennen, den berühmten Harry, den Obersäufer von Feldkirch, und er meinte, ich könne bei ihm schlafen. Jeden Abend Party, jeden Abend war‘s lustig. Ich fragte beim Pfarramt Levis, ob sie Arbeit hätten. Der Pfarrer meinte, wenn ich Montag um 8 Uhr komme, habe er Arbeit für mich. Montag um 8 Uhr stand ich vor seiner Kirche und arbeitete für 10 Euro pro Stunde als Messmer. Ich machte Gartenarbeiten. Dann ging die Arbeit aus. Eines Tages kurz vor Mitternacht sagte Harry, pack deine Sachen und verschwinde. Vielleicht weil ich nicht mehr so spendabel war. Also ging ich unter die Brücke. Dort war schon jemand, ein Drögeler. Darf ich bei dir einziehen, fragte ich ihn. Mit Hilfe der Gendarmerie holte ich mein Zeug zurück aus Harrys Wohnung. Unter der Brücke hatte es viele Spinnen und Müll. Deshalb begann ich aufzuräumen. Schnaps gab es keinen bei uns, wir haben vor allem Bier getrunken. Mein Leidensgenosse hatte einen KV-Abschluss mit 5.8, er war ein blitzgescheiter Kerl, aber er hatte einen Verfolgungswahn, stand manchmal mitten in der Nacht auf und brüllte: Wir müssen abhauen, sie holen mich ab! Ich brummte nur: Sei ruhig, ich will schlafen! Er ging in die Notschlafstelle, ich war allein unter der Brücke. Jeden Tag suchte ich das Caritas-Café am Bahnhof auf. Dort konnte man duschen, Kleider gratis waschen und Essen für 2 Euro. Nach zwei Wochen allein unter der Brücke drehte ich durch und meldete mich bei der Notschlafstelle und beim Stellenvermittlungsbüro als Arbeitsloser an. Ich habe sogar eine Krankenversicherung abgeschlossen und die sagten trotzdem, ich solle mir mehr Mühe geben. Da bin ich abgehauen und lebte wieder unter der Brücke. Die Autos, die unter der Brücke parkierten, schienen mir manchmal direkt ins Gesicht. Mit der Zeit wurde es kälter, ausserdem vermisste ich meine Traumfrau immer mehr. Also packte ich meine Sachen, setzte mich aufs Velo und fuhr nach Chur. Ging aufs Amt für Justizvollzug und sagte, dass ich meine Haftstrafe antreten möchte. Zwei Stunden später war ich im Knast.
anonym
Versöhnung
Ein Mann erzählt die wundersame Geschichte einer Versöhnung - ohne Worte.
Der Vater ist Zollbeamter und Waffennarr, sein Sohn ein Kind der Langsamkeit, oft gehänselt wegen seiner „langen Leitung“. Es scheint eine Geschichte unauflöslichen Missverständnisses zu werden, weil sie keine gemeinsame Ebene finden, der Sohn zwar immer wieder das Gespräch sucht, der Vater aber blockt: Vielleicht, weil ihm die Worte fehlen? Der Vater wird krank, der Sohn träumt, einen Notizzettel von ihm zu erhalten – aber nichts steht drauf. Der Vater erholt sich nicht mehr von seiner Lungenentzündung und Niereninsuffizienz. Die Angehörigen stehen um sein Sterbebett und wie der Sohn zu ihm spricht, erkennt er seine Stimme, drückt seine Hand, ganz fest. Der Sohn spürt die Kraft der Versöhnung, die ihn durchströmt- ohne Worte.
anonym
Der Vater ist Zollbeamter und Waffennarr, sein Sohn ein Kind der Langsamkeit, oft gehänselt wegen seiner „langen Leitung“. Es scheint eine Geschichte unauflöslichen Missverständnisses zu werden, weil sie keine gemeinsame Ebene finden, der Sohn zwar immer wieder das Gespräch sucht, der Vater aber blockt: Vielleicht, weil ihm die Worte fehlen? Der Vater wird krank, der Sohn träumt, einen Notizzettel von ihm zu erhalten – aber nichts steht drauf. Der Vater erholt sich nicht mehr von seiner Lungenentzündung und Niereninsuffizienz. Die Angehörigen stehen um sein Sterbebett und wie der Sohn zu ihm spricht, erkennt er seine Stimme, drückt seine Hand, ganz fest. Der Sohn spürt die Kraft der Versöhnung, die ihn durchströmt- ohne Worte.
anonym
Zwei Engel in einem zerbrechlichen Leben
In einem modernen Märchen schildert eine Frau, wie sie, verloren und allein, trotzdem Halt gefunden hat.
.
Als das kleine mädchen aus der schweiz acht jahre alt wurde, freute es sich auf ihren baldigen geburstag. Denn es wusste vom vater, dass es etwas besonderes geben wird. Die freude war gross bei der kleinen. Die bescherung war nah.
Nun das geschenk war niemals so schön, wie die kleine sich das dachte. Der vater nahm sie in die arme und flüsterte ihr ins ohr, was das geschenk war. Das mädchen verstand nicht, was daran schön sein sollte.
Ab diesem tag geschah es regelmässig und intensiv: das mädchen begann für sich Engel vorzustellen. Die sollten über ihr sein und sie wünschte sich, dass die Engel sie einmal für immer mitnehmen würden. Denn fliegen sollte doch nicht so schwierig sein. Sie gab niemals den wunsch auf zu fliegen. Ihre seele hungerte nach liebe, geborgenheit und normalität. Doch sie bekam schläge und schmerz. Jahre um jahre vergingen und das mädchen wurde älter und dabei waren stets ihre Engel mit dabei. Ihr leben war schmerzvoll und traurig. Es gab immer wieder tage, an denen sie am boden war und aufgeben wollte. Es klingt ein wenig abergläubisch, aber es waren die Engel die sie immer daran hinderten. Niemals dachte sie, dass Engel auch menschen sein könnten. Doch es gab sie wirklich und das gab dem mädchen einen schub kraft. Erst jetzt nach vielen jahren, dachte sie im bett, beginnt mein leben. Ein lachen huschte über ihr zartes gesicht.
Auch wenn das leben schmerzvoll begann, gab es ein happy end. Denn ihr wurden vom himmel Engel geschickt, nicht zum fliegen, sondern sie zu begleiten und ihr die schönen seiten des lebens zu präsentieren. Die Engel sind immer noch alleine für sie da. Und das mädchen will nicht mehr davon-fliegen, denn es will noch mehr schöne dinge sehen und erleben, und das mit der sicherheit der Engel. Das leben des mädchens war zerstört worden, doch dank der zwei wunderbaren Engel hat sie den weg neu ins leben gefunden.
Engel kann man nicht immer sehen,
aber fühlen.
Rosa Todesco
.
Als das kleine mädchen aus der schweiz acht jahre alt wurde, freute es sich auf ihren baldigen geburstag. Denn es wusste vom vater, dass es etwas besonderes geben wird. Die freude war gross bei der kleinen. Die bescherung war nah.
Nun das geschenk war niemals so schön, wie die kleine sich das dachte. Der vater nahm sie in die arme und flüsterte ihr ins ohr, was das geschenk war. Das mädchen verstand nicht, was daran schön sein sollte.
Ab diesem tag geschah es regelmässig und intensiv: das mädchen begann für sich Engel vorzustellen. Die sollten über ihr sein und sie wünschte sich, dass die Engel sie einmal für immer mitnehmen würden. Denn fliegen sollte doch nicht so schwierig sein. Sie gab niemals den wunsch auf zu fliegen. Ihre seele hungerte nach liebe, geborgenheit und normalität. Doch sie bekam schläge und schmerz. Jahre um jahre vergingen und das mädchen wurde älter und dabei waren stets ihre Engel mit dabei. Ihr leben war schmerzvoll und traurig. Es gab immer wieder tage, an denen sie am boden war und aufgeben wollte. Es klingt ein wenig abergläubisch, aber es waren die Engel die sie immer daran hinderten. Niemals dachte sie, dass Engel auch menschen sein könnten. Doch es gab sie wirklich und das gab dem mädchen einen schub kraft. Erst jetzt nach vielen jahren, dachte sie im bett, beginnt mein leben. Ein lachen huschte über ihr zartes gesicht.
Auch wenn das leben schmerzvoll begann, gab es ein happy end. Denn ihr wurden vom himmel Engel geschickt, nicht zum fliegen, sondern sie zu begleiten und ihr die schönen seiten des lebens zu präsentieren. Die Engel sind immer noch alleine für sie da. Und das mädchen will nicht mehr davon-fliegen, denn es will noch mehr schöne dinge sehen und erleben, und das mit der sicherheit der Engel. Das leben des mädchens war zerstört worden, doch dank der zwei wunderbaren Engel hat sie den weg neu ins leben gefunden.
Engel kann man nicht immer sehen,
aber fühlen.
Rosa Todesco
Eine weitere Episode meines Lebens
Mit 41 Jahren hat uns Alfons B. seine Geschichte erzählt, nachzulesen unter "Meine Geschichte". Wie ging es weiter?
Mir ging es wieder einmal schlecht und ich wechselte das Programm vom Methadon- ins Heroinprogramm MSH 1. In diesem Programm löste sich bei mir das Bewusstsein, was es heisst jeden Tag einfach den Stoff zu bekommen. Mir bekam das Ersatzheroin nicht gut und das löste bei mir aus, dass ich beschlossen, sauber zu werden. Somit wechselte ich wieder ins Methadonprogramm. Ich bekam einen Arbeitsplatz in der Gartengruppe, in dieser Zeit reichte ich den IV- Antrag ein. Nach einem Jahr, in dem ich nachweislich sauber war, beantragte ich den Mofaführerausweis, den ich mit den Auflagen wie Urinproben, Blutentnahmen, Haaranalysen und Verlaufsberichten der psychiatrischen Betreuung bekam. Nach einem Jahr Gartengruppe wechselte ich in die Stiftung Tosam in Herisau. Da arbeitete ich ein Jahr 50% in der Velowerkstatt. Nach zwei Jahren psychiatrischer Betreuung und Clean-sein, ging es mir wieder ziemlich gut.
Ich wechselte in die Velowerkstatt St. Gallen, wo ich als Mofamechaniker 50% arbeiten konnte. Als ich von der Tosam-Stiftung zum Arbeitsplatz in St. Gallen wechselte, bekam ich die IV. Ich arbeitete weiterhin 50% als Mofamechaniker, das mache ich einfach gerne. Auch privat habe ich im Moment zwei schöne Mofas, einen DYW und einen Sachs 502 zum Verkaufen.
Nach drei Jahren Clean-sein passierte es; ich hatte einen Absturz und das war so: Ich wusch beim Mofa die Farbe mit Nitroverdünner runter, am Abend war ich benebelt. Da rief mich ein Kumpel an, er müsse ein Mofa haben. Er kam zu mir und ich verkaufte mein privates Mofa mit Anhänger. weil er dringend ein Mofa brauchte. Er hatte auch noch Heroin dabei und da war es passiert, nach drei Jahren Sauber-sein. Anschliessend geriet ich in eine Krise, nach vier Wochen habe ich mich wieder gefangen. In dieser Endzeit, als es mir so schlecht ging, las ich in der Bibel und irgendwie kam mein Bewusstsein zurück. Anschliessend suchte ich Hilfe und das Gespräch. Heute geht es mir wieder besser, ich habe leider diverse Schulden gemacht. Aber ich habe den Weg wieder gefunden, so wie er vorher war. Dass ich hier meine Geschichte erzählen kann, finde ich eine gute Sache. So können die einen sehen, wie es den anderen so geht und was diese erleben. Ich kann nur sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Jetzt bin ich 45 Jahre und heisse Alfons B.
Mir ging es wieder einmal schlecht und ich wechselte das Programm vom Methadon- ins Heroinprogramm MSH 1. In diesem Programm löste sich bei mir das Bewusstsein, was es heisst jeden Tag einfach den Stoff zu bekommen. Mir bekam das Ersatzheroin nicht gut und das löste bei mir aus, dass ich beschlossen, sauber zu werden. Somit wechselte ich wieder ins Methadonprogramm. Ich bekam einen Arbeitsplatz in der Gartengruppe, in dieser Zeit reichte ich den IV- Antrag ein. Nach einem Jahr, in dem ich nachweislich sauber war, beantragte ich den Mofaführerausweis, den ich mit den Auflagen wie Urinproben, Blutentnahmen, Haaranalysen und Verlaufsberichten der psychiatrischen Betreuung bekam. Nach einem Jahr Gartengruppe wechselte ich in die Stiftung Tosam in Herisau. Da arbeitete ich ein Jahr 50% in der Velowerkstatt. Nach zwei Jahren psychiatrischer Betreuung und Clean-sein, ging es mir wieder ziemlich gut.
Ich wechselte in die Velowerkstatt St. Gallen, wo ich als Mofamechaniker 50% arbeiten konnte. Als ich von der Tosam-Stiftung zum Arbeitsplatz in St. Gallen wechselte, bekam ich die IV. Ich arbeitete weiterhin 50% als Mofamechaniker, das mache ich einfach gerne. Auch privat habe ich im Moment zwei schöne Mofas, einen DYW und einen Sachs 502 zum Verkaufen.
Nach drei Jahren Clean-sein passierte es; ich hatte einen Absturz und das war so: Ich wusch beim Mofa die Farbe mit Nitroverdünner runter, am Abend war ich benebelt. Da rief mich ein Kumpel an, er müsse ein Mofa haben. Er kam zu mir und ich verkaufte mein privates Mofa mit Anhänger. weil er dringend ein Mofa brauchte. Er hatte auch noch Heroin dabei und da war es passiert, nach drei Jahren Sauber-sein. Anschliessend geriet ich in eine Krise, nach vier Wochen habe ich mich wieder gefangen. In dieser Endzeit, als es mir so schlecht ging, las ich in der Bibel und irgendwie kam mein Bewusstsein zurück. Anschliessend suchte ich Hilfe und das Gespräch. Heute geht es mir wieder besser, ich habe leider diverse Schulden gemacht. Aber ich habe den Weg wieder gefunden, so wie er vorher war. Dass ich hier meine Geschichte erzählen kann, finde ich eine gute Sache. So können die einen sehen, wie es den anderen so geht und was diese erleben. Ich kann nur sagen, dass es sich lohnt zu kämpfen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Jetzt bin ich 45 Jahre und heisse Alfons B.
Flucht aus Somalia
Ein junger Mann kommt verzweifelt zu uns in die Beratung. Er hat nicht nur kein Geld, sondern auch keine Arbeit, kein Selbstvertrauen und keine Zukunft, aber eine sehr bewegende Lebensgeschichte. Ich bat ihn, sie für uns aufzuschreiben und ich habe sie dann aus dem Englischen übersetzt.
Ich wurde in einer kleinen Stadt mitten in Somalia geboren. Seit 23 Jahren herrscht dort Krieg, Armut und Mangel an Bildung. Am meisten betraf es die Jugend und auch mich betraf es, vor allem wegen unserer familiären Situation. Meine Eltern waren arm. Sie versuchten zwar, das Leben für uns zum Besseren zu wenden, aber mit der Zeit wurde die Situation nur noch schlimmer. So entschieden wir uns, nach Kenia in ein Lager zu flüchten und wurden dort von einem zum andern geschickt.
Mich bedrückte dieser Zustand, ich konnte das Leben in Armut und Chaos nicht ertragen. „Flüchtling“ wurde zu meinem Namen. Ich entschied mich, den langen Weg nach Europa auf mich zu nehmen, obwohl ich wusste, dass ich dabei mein Leben riskierte. Aber es schien der einzige Weg aus Armut und Zukunftslosigkeit zu sein. Die Reise, die mehr als ein Jahr dauerte, wurde zu einem Albtraum, noch heute habe ich schlechte Träume.
In Kenia heuerte ich bei einem Container-Lastwagen an. Mit dem Geld bezahlte ich die Reise nach Uganda, arbeitete auch dort und bezahlte meine Reise nach Sudan. Ich traf auf eine Gruppe von Somaliern, die auch durch die Sahara nach Libyen wollte. Mitten in der Wüste wurden wir überfallen, ausgeraubt, geschlagen und die Frauen vergewaltigt. Sie liessen uns zurück ohne Orientierung, ohne Nahrung, nur mit ein wenig Wasser. Wir glaubten, wir würden sterben. In der achten Nacht sahen wir einen Jeep auf uns zufahren, der uns nach Libya Town brachte. Dort wurden wir ins Gefängnis gesteckt, zwei Monate lang sperrten sie mich ein.
Ich danke Gott, dass wir in Libyen eine grosse Gemeinschaft von Somaliern waren. Wir unterstützten uns gegenseitig und halfen uns aus. Schliesslich fand ich Arbeit und sobald ich genügend Geld beisammen hatte, kaufte ich mich bei einem Boot ein, das mich nach Malta brachte. Dort wurde ich erst einmal für 8 Monate und 21 Tage ins Gefängnis gesteckt.
Von Malta nach Italien, Deutschland und jetzt in der Schweiz.
Ich hatte grosse Hoffnungen, als ich in die Schweiz kam, nicht nur weil ich wusste, dass hier die Menschenrechte respektiert werden, sondern auch, weil ich wieder an meine Zukunft glaubte. Gerechtigkeit, Menschenrechte, Freiheit, die Chance bekommen, ein gebildeter und wohltätiger Mensch zu werden und meiner Familie zu helfen. Ich habe immer noch Träume! Doch jetzt merke ich, dass es nicht so leicht ist, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Ich dachte, ich könne zur Schule gehen, um auf dasselbe Niveau zu kommen wie die anderen in meinem Alter, dachte, ich könne eine Ausbildung erhalten, um mir eine Zukunft aufzubauen, dachte, ich könne arbeiten für mich und meine Familie, dachte, ich könne mich entspannen von all den Spannungen und dem Stress, aber die Realität ist nicht, wie ich sie erwartete, und jetzt weiss ich, dass der Weg nicht so leicht ist, wie ich dachte.
Jetzt habe ich ein Kind, keine Arbeit und noch immer keine Zukunft.
anonym
Ich wurde in einer kleinen Stadt mitten in Somalia geboren. Seit 23 Jahren herrscht dort Krieg, Armut und Mangel an Bildung. Am meisten betraf es die Jugend und auch mich betraf es, vor allem wegen unserer familiären Situation. Meine Eltern waren arm. Sie versuchten zwar, das Leben für uns zum Besseren zu wenden, aber mit der Zeit wurde die Situation nur noch schlimmer. So entschieden wir uns, nach Kenia in ein Lager zu flüchten und wurden dort von einem zum andern geschickt.
Mich bedrückte dieser Zustand, ich konnte das Leben in Armut und Chaos nicht ertragen. „Flüchtling“ wurde zu meinem Namen. Ich entschied mich, den langen Weg nach Europa auf mich zu nehmen, obwohl ich wusste, dass ich dabei mein Leben riskierte. Aber es schien der einzige Weg aus Armut und Zukunftslosigkeit zu sein. Die Reise, die mehr als ein Jahr dauerte, wurde zu einem Albtraum, noch heute habe ich schlechte Träume.
In Kenia heuerte ich bei einem Container-Lastwagen an. Mit dem Geld bezahlte ich die Reise nach Uganda, arbeitete auch dort und bezahlte meine Reise nach Sudan. Ich traf auf eine Gruppe von Somaliern, die auch durch die Sahara nach Libyen wollte. Mitten in der Wüste wurden wir überfallen, ausgeraubt, geschlagen und die Frauen vergewaltigt. Sie liessen uns zurück ohne Orientierung, ohne Nahrung, nur mit ein wenig Wasser. Wir glaubten, wir würden sterben. In der achten Nacht sahen wir einen Jeep auf uns zufahren, der uns nach Libya Town brachte. Dort wurden wir ins Gefängnis gesteckt, zwei Monate lang sperrten sie mich ein.
Ich danke Gott, dass wir in Libyen eine grosse Gemeinschaft von Somaliern waren. Wir unterstützten uns gegenseitig und halfen uns aus. Schliesslich fand ich Arbeit und sobald ich genügend Geld beisammen hatte, kaufte ich mich bei einem Boot ein, das mich nach Malta brachte. Dort wurde ich erst einmal für 8 Monate und 21 Tage ins Gefängnis gesteckt.
Von Malta nach Italien, Deutschland und jetzt in der Schweiz.
Ich hatte grosse Hoffnungen, als ich in die Schweiz kam, nicht nur weil ich wusste, dass hier die Menschenrechte respektiert werden, sondern auch, weil ich wieder an meine Zukunft glaubte. Gerechtigkeit, Menschenrechte, Freiheit, die Chance bekommen, ein gebildeter und wohltätiger Mensch zu werden und meiner Familie zu helfen. Ich habe immer noch Träume! Doch jetzt merke ich, dass es nicht so leicht ist, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Ich dachte, ich könne zur Schule gehen, um auf dasselbe Niveau zu kommen wie die anderen in meinem Alter, dachte, ich könne eine Ausbildung erhalten, um mir eine Zukunft aufzubauen, dachte, ich könne arbeiten für mich und meine Familie, dachte, ich könne mich entspannen von all den Spannungen und dem Stress, aber die Realität ist nicht, wie ich sie erwartete, und jetzt weiss ich, dass der Weg nicht so leicht ist, wie ich dachte.
Jetzt habe ich ein Kind, keine Arbeit und noch immer keine Zukunft.
anonym
Vier Tage lang
Eine ältere Frau möchte zur Beerdigung ihres Bruders fahren. Weil ihr das Geld dazu fehlt, bittet sie den katholischen Sozialdienst um einen Vorschuss. Nach einer Woche kommt sie wieder, bringt Geld und Zugbillet mit.
Ich war an der Beerdigung meines Bruders. Bis ich nur schon meine Schwester gefunden habe in dem grossen „Kästchenhaus“. Ihr Mann sass am Tisch mit Alkohol vor sich, schon am Morgen. Der kommt als nächster dran, Leberzirrhose. Und auch meine Schwester war völlig durchgeknallt. Sie kommt in Trainerhose und rotem Pullover an die Beerdigung. Siebzehn Leute waren dort, aber kein Pfarrer. Mein Bruder ist aus der Kirche ausgetreten. Ich habe ein Blume auf sein Grab gelegt und ihm gesagt: Hoffentlich kommst du auch ohne Pfarrer in den Himmel.
Danach suchte ich das Grab vom Ex meiner Tochter. Der hat sich in Zürich das Leben genommen. Aber kein Grab mehr, sie haben es ausgehoben. Auch das Grab von meinem Ex war nicht mehr da. Wissen Sie, was seine zweite Frau zu mir gesagt hat? Komm ja nicht an seine Beerdigung, sonst tun wir dich gleich mit in die Urne rein.
Der Sohn meiner Schwester hat sich auch das Leben genommen. Hier (sie deutet mit Zeige- und Mittelfinger auf den Unterkiefer). Ich habe es ja auch einmal versucht, mir die Pulsader aufgeschnitten. Mein Gott, was war das für eine Sauerei, alles voll Blut. Der Arzt hat schön geschimpft mit mir.
Obwohl ich ja die Stadt gut kenne, bin ich nach der Beerdigung gleich wieder nach Hause gefahren. Vier Tage lang habe ich meine Wohnung nicht verlassen. So lange brauchte ich, um wieder zu mir zu kommen.
3. Dezember 2012
Aufgezeichnet Bernhard Brack
Ich war an der Beerdigung meines Bruders. Bis ich nur schon meine Schwester gefunden habe in dem grossen „Kästchenhaus“. Ihr Mann sass am Tisch mit Alkohol vor sich, schon am Morgen. Der kommt als nächster dran, Leberzirrhose. Und auch meine Schwester war völlig durchgeknallt. Sie kommt in Trainerhose und rotem Pullover an die Beerdigung. Siebzehn Leute waren dort, aber kein Pfarrer. Mein Bruder ist aus der Kirche ausgetreten. Ich habe ein Blume auf sein Grab gelegt und ihm gesagt: Hoffentlich kommst du auch ohne Pfarrer in den Himmel.
Danach suchte ich das Grab vom Ex meiner Tochter. Der hat sich in Zürich das Leben genommen. Aber kein Grab mehr, sie haben es ausgehoben. Auch das Grab von meinem Ex war nicht mehr da. Wissen Sie, was seine zweite Frau zu mir gesagt hat? Komm ja nicht an seine Beerdigung, sonst tun wir dich gleich mit in die Urne rein.
Der Sohn meiner Schwester hat sich auch das Leben genommen. Hier (sie deutet mit Zeige- und Mittelfinger auf den Unterkiefer). Ich habe es ja auch einmal versucht, mir die Pulsader aufgeschnitten. Mein Gott, was war das für eine Sauerei, alles voll Blut. Der Arzt hat schön geschimpft mit mir.
Obwohl ich ja die Stadt gut kenne, bin ich nach der Beerdigung gleich wieder nach Hause gefahren. Vier Tage lang habe ich meine Wohnung nicht verlassen. So lange brauchte ich, um wieder zu mir zu kommen.
3. Dezember 2012
Aufgezeichnet Bernhard Brack
Meine kurze Lebensgeschichte
Schon 30 Jahre lebt diese Frau nun in St.Gallen - wie sie hierher kam berichtet sie selbst. Schon der Start in die Welt war alles andere als liebevoll und behutsam. Und doch hat sie sich nicht unterkriegen lassen...
Von drei Schwestern und einem Bruder war ich als das jüngste Mädchen geboren worden. Während meiner Geburt befahl mein Vater, die Mutter habe mit mir von zu Hause zu verschwinden. Meine Grossmutter half bei der Geburt, indem sie die Nabelschnur durchtrennte, anschliessend mich in Tücher einwickelte, und sie mit mir unverzüglich das Haus verlassen hat. Von dieser Zeit bis zu meinem 12.Lebensjahr lebte ich alleine bei meiner Grossmutter. Meine Eltern liessen sich während meinem 12.Lebensjahr scheiden. Meine Mutter nahm mich alleine mit nach München, als ich 13 Jahre alt war, weil meine Stiefmutter mich immer wieder geschlagen hatte. Ich war sehr traurig, dass meine Mutter mich von meinen beiden Schwestern und meinem Bruder wegnahm.
In Deutschland besuchte ich teilweise die Deutschschule und teilweise war ich gezwungen zu arbeiten, um genug Geld zu Hause zu haben. Da meine Mutter sehr streng war, habe ich die gemeinsame Wohnung in München verlassen und bin in die Wohnung zu meinem Freund gezogen. Mit dem Alter von 16 Jahren habe ich geheiratet und mit 17 Jahren bekam ich einen Knaben.
Nach der Geburt habe ich mich wieder an meine traurige Vergangenheit erinnert. Am 09.01.1983 bin ich zusammen mit meinem Mann nach St. Gallen gekommen. Bis heute lebe ich ununterbrochen in der Stadt St.Gallen. 13 Jahre hat die Ehe gehalten, jedoch in schlechter Erinnerung. – Nach schweren Schlägen usw. von meinem Ehemann habe ich mich 1985 scheiden lassen.
Infolge dieser schweren Lage wurde ich nach einem Zusammenbruch in den psychiatrischen Spital in Wil eingewiesen, wo ich mich 3 Monate aufhielt und abgenommen habe, bis ich nur noch 45 Kilo wog. Ab diesem Zeitpunkt musste ich ohne Familie, ohne Freunde, ohne Kollegen mich in St. Gallen alleine durchs Leben kämpfen, aber ich lebe trotzdem heute noch.
St.Gallen, 1. Oktober 2012
Julka Jovcic
Von drei Schwestern und einem Bruder war ich als das jüngste Mädchen geboren worden. Während meiner Geburt befahl mein Vater, die Mutter habe mit mir von zu Hause zu verschwinden. Meine Grossmutter half bei der Geburt, indem sie die Nabelschnur durchtrennte, anschliessend mich in Tücher einwickelte, und sie mit mir unverzüglich das Haus verlassen hat. Von dieser Zeit bis zu meinem 12.Lebensjahr lebte ich alleine bei meiner Grossmutter. Meine Eltern liessen sich während meinem 12.Lebensjahr scheiden. Meine Mutter nahm mich alleine mit nach München, als ich 13 Jahre alt war, weil meine Stiefmutter mich immer wieder geschlagen hatte. Ich war sehr traurig, dass meine Mutter mich von meinen beiden Schwestern und meinem Bruder wegnahm.
In Deutschland besuchte ich teilweise die Deutschschule und teilweise war ich gezwungen zu arbeiten, um genug Geld zu Hause zu haben. Da meine Mutter sehr streng war, habe ich die gemeinsame Wohnung in München verlassen und bin in die Wohnung zu meinem Freund gezogen. Mit dem Alter von 16 Jahren habe ich geheiratet und mit 17 Jahren bekam ich einen Knaben.
Nach der Geburt habe ich mich wieder an meine traurige Vergangenheit erinnert. Am 09.01.1983 bin ich zusammen mit meinem Mann nach St. Gallen gekommen. Bis heute lebe ich ununterbrochen in der Stadt St.Gallen. 13 Jahre hat die Ehe gehalten, jedoch in schlechter Erinnerung. – Nach schweren Schlägen usw. von meinem Ehemann habe ich mich 1985 scheiden lassen.
Infolge dieser schweren Lage wurde ich nach einem Zusammenbruch in den psychiatrischen Spital in Wil eingewiesen, wo ich mich 3 Monate aufhielt und abgenommen habe, bis ich nur noch 45 Kilo wog. Ab diesem Zeitpunkt musste ich ohne Familie, ohne Freunde, ohne Kollegen mich in St. Gallen alleine durchs Leben kämpfen, aber ich lebe trotzdem heute noch.
St.Gallen, 1. Oktober 2012
Julka Jovcic
Ein letztes Lächeln
Nur ein Fotoalbum bleibt von einem Menschen, der 89 Jahre lang gelebt hat.
Ein letztes Lächeln
Die Tropfen segnenden
Weihwassers krochen langsam
über den schräg gestellten Sarg
Minus 10 Grad
Auf den Grabsteinen
weisse Schneehauben
die auf der Rückseite
zungenförmig herabhingen
89 Jahre lang war sie auf dieser Erde
Als sie bereits niemanden
mehr kannte
wusste sie immer noch
die Nummern der Kunden
für die sie bei Kleinberger
Kleider verpackt hatte
Eine Erinnerung aus der Kindheit?
Mutter hatte Angst
sie im Wald spielen zu lassen
Fünf Menschen an ihrer Beerdigung
Ein Blumenstrauss vom Pflegeheim
Von ihrem Leben bleibt ein Fotoalbum
Ich blättere es durch
und betrachte lange das Bild
auf dem sie als sechsjähriges Mädchen
neben ihrer Mutter sitzt
Ein zaghaft scheues Lächeln
Bernhard Brack
Ein letztes Lächeln
Die Tropfen segnenden
Weihwassers krochen langsam
über den schräg gestellten Sarg
Minus 10 Grad
Auf den Grabsteinen
weisse Schneehauben
die auf der Rückseite
zungenförmig herabhingen
89 Jahre lang war sie auf dieser Erde
Als sie bereits niemanden
mehr kannte
wusste sie immer noch
die Nummern der Kunden
für die sie bei Kleinberger
Kleider verpackt hatte
Eine Erinnerung aus der Kindheit?
Mutter hatte Angst
sie im Wald spielen zu lassen
Fünf Menschen an ihrer Beerdigung
Ein Blumenstrauss vom Pflegeheim
Von ihrem Leben bleibt ein Fotoalbum
Ich blättere es durch
und betrachte lange das Bild
auf dem sie als sechsjähriges Mädchen
neben ihrer Mutter sitzt
Ein zaghaft scheues Lächeln
Bernhard Brack
Ist das Schicksal kooperativ
Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben. Und was bedeutet Kooperation für Leute die eine Heimkarriere hinter sich haben? Wären sie dann karrieren-los oder heimat-los?
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine Heimkarriere. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen bei unserer Mutter auf. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an:
„Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du wirst, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsenen Personen zu und fragte: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen ein. Bei einem grösseren Coup sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich wieder, Menschen zu begegnen, ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige es ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet.
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, allein zu sein.
Letzte Weihnachten feiern wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe – und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihm kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich wie ein Vater war, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob die Klippe meines 25-sten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und etwas zu essen reicht es. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld. Aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder ausstellen und den Leuten von Blut und abgeschlagenen Köpfen erzählen. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
Anonym
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine Heimkarriere. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen bei unserer Mutter auf. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an:
„Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du wirst, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsenen Personen zu und fragte: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen ein. Bei einem grösseren Coup sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich wieder, Menschen zu begegnen, ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige es ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet.
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, allein zu sein.
Letzte Weihnachten feiern wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe – und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihm kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich wie ein Vater war, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob die Klippe meines 25-sten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und etwas zu essen reicht es. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld. Aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder ausstellen und den Leuten von Blut und abgeschlagenen Köpfen erzählen. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
Anonym
Flucht durch Europa
Ich stamme aus einem Staat im Nahen Osten und bin seit zweieinhalb Jahren in der Schweiz. Von meinem Ehemann liess ich mich scheiden, weil er mich bedrohte, unterdrückte und schlug. Seitdem bin ich alleinerziehende Mutter von vier Kindern.
Meine erste Zeit in der Schweiz verbrachte ich im Frauenhaus und im Haus „Mutter und Kind“. Danach zog ich mit meinen Kindern in eine eigene Wohnung.
Mein Alltag sieht immer in etwa gleich aus. Ich habe vier Buben, im Alter zwischen dreieinhalb und zehn Jahren, die täglich irgendwohin begleitet werden müssen: Kinderhort, Jungwacht, Pfadi, Psychologen, Arzt, usw. Dazu kommen die Termine, die mich betreffen.
Ich bin 30 Jahre alt, habe gesundheitliche Beschwerden und leide unter starken Schmerzen. Deshalb kann ich nur wenig Lasten tragen, was mich zwingt, fast täglich einen Einkauf zu machen.
Alleinerziehend mit vier Kindern ist jeder Tag sehr lang. Ich habe kaum Zeit für mich. Am Abend bin ich um 21 Uhr so erschöpft, dass ich nur noch schlafen möchte. In der Nacht wecken mich meine Kinder, und um 6 Uhr muss ich dann bereits wieder aufstehen.
Ich vermisse eine erwachsene Person, mit der ich öfters reden kann. Ich kenne einige Frauen, die mich regelmässig einladen. Doch meist habe ich wenig Zeit, da ich dann gleich wieder ein Kind von mir bringen oder abholen muss.
Ich wurde mit 19 Jahren an einen 20 Jahren älteren Mann, der in einem Nachbarstaat wohnte, verheiratet. Ich hatte keine Wahl, weil in meinem Heimatland Frauen verheiratet werden. Meinen ersten Sohn gebar ich mit 20 Jahren. Der zweite kam auf die Welt, als ich 23 war. Danach begannen die Probleme mit meinem damaligen Mann. Er verbot mir den Kontakt zu meiner eigenen Familie und schloss mich im Haus ein. Ich war immer zu Hause und durfte nicht mehr raus unter die Menschen. Ich rebellierte, schlug sogar meinen Mann, der mich natürlich zurückschlug. Als Strafe gab er meine zwei Kinder zwei Monate lang zu seiner Schwester, obwohl ich noch stillte. Die Polizei wollte mir nicht helfen, da ich meinem Mann gehörte.
Ich floh nach Italien. Mein Mann kam nach und fand mich. Danach versuchte ich in verschiedenen Staaten in Europa Asyl zu beantragen. Doch man schickte mich immer wieder nach Italien. Dort wollte mich die Polizei nicht vor meinem Mann schützen. Eine Nonne erzählte mir, dass die Polizei in der Schweiz die Menschen schütze und organisierte mir und meinen Kindern eine Reise nach Genf. Dort half mir ein Mann ein Asylgesuch zu stellen. Nach dem zweiten Anlauf und mit Hilfe einer Beratung klappte es dann doch.
Ich liess mich im Staat, in dem ich mit meinem Mann verheiratet wurde, scheiden. Nach dortigem Gesetz gehören die Kinder nach der Scheidung meinem Exmann. Seitdem bin ich auf der Flucht vor ihm. Ich habe grosse Angst, dass er meine Kinder entführen wird. Mein Vater möchte keinen Kontakt mehr zu mir, weil ich mich habe scheiden lassen. Ich vermisse ihn trotzdem. Ebenso meine Mutter und Geschwister. Mein grösster Wunsch wäre es meine Mutter nochmals zu sehen. Sie ist sehr krank und hat ihre Enkelkinder noch nie gesehen.
anonym
Meine erste Zeit in der Schweiz verbrachte ich im Frauenhaus und im Haus „Mutter und Kind“. Danach zog ich mit meinen Kindern in eine eigene Wohnung.
Mein Alltag sieht immer in etwa gleich aus. Ich habe vier Buben, im Alter zwischen dreieinhalb und zehn Jahren, die täglich irgendwohin begleitet werden müssen: Kinderhort, Jungwacht, Pfadi, Psychologen, Arzt, usw. Dazu kommen die Termine, die mich betreffen.
Ich bin 30 Jahre alt, habe gesundheitliche Beschwerden und leide unter starken Schmerzen. Deshalb kann ich nur wenig Lasten tragen, was mich zwingt, fast täglich einen Einkauf zu machen.
Alleinerziehend mit vier Kindern ist jeder Tag sehr lang. Ich habe kaum Zeit für mich. Am Abend bin ich um 21 Uhr so erschöpft, dass ich nur noch schlafen möchte. In der Nacht wecken mich meine Kinder, und um 6 Uhr muss ich dann bereits wieder aufstehen.
Ich vermisse eine erwachsene Person, mit der ich öfters reden kann. Ich kenne einige Frauen, die mich regelmässig einladen. Doch meist habe ich wenig Zeit, da ich dann gleich wieder ein Kind von mir bringen oder abholen muss.
Ich wurde mit 19 Jahren an einen 20 Jahren älteren Mann, der in einem Nachbarstaat wohnte, verheiratet. Ich hatte keine Wahl, weil in meinem Heimatland Frauen verheiratet werden. Meinen ersten Sohn gebar ich mit 20 Jahren. Der zweite kam auf die Welt, als ich 23 war. Danach begannen die Probleme mit meinem damaligen Mann. Er verbot mir den Kontakt zu meiner eigenen Familie und schloss mich im Haus ein. Ich war immer zu Hause und durfte nicht mehr raus unter die Menschen. Ich rebellierte, schlug sogar meinen Mann, der mich natürlich zurückschlug. Als Strafe gab er meine zwei Kinder zwei Monate lang zu seiner Schwester, obwohl ich noch stillte. Die Polizei wollte mir nicht helfen, da ich meinem Mann gehörte.
Ich floh nach Italien. Mein Mann kam nach und fand mich. Danach versuchte ich in verschiedenen Staaten in Europa Asyl zu beantragen. Doch man schickte mich immer wieder nach Italien. Dort wollte mich die Polizei nicht vor meinem Mann schützen. Eine Nonne erzählte mir, dass die Polizei in der Schweiz die Menschen schütze und organisierte mir und meinen Kindern eine Reise nach Genf. Dort half mir ein Mann ein Asylgesuch zu stellen. Nach dem zweiten Anlauf und mit Hilfe einer Beratung klappte es dann doch.
Ich liess mich im Staat, in dem ich mit meinem Mann verheiratet wurde, scheiden. Nach dortigem Gesetz gehören die Kinder nach der Scheidung meinem Exmann. Seitdem bin ich auf der Flucht vor ihm. Ich habe grosse Angst, dass er meine Kinder entführen wird. Mein Vater möchte keinen Kontakt mehr zu mir, weil ich mich habe scheiden lassen. Ich vermisse ihn trotzdem. Ebenso meine Mutter und Geschwister. Mein grösster Wunsch wäre es meine Mutter nochmals zu sehen. Sie ist sehr krank und hat ihre Enkelkinder noch nie gesehen.
anonym
Dreieck Luanda - Lissabon - Luzern
Ich bin 1959 in Malanje, einer Stadt in Angola rund 150 km vom heutigen Kongo entfernt, geboren. Angola war eine portugiesische Kolonie und erhielt 1951 den Status einer Überseeprovinz.
Mein Vater besass verschiedene Einkaufsläden auf dem Land. Er verkaufte Kleider - seine Angestellten nähten auch selbst - , Trockenfisch, Maniokmehl, Werkzeug und anderes.
1961 begannen die Kämpfe um die Befreiung Angolas von der Herrschaft Portugals. Mein Vater erzählte uns, dass er alles verlor. Während ein bis zwei Jahren wüteten die Guerillas besonders schlimm im Land.
Bei einem gewollten Feuer 1964, in dem das Wild eingekesselt und gefangen wurde, erlitt mein Vater, trotz dem Auto, in dem er sich befand, starke Verbrennungen. Nach diesem Ereignis zierten grosse Narben sein Gesicht.
Trotz dem Unfall und des Bürgerkriegs, der noch Jahrzehnte andauern sollte, bewirtschaftete mein Vater in den Jahren danach Plantagen mit Baumwolle und Sonnenblumen. Diese Felder lagen in Quimbungo, einer Ortschaft zwischen Marimba und Chiguita. Ich erinnere mich, dass nebst Stoff auch Öl aus der Baumwollpflanze hergestellt wurde. Gleichzeitig übernahmen mein Vater und seine Angestellten Transporte für das Militär. Durch ihren Einsatz verminderte sich das Risiko für das Militär, von Guerillas überfallen zu werden.
In meinen jungen Jahren wohnte ich mit meinen Geschwistern bei meiner Mutter in der Stadt. Unser Vater, der oft auf dem Land war, besuchte uns etwa zweimal die Woche. Er war sein Leben lang immer geschäftstüchtig. So liess er damals Steine aus dem Grenzfluss zum Kongo für den Hausbau transportieren. Auch ich beteiligte mich daran und zog mit meinen 11 oder 12 Jahren am Lenkrad eines Traktors sitzend die grossen Steine, welche andere Jungs auf den Anhänger luden, aus dem Wasser. Wegen der Nachbarschaft zum Kongo war dies eine gefährliche Arbeit, weil sich die Guerillas jeweils nach ihren Angriffen über den Fluss in den Kongo zurückzogen. Nachts schliefen wir zur Sicherheit in einem Bunker. An diesem Fluss werden übrigens noch heute Diamanten abgebaut.
Trotz der widrigen Umstände konnte ich acht Jahre lang die Schule besuchen. Danach trat ich mit drei Cousins in ein Seminar/Internat in Malanje ein und blieb zwei Jahre.
Mit der Nelkenrevolution 1974 begann die Loslösung Angolas von Portugal. Nach dem Unabhängigkeitskrieg folgte ein langer Bürgerkrieg. Ich habe den Krieg teils miterlebt, habe viele Tote gesehen, darunter auch Kinder. Ich floh mit meiner Schwester und deren Kinder zum Schwager nach Saurimo, einer Stadt, die 400 km westlich von Malanje liegt. Doch auch dort herrschten kriegerische Zustände. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich, meine Schwester und seine Enkelkinder abholte. Gemeinsam flüchteten wir mit einem Kleinflugzeug nach Luanda, der Hauptstadt von Angola. Nachher nahm er den gefährlichen Weg nach Süden auf sich, holte seine anderen Familienmitglieder ab und fuhr sie mit einem Lastwagen zu uns in die Stadt.
Nach einem Jahr entschieden wir uns nach Portugal auszuwandern, weil die Zustände in Angola verheerend waren. Ich, meine Eltern, meine Geschwister und andere nahe Verwandte, insgesamt 11 Personen, landeten 1975 in Lissabon, einen Monat bevor die Unabhängigkeit (11. November) ausgesprochen wurde. Ich besuchte mit 15 Jahren nochmals während zwei Jahren die Schule. Danach gründete ich mit anderen Jungs eine Band. Es war meine Aufgabe die Band zu managen, weil ich kein Instrument beherrschte. Nach einem erfolgreichen Schreibmaschinenkurs fand ich dann einen Job in einem Hotel.
Mein Vater entschloss sich in dieser Zeit wieder nach Angola zurückzukehren. Er kaufte mir, ich war inzwischen 18 Jahre alt, und meiner Schwester eine Snackbar. Er schaffte es immer wieder Geschäfte zu machen, wahrscheinlich auch mit der Hilfe seines Onkels, der Anwalt gewesen war. Und sobald eine Sache gut lief, überliess er das Geschäft seinen Verwandten, damit diese es weiterführten und wandte sich neuen Ideen und möglichen Geschäften zu.
Diese Snackbar unterhielten wir eineinhalb Jahre. Im hinteren Teil befanden sich noch zwei Zimmer, in denen wir wohnten. Mit 20 musste ich zum Militär an die Küste, gleichzeitig machte ich Prüfungen an einer Schule, lernte die Grundkenntnisse des LKW-Fahrens und liess mich immer wieder auch an der Snackbar blicken. Danach verkauften wir sie und schafften uns mit dem Geld eine Wohnung an, um darin zu leben.
Meine nächste Arbeitsstelle befand sich in einer Fabrik, in der Zink auf giftige Weise produziert wurde. Gleichzeitig war ich als Sicherheitsmann in einem Büro angestellt. Während der Arbeitszeit lernte ich weiter für die LKW-Prüfung. Nachdem ich diese bestanden hatte, arbeitete ich als Chauffeur und Innendekorateur, weil ich handwerklich geschickt war. In einem Geschäft, das für Möbel und Dekos zuständig war, wurde ich angestellt. Ich fuhr die Möbel über weite Strecken und montierte jeweils am Zielort die Teile der Möbel zusammen. Ich kam bis in den Süden von Portugal, wo ich in einem neuen Hotel mit Appartements die Möbel in den Zimmern zusammen setzte. Zuerst war es nur eine Wohnung. Doch den Auftraggebern gefiel meine Arbeit so sehr, dass ich mit meinem Kollegen alle 40 Appartements ausstatten konnte.
Ich war in einer Beziehung mit einer lieben Freundin, die meinen ersten Sohn gebar. Mit 25 Jahren wurde ich so das erste Mal Vater. Trotzdem ging ich eine neue Liasion ein und ein Jahr später kam mein zweiter Sohn zur Welt.
Nach den Möbelmontagen verdiente ich mir unseren Lebensunterhalt mit Fischtransporten von Nordportugal nach Südspanien. Da die Fische möglichst am nächsten Morgen auf dem Markt sein mussten, fuhr ich nonstop und schnell durch die Nacht. Damals gab es noch keine Fahrtenschreiber. Aber ich verdiente ausreichend gut.
Mein Vater zog wieder zu uns nach Portugal und erwarb einen Supermarkt. Meine Schwester reiste in die Schweiz und nahm im Restaurant Gotthard in Luzern eine Stelle an. 1988 entschloss auch ich mich, wieder auszuwandern und reiste meiner Schwester nach. Ich betätigte mich im gleichen Restaurant als Hilfskoch. Aufgrund meiner raschen Auffassungsgabe und meinem Talent lernte ich schnell und gut zu kochen. Dank diesem Erfolg beförderte mich der Chef nach einem Jahr zum Koch. Ich blieb 5 Jahre lang im gleichen Restaurant tätig. In dieser Zeit hatte ich eine erneute Beziehung und meine Tochter erblickte die Welt.
Nach der Stelle in Luzern arbeitete ich in verschiedenen Restaurants als Koch: Stans, Sarnen, Inwil und Hochdorf. Meine Schwester zog derweil nach St. Gallen. Ich folgte ihr und kochte in Mörschwil in einem Restaurant. Auch im San Lorenzo und in den anderen 4 Restaurants vom gleichen Besitzer betätigte ich mich. In Hochdorf lernte ich Pizza machen, so dass ich mich auch Pizzaiolo nennen darf. Das war 1992. Ich hatte vier Kinder zu versorgen, doch hielt ich diesen Arbeitsstress nur ein Jahr lang durch. Danach hatte ich genug.
Meine Freundin, mit der ich meinen zweiten Sohn gezeugt hatte, wohnte eine Zeit lang mit mir in der Schweiz. Diese Beziehung ging nicht gut, und sie zog mit dem Sohn nach London. Dafür kam ich wieder mit meiner ersten Partnerin in Portugal zusammen. Sie schenkte meinem vierten Sohn das Leben und ging mit mir eine Ehe ein, die in der Schweiz vollzogen wurde.
Es folgten Jahre, in denen ich sehr viel arbeitete. Für eine Gross-Metzgerei transportierte ich Fleisch. Im Säntispark war ich in verschiedenen Bereichen in der Reinigung tätig. Ich hatte immer mehrere Jobs zur selben Zeit und schlief sehr wenig. Um zwei Uhr begann ich meine Schicht im Schlachthof und verlud Schweins- und Kalbsköpfe sowie Hälften von Rindern und anderen Tieren. Das war schrecklich.
1992/93 gründete ich mit Kollegen den Africain-Club, in dem Fussball gespielt wurde. Ich hatte grosse Freude, die Kinder zu trainieren und ihnen Tricks beizubringen.
1997/98 ereilte mich ein Burnout, weil ich einfach zuviel arbeitete und nicht auf mich achtete.
Noch während meiner Genesung gründete ich mit anderen zusammen den Multikultiverein. Ich erworb das Patent zur Führung eines Gastgewerbebetriebes und arbeitete nebenbei auch hier wieder als Chauffeur. Mit dieser Tätigkeit und dem Fussballclub fand ich wieder aus dem Burnout heraus.
Ich versuchte es 1999 noch einmal in einer Pizzeria. Doch das klappte nur ein Jahr lang.
Im Jahr 2000 folgte die Scheidung, da ich Schwierigkeiten mit meiner Frau hatte. Ich nahm nochmals für drei Jahre eine Stelle als Chauffeur bei einer grossen Transportfirma in St. Gallen an. Danach konnte mich beim Fahren nicht mehr so gut konzentrieren. So blieb mir noch die Arbeit im Gastgewerbe: Heiden, nachher St. Gallen, Trogen. Ich hatte eine neue Freundin, mit der ich in Trogen wohnte. Ich genoss jeweils die Zeit im Garten, in dem ich Blumen und Gemüse pflanzte.
In dieser Zeit bin ich viel gereist. Ich fuhr mit meinem Fahrrad um alle grossen Seen der Schweiz. Ich unternahm Reisen nach Italien, Spanien, Portugal und Grossbritannien. In London war ich oft, da einer meiner Söhne dort lebt. Ich besuchte Santiago di Compostela, allerdings mit dem Auto.
Ich konnte es nicht lassen und fuhr für eine Transportfirma wieder Lastwagen. Gleichzeitig versuchte ich nochmals mein Glück als Koch. Restaurantbesitzer nutzten meine Flexibilität aus, hielten sich nicht an die Verträge und zahlten keine Arbeitslosenbeiträge ein. Das war im Jahr 2009. Ich hatte danach 6-7 Monate lang keine Arbeit. Bei einem anderen Restaurant war ich einen Monat angestellt. Ein Vertrag wurde mir in dieser Zeit versprochen. Doch als ich nicht mehr gebraucht wurde, bekam ich die Kündigung.
Vor kurzem habe ich aufgehört zu rauchen, und es geht mir gut. Nach 40 Jahren Nikotin bin ich zu einem Nichtraucher geworden. Darauf bin ich sehr stolz. Ich bin in guter körperlicher Verfassung und auf der Suche nach einer Stelle als Koch oder LKW-Fahrer.
Ein grosser Traum von mir ist es, den Pilgerweg nach Santiago di Compostela mit dem Fahrrad zu erleben.
Und was meine Zukunft betrifft, würde ich gerne nach Angola zurückkehren, um im Agro-Tourismus tätig zu sein. Ich möchte die Landwirtschaft und das Gastgewerbe verbinden und Ferien auf einem Bauernhof anbieten. Das wäre eine neue Herausforderung für mich, für die ich mich sehr gut begeistern könnte. Meine Kinder und meine Enkelin möchte ich trotzdem oft besuchen, da sie mir sehr viel bedeuten.
St. Gallen, Januar 2011
Manuel
Mein Vater besass verschiedene Einkaufsläden auf dem Land. Er verkaufte Kleider - seine Angestellten nähten auch selbst - , Trockenfisch, Maniokmehl, Werkzeug und anderes.
1961 begannen die Kämpfe um die Befreiung Angolas von der Herrschaft Portugals. Mein Vater erzählte uns, dass er alles verlor. Während ein bis zwei Jahren wüteten die Guerillas besonders schlimm im Land.
Bei einem gewollten Feuer 1964, in dem das Wild eingekesselt und gefangen wurde, erlitt mein Vater, trotz dem Auto, in dem er sich befand, starke Verbrennungen. Nach diesem Ereignis zierten grosse Narben sein Gesicht.
Trotz dem Unfall und des Bürgerkriegs, der noch Jahrzehnte andauern sollte, bewirtschaftete mein Vater in den Jahren danach Plantagen mit Baumwolle und Sonnenblumen. Diese Felder lagen in Quimbungo, einer Ortschaft zwischen Marimba und Chiguita. Ich erinnere mich, dass nebst Stoff auch Öl aus der Baumwollpflanze hergestellt wurde. Gleichzeitig übernahmen mein Vater und seine Angestellten Transporte für das Militär. Durch ihren Einsatz verminderte sich das Risiko für das Militär, von Guerillas überfallen zu werden.
In meinen jungen Jahren wohnte ich mit meinen Geschwistern bei meiner Mutter in der Stadt. Unser Vater, der oft auf dem Land war, besuchte uns etwa zweimal die Woche. Er war sein Leben lang immer geschäftstüchtig. So liess er damals Steine aus dem Grenzfluss zum Kongo für den Hausbau transportieren. Auch ich beteiligte mich daran und zog mit meinen 11 oder 12 Jahren am Lenkrad eines Traktors sitzend die grossen Steine, welche andere Jungs auf den Anhänger luden, aus dem Wasser. Wegen der Nachbarschaft zum Kongo war dies eine gefährliche Arbeit, weil sich die Guerillas jeweils nach ihren Angriffen über den Fluss in den Kongo zurückzogen. Nachts schliefen wir zur Sicherheit in einem Bunker. An diesem Fluss werden übrigens noch heute Diamanten abgebaut.
Trotz der widrigen Umstände konnte ich acht Jahre lang die Schule besuchen. Danach trat ich mit drei Cousins in ein Seminar/Internat in Malanje ein und blieb zwei Jahre.
Mit der Nelkenrevolution 1974 begann die Loslösung Angolas von Portugal. Nach dem Unabhängigkeitskrieg folgte ein langer Bürgerkrieg. Ich habe den Krieg teils miterlebt, habe viele Tote gesehen, darunter auch Kinder. Ich floh mit meiner Schwester und deren Kinder zum Schwager nach Saurimo, einer Stadt, die 400 km westlich von Malanje liegt. Doch auch dort herrschten kriegerische Zustände. Ich erinnere mich, dass mein Vater mich, meine Schwester und seine Enkelkinder abholte. Gemeinsam flüchteten wir mit einem Kleinflugzeug nach Luanda, der Hauptstadt von Angola. Nachher nahm er den gefährlichen Weg nach Süden auf sich, holte seine anderen Familienmitglieder ab und fuhr sie mit einem Lastwagen zu uns in die Stadt.
Nach einem Jahr entschieden wir uns nach Portugal auszuwandern, weil die Zustände in Angola verheerend waren. Ich, meine Eltern, meine Geschwister und andere nahe Verwandte, insgesamt 11 Personen, landeten 1975 in Lissabon, einen Monat bevor die Unabhängigkeit (11. November) ausgesprochen wurde. Ich besuchte mit 15 Jahren nochmals während zwei Jahren die Schule. Danach gründete ich mit anderen Jungs eine Band. Es war meine Aufgabe die Band zu managen, weil ich kein Instrument beherrschte. Nach einem erfolgreichen Schreibmaschinenkurs fand ich dann einen Job in einem Hotel.
Mein Vater entschloss sich in dieser Zeit wieder nach Angola zurückzukehren. Er kaufte mir, ich war inzwischen 18 Jahre alt, und meiner Schwester eine Snackbar. Er schaffte es immer wieder Geschäfte zu machen, wahrscheinlich auch mit der Hilfe seines Onkels, der Anwalt gewesen war. Und sobald eine Sache gut lief, überliess er das Geschäft seinen Verwandten, damit diese es weiterführten und wandte sich neuen Ideen und möglichen Geschäften zu.
Diese Snackbar unterhielten wir eineinhalb Jahre. Im hinteren Teil befanden sich noch zwei Zimmer, in denen wir wohnten. Mit 20 musste ich zum Militär an die Küste, gleichzeitig machte ich Prüfungen an einer Schule, lernte die Grundkenntnisse des LKW-Fahrens und liess mich immer wieder auch an der Snackbar blicken. Danach verkauften wir sie und schafften uns mit dem Geld eine Wohnung an, um darin zu leben.
Meine nächste Arbeitsstelle befand sich in einer Fabrik, in der Zink auf giftige Weise produziert wurde. Gleichzeitig war ich als Sicherheitsmann in einem Büro angestellt. Während der Arbeitszeit lernte ich weiter für die LKW-Prüfung. Nachdem ich diese bestanden hatte, arbeitete ich als Chauffeur und Innendekorateur, weil ich handwerklich geschickt war. In einem Geschäft, das für Möbel und Dekos zuständig war, wurde ich angestellt. Ich fuhr die Möbel über weite Strecken und montierte jeweils am Zielort die Teile der Möbel zusammen. Ich kam bis in den Süden von Portugal, wo ich in einem neuen Hotel mit Appartements die Möbel in den Zimmern zusammen setzte. Zuerst war es nur eine Wohnung. Doch den Auftraggebern gefiel meine Arbeit so sehr, dass ich mit meinem Kollegen alle 40 Appartements ausstatten konnte.
Ich war in einer Beziehung mit einer lieben Freundin, die meinen ersten Sohn gebar. Mit 25 Jahren wurde ich so das erste Mal Vater. Trotzdem ging ich eine neue Liasion ein und ein Jahr später kam mein zweiter Sohn zur Welt.
Nach den Möbelmontagen verdiente ich mir unseren Lebensunterhalt mit Fischtransporten von Nordportugal nach Südspanien. Da die Fische möglichst am nächsten Morgen auf dem Markt sein mussten, fuhr ich nonstop und schnell durch die Nacht. Damals gab es noch keine Fahrtenschreiber. Aber ich verdiente ausreichend gut.
Mein Vater zog wieder zu uns nach Portugal und erwarb einen Supermarkt. Meine Schwester reiste in die Schweiz und nahm im Restaurant Gotthard in Luzern eine Stelle an. 1988 entschloss auch ich mich, wieder auszuwandern und reiste meiner Schwester nach. Ich betätigte mich im gleichen Restaurant als Hilfskoch. Aufgrund meiner raschen Auffassungsgabe und meinem Talent lernte ich schnell und gut zu kochen. Dank diesem Erfolg beförderte mich der Chef nach einem Jahr zum Koch. Ich blieb 5 Jahre lang im gleichen Restaurant tätig. In dieser Zeit hatte ich eine erneute Beziehung und meine Tochter erblickte die Welt.
Nach der Stelle in Luzern arbeitete ich in verschiedenen Restaurants als Koch: Stans, Sarnen, Inwil und Hochdorf. Meine Schwester zog derweil nach St. Gallen. Ich folgte ihr und kochte in Mörschwil in einem Restaurant. Auch im San Lorenzo und in den anderen 4 Restaurants vom gleichen Besitzer betätigte ich mich. In Hochdorf lernte ich Pizza machen, so dass ich mich auch Pizzaiolo nennen darf. Das war 1992. Ich hatte vier Kinder zu versorgen, doch hielt ich diesen Arbeitsstress nur ein Jahr lang durch. Danach hatte ich genug.
Meine Freundin, mit der ich meinen zweiten Sohn gezeugt hatte, wohnte eine Zeit lang mit mir in der Schweiz. Diese Beziehung ging nicht gut, und sie zog mit dem Sohn nach London. Dafür kam ich wieder mit meiner ersten Partnerin in Portugal zusammen. Sie schenkte meinem vierten Sohn das Leben und ging mit mir eine Ehe ein, die in der Schweiz vollzogen wurde.
Es folgten Jahre, in denen ich sehr viel arbeitete. Für eine Gross-Metzgerei transportierte ich Fleisch. Im Säntispark war ich in verschiedenen Bereichen in der Reinigung tätig. Ich hatte immer mehrere Jobs zur selben Zeit und schlief sehr wenig. Um zwei Uhr begann ich meine Schicht im Schlachthof und verlud Schweins- und Kalbsköpfe sowie Hälften von Rindern und anderen Tieren. Das war schrecklich.
1992/93 gründete ich mit Kollegen den Africain-Club, in dem Fussball gespielt wurde. Ich hatte grosse Freude, die Kinder zu trainieren und ihnen Tricks beizubringen.
1997/98 ereilte mich ein Burnout, weil ich einfach zuviel arbeitete und nicht auf mich achtete.
Noch während meiner Genesung gründete ich mit anderen zusammen den Multikultiverein. Ich erworb das Patent zur Führung eines Gastgewerbebetriebes und arbeitete nebenbei auch hier wieder als Chauffeur. Mit dieser Tätigkeit und dem Fussballclub fand ich wieder aus dem Burnout heraus.
Ich versuchte es 1999 noch einmal in einer Pizzeria. Doch das klappte nur ein Jahr lang.
Im Jahr 2000 folgte die Scheidung, da ich Schwierigkeiten mit meiner Frau hatte. Ich nahm nochmals für drei Jahre eine Stelle als Chauffeur bei einer grossen Transportfirma in St. Gallen an. Danach konnte mich beim Fahren nicht mehr so gut konzentrieren. So blieb mir noch die Arbeit im Gastgewerbe: Heiden, nachher St. Gallen, Trogen. Ich hatte eine neue Freundin, mit der ich in Trogen wohnte. Ich genoss jeweils die Zeit im Garten, in dem ich Blumen und Gemüse pflanzte.
In dieser Zeit bin ich viel gereist. Ich fuhr mit meinem Fahrrad um alle grossen Seen der Schweiz. Ich unternahm Reisen nach Italien, Spanien, Portugal und Grossbritannien. In London war ich oft, da einer meiner Söhne dort lebt. Ich besuchte Santiago di Compostela, allerdings mit dem Auto.
Ich konnte es nicht lassen und fuhr für eine Transportfirma wieder Lastwagen. Gleichzeitig versuchte ich nochmals mein Glück als Koch. Restaurantbesitzer nutzten meine Flexibilität aus, hielten sich nicht an die Verträge und zahlten keine Arbeitslosenbeiträge ein. Das war im Jahr 2009. Ich hatte danach 6-7 Monate lang keine Arbeit. Bei einem anderen Restaurant war ich einen Monat angestellt. Ein Vertrag wurde mir in dieser Zeit versprochen. Doch als ich nicht mehr gebraucht wurde, bekam ich die Kündigung.
Vor kurzem habe ich aufgehört zu rauchen, und es geht mir gut. Nach 40 Jahren Nikotin bin ich zu einem Nichtraucher geworden. Darauf bin ich sehr stolz. Ich bin in guter körperlicher Verfassung und auf der Suche nach einer Stelle als Koch oder LKW-Fahrer.
Ein grosser Traum von mir ist es, den Pilgerweg nach Santiago di Compostela mit dem Fahrrad zu erleben.
Und was meine Zukunft betrifft, würde ich gerne nach Angola zurückkehren, um im Agro-Tourismus tätig zu sein. Ich möchte die Landwirtschaft und das Gastgewerbe verbinden und Ferien auf einem Bauernhof anbieten. Das wäre eine neue Herausforderung für mich, für die ich mich sehr gut begeistern könnte. Meine Kinder und meine Enkelin möchte ich trotzdem oft besuchen, da sie mir sehr viel bedeuten.
St. Gallen, Januar 2011
Manuel
Immer unterwegs
Ein 56-jähriger Mann taucht beim Sozialdienst auf und erzählt stolz von seiner Lebensweise, die ihn kreuz und quer durch Deutschland geführt hat. Schlussendlich sucht er sein Glück in Österreich und in der Schweiz.
Ich wuchs in Oberfranken in einer Familie mit fünf Geschwistern auf. Mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt war. Als ich mit 14 aus der Schule kam, hatte meine Mutter einen Freund. Ich bekam Streit mit ihm, weil ich fand, dass er mir nichts zu sagen habe. Darauf warf mich meine Mutter aus der Wohnung. Ich konnte mir den Keller zum Schlafen einrichten. Strom zapfte ich von der Wohnung oben ab, so hatte ich wenigstens Licht.
Ich fing dann eine Lehre als Maler an, aber ich verdiente nur 15 Mark in der Woche. Da hörte ich wieder auf und arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Spinnerei.
Damals, als Jugendlicher, war ich ein Kämpfer. Wenn mir einer nicht passte, gab es halt eins auf die Rübe. Darum hatte ich auch 36 Vorstrafen.
Nach dem „Kindergarten“, so sage ich der Bundeswehr, wohnte ich in Männerwohnheimen. Wegen der Bevormundung dort blieb ich aber nie lange an einem Ort: Frankfurt, Stuttgart… Ich bin sowieso ein reiselustiger Mensch! Per Autostop bin ich bis nach Hamburg hoch, weil ich nach England wollte. Das klappte aber nicht, und so fuhr ich über Köln und Frankfurt wieder zurück.
In München war ich dann einmal unschuldig im Knast. Es wurde mir vorgeworfen, ein älteres Ehepaar bedroht zu haben. Als aber die Wahrheit herauskam, erhielt ich eine Wiedergutmachung. Lange Zeit brachte ich mich als Gelegenheitsarbeiter in der Gastronomie und Landwirtschaft durch. Aber da wurde ich oft ausgenutzt. Zwischendurch machte ich auch gar nichts. Doch mit Hartz IV kann man ja nicht leben: „Zu wenig zum Leben, zuviel um zu sterben.“
Zuletzt suchte ich in Bayern Arbeit, fand aber keine. Auch in Bregenz und Dornbirn hatte ich kein Glück. Per Autostop kam ich dann von Österreich in die Schweiz. Jetzt suche ich im Kanton St. Gallen eine Arbeitsstelle. Doch das ist schwierig: „Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung!“ Aber betteln tue ich nicht! Da habe ich ein Schamgefühl.
Den jungen Leuten sage ich darum auch, sie sollen etwas aus ihrem Leben machen und einen Beruf erlernen. Und dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen und nicht mit „schlechten“ Leuten abhängen. Ich selbst habe keine Zukunft mehr; ich habe meinen Lebensstil, und so mache ich weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen!
anonym
Ich wuchs in Oberfranken in einer Familie mit fünf Geschwistern auf. Mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt war. Als ich mit 14 aus der Schule kam, hatte meine Mutter einen Freund. Ich bekam Streit mit ihm, weil ich fand, dass er mir nichts zu sagen habe. Darauf warf mich meine Mutter aus der Wohnung. Ich konnte mir den Keller zum Schlafen einrichten. Strom zapfte ich von der Wohnung oben ab, so hatte ich wenigstens Licht.
Ich fing dann eine Lehre als Maler an, aber ich verdiente nur 15 Mark in der Woche. Da hörte ich wieder auf und arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Spinnerei.
Damals, als Jugendlicher, war ich ein Kämpfer. Wenn mir einer nicht passte, gab es halt eins auf die Rübe. Darum hatte ich auch 36 Vorstrafen.
Nach dem „Kindergarten“, so sage ich der Bundeswehr, wohnte ich in Männerwohnheimen. Wegen der Bevormundung dort blieb ich aber nie lange an einem Ort: Frankfurt, Stuttgart… Ich bin sowieso ein reiselustiger Mensch! Per Autostop bin ich bis nach Hamburg hoch, weil ich nach England wollte. Das klappte aber nicht, und so fuhr ich über Köln und Frankfurt wieder zurück.
In München war ich dann einmal unschuldig im Knast. Es wurde mir vorgeworfen, ein älteres Ehepaar bedroht zu haben. Als aber die Wahrheit herauskam, erhielt ich eine Wiedergutmachung. Lange Zeit brachte ich mich als Gelegenheitsarbeiter in der Gastronomie und Landwirtschaft durch. Aber da wurde ich oft ausgenutzt. Zwischendurch machte ich auch gar nichts. Doch mit Hartz IV kann man ja nicht leben: „Zu wenig zum Leben, zuviel um zu sterben.“
Zuletzt suchte ich in Bayern Arbeit, fand aber keine. Auch in Bregenz und Dornbirn hatte ich kein Glück. Per Autostop kam ich dann von Österreich in die Schweiz. Jetzt suche ich im Kanton St. Gallen eine Arbeitsstelle. Doch das ist schwierig: „Ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung!“ Aber betteln tue ich nicht! Da habe ich ein Schamgefühl.
Den jungen Leuten sage ich darum auch, sie sollen etwas aus ihrem Leben machen und einen Beruf erlernen. Und dass sie ihren eigenen Weg gehen sollen und nicht mit „schlechten“ Leuten abhängen. Ich selbst habe keine Zukunft mehr; ich habe meinen Lebensstil, und so mache ich weiter. Ich lasse mich nicht unterkriegen!
anonym
Das Schicksal war sehr hart mit mir
Das Leben kann manchmal rasch eine unerwartete und unglückliche Wendung nehmen. Eine Frau erzählt in der folgenden Geschichte, was ihr widerfahren ist.
Als ich vor 2 1/2 Jahren in die Schweiz nach St. Gallen kam, hatte ich alles. Ich war gesund, glücklich und erfolgreich, doch mein Leben nahm eine Wendung und das Schicksal nahm seinen Lauf.
Im Dezember vergangenen Jahres trennte ich mich von meinem langjährigen Lebensgefährten. Zunächst lief alles reibungslos ab, bis er mich ein wenig später in der Nacht kurz vor Weihnachten erstechen wollte. Ich verstand die Welt nicht mehr und fragte mich, warum er mich so sehr hasste, nach allen Höhen und Tiefen, die wir zusammen bestritten haben und nach allem, was ich für ihn getan habe.
Wir arbeiteten sogar in derselben Einrichtung, was die ganze Sache nicht gerade einfacher machte.
Anfang Januar nahm ich all meinen Mut zusammen und ging wieder zur Arbeit. Dort erwartete mich das, was ich niemals zu träumen gewagt hätte. Meine Chefin hatte allen Mitarbeitern erzählt, was im Dezember passiert war. Ich kam mir so schlecht vor und fühlte mich gedemütigt. Einige Kollegen sprachen mich direkt an, andere redeten hinter meinem Rücken oder trauten sich nicht mich anzusehen. Dann holte sie mich zu einem Gespräch und teilte mir mit, dass sie meine Stelle bereits neu besetzt hatte, da ich krankgeschrieben war. Ich war völlig fassungslos und fühlte mich hintergangen und bekam zudem einige Tage später auch noch meine Kündigung.
Mittlerweile habe ich meine eigene Wohnung und nach unzähligen Bewerbungen die Aussicht auf eine neue Arbeitsstelle in meinem erlernten Beruf.
Der Sozialdienst hat mich bis heute begleitet und unterstützt, und ich möchte nicht darüber nachdenken, wie es mir ohne die Hilfestellung ergangen wäre. Vielen lieben Dank für alles.
anonym
Als ich vor 2 1/2 Jahren in die Schweiz nach St. Gallen kam, hatte ich alles. Ich war gesund, glücklich und erfolgreich, doch mein Leben nahm eine Wendung und das Schicksal nahm seinen Lauf.
Im Dezember vergangenen Jahres trennte ich mich von meinem langjährigen Lebensgefährten. Zunächst lief alles reibungslos ab, bis er mich ein wenig später in der Nacht kurz vor Weihnachten erstechen wollte. Ich verstand die Welt nicht mehr und fragte mich, warum er mich so sehr hasste, nach allen Höhen und Tiefen, die wir zusammen bestritten haben und nach allem, was ich für ihn getan habe.
Wir arbeiteten sogar in derselben Einrichtung, was die ganze Sache nicht gerade einfacher machte.
Anfang Januar nahm ich all meinen Mut zusammen und ging wieder zur Arbeit. Dort erwartete mich das, was ich niemals zu träumen gewagt hätte. Meine Chefin hatte allen Mitarbeitern erzählt, was im Dezember passiert war. Ich kam mir so schlecht vor und fühlte mich gedemütigt. Einige Kollegen sprachen mich direkt an, andere redeten hinter meinem Rücken oder trauten sich nicht mich anzusehen. Dann holte sie mich zu einem Gespräch und teilte mir mit, dass sie meine Stelle bereits neu besetzt hatte, da ich krankgeschrieben war. Ich war völlig fassungslos und fühlte mich hintergangen und bekam zudem einige Tage später auch noch meine Kündigung.
Mittlerweile habe ich meine eigene Wohnung und nach unzähligen Bewerbungen die Aussicht auf eine neue Arbeitsstelle in meinem erlernten Beruf.
Der Sozialdienst hat mich bis heute begleitet und unterstützt, und ich möchte nicht darüber nachdenken, wie es mir ohne die Hilfestellung ergangen wäre. Vielen lieben Dank für alles.
anonym
Lebensfreude
Seit über 10 Jahren ist Frau W. im Heroinprogramm, mit dem es ihr möglich ist, ein geregeltes Leben zu führen. Wie ihr Alltag aussieht, beschreibt sie in einigen Sätzen.
Vor vielen Jahren besuchte ich oft die Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus in Wil. Dort konnte ich mit meinen Sorgen und Nöten hin, es war immer jemand da, der mir zuhörte. Über den Kaktus konnte ich zudem einige Jahre in einer WG mit anderen Frauen, oder auch gemischt, wohnen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, einmal ohne Drogen zu leben. Deshalb war ich sehr interessiert, als ich von der Heroinabgabe in St. Gallen hörte. Über die Leute vom Kaktus habe ich dann die Anmeldung gemacht, bin aufgenommen worden und fahre nun schon mehr als 10 Jahre zweimal täglich nach St. Gallen. Die Bahnstrecke kenne ich jetzt in- und auswendig, aber macht ja nichts.
Die Heroinabgabe hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu bekommen und Abstand von der Gasse zu gewinnen. Seit einigen Jahren arbeite ich auch wieder. In geschützten Werkstätten habe ich sinnvolle Beschäftigungen gefunden. Zurzeit arbeite ich in einer Werkstätte auf dem Lande. Das braucht nach der morgendlichen Heroinabgabe nochmals eine Zugfahrt. Da kenne ich bisher noch nicht alles in- und auswendig, macht auch nichts.
Ich bin nach wie vor froh, dass ich am Heroinprogramm teilnehmen kann. Es ist mir so möglich, ein geregeltes Leben zu führen. Erfreulich ist auch, dass ich seit einigen Jahren wieder guten Kontakt mit meiner Familie pflegen kann.
So kann mein Leben gerne weitergehen...
Karin W.
Vor vielen Jahren besuchte ich oft die Kontakt- und Anlaufstelle Kaktus in Wil. Dort konnte ich mit meinen Sorgen und Nöten hin, es war immer jemand da, der mir zuhörte. Über den Kaktus konnte ich zudem einige Jahre in einer WG mit anderen Frauen, oder auch gemischt, wohnen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, einmal ohne Drogen zu leben. Deshalb war ich sehr interessiert, als ich von der Heroinabgabe in St. Gallen hörte. Über die Leute vom Kaktus habe ich dann die Anmeldung gemacht, bin aufgenommen worden und fahre nun schon mehr als 10 Jahre zweimal täglich nach St. Gallen. Die Bahnstrecke kenne ich jetzt in- und auswendig, aber macht ja nichts.
Die Heroinabgabe hat mir geholfen, mein Leben in den Griff zu bekommen und Abstand von der Gasse zu gewinnen. Seit einigen Jahren arbeite ich auch wieder. In geschützten Werkstätten habe ich sinnvolle Beschäftigungen gefunden. Zurzeit arbeite ich in einer Werkstätte auf dem Lande. Das braucht nach der morgendlichen Heroinabgabe nochmals eine Zugfahrt. Da kenne ich bisher noch nicht alles in- und auswendig, macht auch nichts.
Ich bin nach wie vor froh, dass ich am Heroinprogramm teilnehmen kann. Es ist mir so möglich, ein geregeltes Leben zu führen. Erfreulich ist auch, dass ich seit einigen Jahren wieder guten Kontakt mit meiner Familie pflegen kann.
So kann mein Leben gerne weitergehen...
Karin W.
Meine Geschichte
Ein 41-jähriger Mann erzählt, wie er von seiner Drogenabhängigkeit loszukommen versuchte. Ein eindrückliches Dokument.
Vor zirka 1,5 Jahren war ich ziemlich am Ende. Ich bin 41 Jahre alt und davon 21 Jahre heroinabhängig. Nach mehreren Entzügen, Klinikaufenthalten und Therapien sagte ich zu mir, es ist genug. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich dachte an die Vergangenheit zurück, was ich alles so erlebt habe, von Amoklauf bis zur Beschaffungskriminalität und vieles mehr. Ich dachte, soll ich vor den Zug stehen oder soll ich es nochmals versuchen loszukommen und ein normales Leben zu führen. Ich ging ins MSH2 Methadonabgabe zu meiner Bezugsperson und Ärztin. Ich bekam zuerst mal ein stärkeres Psychopharmaka, das mir sehr geholfen hat und mich vom Selbstmord abhielt, und nachdem ich mich etwas erholt hatte, ging ich in die Klinik Pfäfers und lernte dort eine Therapieangebot kennen im Tessin, das Camarco. Ich entschloss mich in diese Therapie zu gehen. Ich erkundigte mich und als alles klar war, löste ich meine Zweizimmerwohnung auf. Ich machte den Entzug im Camarco vom Methadon. Nach 1,5 Monaten war ich clean und nach ca. 3 Monaten habe ich die Therapie aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Weil es zum Beispiel Ungerechtigkeiten gab und das Konzept nicht eingehalten wurde und ein Haufen konsumiert wurde, ins Büro eingebrochen wurde und verschiedene Diebstähle begangen worden sind und trotzdem nichts Ernsthaftes passiert ist. Anschliessend ging ich vorübergehend zu meiner Mutter für ca. einen Monat. Dann entschloss ich mich weiterzumachen und ging in die Klinik Pfäfers. Da musste ich gehen, weil ich einmal nicht ins Turnen ging. Also wieder zu der Mutter. Ich meldete mich in der Klinik Wil an. Also liess ich mich von der Ärztin einweisen, dann konnte ich nach ein paar Tagen in die Klinik Wil. Dort machte ich wieder den Entzug bis auf 10mg Methadon. Bis dahin vergingen fast 1,5 Jahre. Ich hatte langsam genug von Therapien und Klinikaufenthalten und brach ab. Und wieder zu der Mutter. Nach ca. 2,5 Monaten hatte ich wieder eine Wohnung. Das war ein Stress bis ich wieder eingerichtet war und die Wohnung endlich hatte. Jetzt habe ich mich mit meiner Situation abgefunden, dass ich im MSH2 bin und halt die 40mg Methadon einfach brauche, wie andere Medikamente brauchen. Ich arbeite jetzt auch 50%, nachmittags. Ich werde bald 42 und vielleicht schaffe ich es ja mal. Das ist meine Vergangenheit.
Alfons
Vor zirka 1,5 Jahren war ich ziemlich am Ende. Ich bin 41 Jahre alt und davon 21 Jahre heroinabhängig. Nach mehreren Entzügen, Klinikaufenthalten und Therapien sagte ich zu mir, es ist genug. Ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich dachte an die Vergangenheit zurück, was ich alles so erlebt habe, von Amoklauf bis zur Beschaffungskriminalität und vieles mehr. Ich dachte, soll ich vor den Zug stehen oder soll ich es nochmals versuchen loszukommen und ein normales Leben zu führen. Ich ging ins MSH2 Methadonabgabe zu meiner Bezugsperson und Ärztin. Ich bekam zuerst mal ein stärkeres Psychopharmaka, das mir sehr geholfen hat und mich vom Selbstmord abhielt, und nachdem ich mich etwas erholt hatte, ging ich in die Klinik Pfäfers und lernte dort eine Therapieangebot kennen im Tessin, das Camarco. Ich entschloss mich in diese Therapie zu gehen. Ich erkundigte mich und als alles klar war, löste ich meine Zweizimmerwohnung auf. Ich machte den Entzug im Camarco vom Methadon. Nach 1,5 Monaten war ich clean und nach ca. 3 Monaten habe ich die Therapie aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Weil es zum Beispiel Ungerechtigkeiten gab und das Konzept nicht eingehalten wurde und ein Haufen konsumiert wurde, ins Büro eingebrochen wurde und verschiedene Diebstähle begangen worden sind und trotzdem nichts Ernsthaftes passiert ist. Anschliessend ging ich vorübergehend zu meiner Mutter für ca. einen Monat. Dann entschloss ich mich weiterzumachen und ging in die Klinik Pfäfers. Da musste ich gehen, weil ich einmal nicht ins Turnen ging. Also wieder zu der Mutter. Ich meldete mich in der Klinik Wil an. Also liess ich mich von der Ärztin einweisen, dann konnte ich nach ein paar Tagen in die Klinik Wil. Dort machte ich wieder den Entzug bis auf 10mg Methadon. Bis dahin vergingen fast 1,5 Jahre. Ich hatte langsam genug von Therapien und Klinikaufenthalten und brach ab. Und wieder zu der Mutter. Nach ca. 2,5 Monaten hatte ich wieder eine Wohnung. Das war ein Stress bis ich wieder eingerichtet war und die Wohnung endlich hatte. Jetzt habe ich mich mit meiner Situation abgefunden, dass ich im MSH2 bin und halt die 40mg Methadon einfach brauche, wie andere Medikamente brauchen. Ich arbeite jetzt auch 50%, nachmittags. Ich werde bald 42 und vielleicht schaffe ich es ja mal. Das ist meine Vergangenheit.
Alfons
Arbeitslos
Arbeitslos, wie fühlt sich das an? Ein Mann beschreibt seinen Alltag und seinen Umgang mit Arbeitslosigkeit. Lassen Sie sich überraschen!
Gerne stelle ich mich vor und erzähle von meiner Arbeitslosigkeit und wie ich sie bewältige: Ich heisse Roger, bin 47 Jahre alt und seit dem 1. November 2008 arbeitslos. Ich bin nicht das erste Mal arbeitslos, das letzte Mal vor 10 Jahren, allerdings war ich damals nur gerade 3 Monate ohne Stelle. Warum ich damals schneller einen Job gefunden habe? Ganz einfach: Ich war 10 Jahre jünger und die Wirtschaftslage war besser als heute!
In dem Alter und bei der heutigen Wirtschaftslage eine Stelle zu finden ist sehr schwierig, leider will das kein Stellenvermittlungsbüro zugeben. Sie versprechen einem das Blaue vom Himmel herunter: „Nein, nein, Sie sind überhaupt nicht zu alt.“ Oder: „Mit Ihren Qualifikationen werden Sie schnell wieder eine Stelle finden.“ Den Vogel abgeschossen hat allerdings die Filiale eines bekannten Stellenvermittlungsbüros. Ich habe mich dort um eine Temporärstelle beworben, wo Französischkenntnisse verlangt wurden. Per Mail hat mir die Dame mitgeteilt, dass ich sie anrufen solle. Als ich sie dann an einem Mittwoch angerufen habe, hat sie mir mitgeteilt, es sei schade, dass ich mich nicht früher gemeldet hätte, sie hätten sehr lange jemanden für eine andere Stelle mit guten Französisch-kenntnissen gesucht, nun sei die Stelle leider bereits vergeben. Ich habe ihr dann entgegnet, dass ich mich für die Temporärstelle beworben hätte. Sie hat mir dann gesagt: „Wenn Sie bis Freitag nichts von mir hören, kommen Sie für diese Stelle nicht in Frage.“ Während des ganzen Telefonates hat mir mein Gefühl gesagt, dass mich die Dame von A – Z angelogen hat. Natürlich habe ich bis Freitag nichts gehört. Am Montag habe ich ihr ein Mail gesandt, mit der Frage, sie möge mir doch mitteilen, warum ich die Stelle nicht erhalten hätte. Sie hat es nicht einmal für nötig gefunden mir zu antworten! Zwei Tage später habe ich ihr gemailt, sie möchte meine Unterlagen vernichten, ich verzichte auf eine Zusammenarbeit mit ihrer Filiale. Mir scheint, dass die Stellenvermittlungsbüros kein Interesse haben, mich zu vermitteln, oder wissen sie, dass ich schwer vermittelbar bin und sagen es mir nur nicht (siehe oben)?
Als ich an einem Donnerstagnachmittag einkaufen ging, habe ich einen Bekannten von mir getroffen, er war früher Personalchef. Nach einem längeren Gespräch hat er mir bestätigt, dass ich für den Arbeitsmarkt zu alt sei. Ich sei eben näher bei 50 als bei 40, hat er mir gesagt. Schöne Aussichten, nicht?
Ich bin vielseitig interessiert. Damit ich die mir nun zur Verfügung stehend Zeit sinnvoll nutzen kann, habe ich mir einen Plan gemacht, was ich an welchem Morgen tun werde. Dieser Plan sieht folgendermassen aus:
Montag: Englisch lesen und schreiben
Dienstag: Deutsch
Mittwoch: Französisch lesen und schreiben
Donnerstag: Psychologiebuch lesen (Zimbardo)
Freitag: Studium des Biologiebuches von Neil A. Campbell. Dies ist das Buch, welches Biologiestudenten für ihr Studium benötigen. Es umfasst 1600 Seiten und ist 2kg schwer! Ein äusserst interessantes Buch!
Im Oktober 2009 habe ich an der Akademie St. Gallen mit der 3jährigen Weiterbildung zum Betriebswirtschafter HF begonnen. So musste ich obigen Plan dahingehend ändern, dass die Schulfächer Vorrang haben. Der geänderte Plan sieht nun folgendermassen aus:
Montag: Betriebswirtschaftliches Modell (anhand des St. Galler Management-Modells)
Dienstag: Volkswirtschaftslehre
Mittwoch: Unternehmenslogistik
Donnerstag: Finanz- und Rechnungswesen
Freitag: Organisation
Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, halte ich mich weiterhin an den alten Plan.
Ich würde nie am Mittag für mich alleine kochen (ausser am Sonntag), da ich dies auch als reine Zeitverschwendung empfinde. Es ist nicht so, dass ich nicht kochen könnte, aber ich esse nicht gerne alleine. In einem Restaurant hat es immer viele Leute, da gibt’s immer was zu beobachten, manchmal treffe ich auch jemanden, den ich kenne. Deshalb esse ich jeden Mittag in einem anderen Restaurant: Am Montag gehe ich mit einem ehemaligen Schulkollegen essen, am Dienstag war ich bis jetzt am Mittagstisch der Pfarrei am Dom. Da es ihn nicht mehr gibt, gehe ich jetzt im ‚Gschwend’ essen, am Mittwoch im Rest. Schwarzen Adler, am Donnerstag bei meinen Eltern, am Freitag nehme ich mein Mittagessen im KBZ Kreuzbleiche ein, weil dort um 13 Uhr mein Weiterbildungskurs beginnt.
Am Nachmittag bin ich im B & I (Beratung und Information, gehört zum RAV) anzutreffen, wo ich mein E-Mail Konto leere und Bewerbungen schreibe. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch mit den einen oder anderen Personen dort. So sehen meine Tage aus, eigentlich nicht spektakulär. Mir ist wichtig, dass ich eine Struktur habe. Ich bemühe mich auch, abends zeitig schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Ich weiss ja nie, wann ich wieder eine Stelle habe. Da ist eine Tagesstruktur schon von Vorteil. Ich glaube nicht, dass ich ein typischer Arbeitsloser bin, denn ich kann mich sehr gut beschäftigen (siehe oben!) Physik, Chemie und Astronomie interessieren mich auch. Da ich mich nun weiterbilde, hat sich dieses Thema von selbst erledigt. Es gibt einen Spruch, der lautet: Wer arbeiten will, findet auch Arbeit. Ich finde diesen Spruch total daneben, denn ich will ja arbeiten und habe auch bereits mehr als 100 Bewerbungen geschrieben. Aber was soll ich machen, wenn man mich nicht arbeiten lässt?
Mit Hilfe des B& I habe ich einen Flyer kreiert (ich suche, ich biete), den ich meinen Kollegen und den Dozenten an der Akademie in St. Gallen gemailt oder per Post geschickt habe. Diesen Flyer werde ich an ausgewählte Firmen senden und anfangs März werde ich ein Stelleninserat veröffentlichen (so ich bis dann noch keine Stelle habe).
Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch, aber es gibt Tage, da fühle ich mich so nutzlos, ich frage mich dann, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Zum Glück sind diese Phasen jeweils sehr kurz, eben: Ich bin ein Stehauf-männchen. Allerdings werde ich im Frühjahr 2010 ausgesteuert sein, sollte ich bis dann keine Stelle gefunden haben. Das macht mir langsam aber sicher Sorgen, da die Wirtschaftsprognosen noch nicht allzu rosig sind.
Trotzdem bin ich jede Woche motiviert, um neue Bewerbungen zu schreiben, es könnte ja sein, dass ich gerade dank dieser einen Bewerbung eine neue Stelle habe! Darum mein Rat an alle: Gebt niemals auf und macht das Beste aus jeder Situation!
Roger
Gerne stelle ich mich vor und erzähle von meiner Arbeitslosigkeit und wie ich sie bewältige: Ich heisse Roger, bin 47 Jahre alt und seit dem 1. November 2008 arbeitslos. Ich bin nicht das erste Mal arbeitslos, das letzte Mal vor 10 Jahren, allerdings war ich damals nur gerade 3 Monate ohne Stelle. Warum ich damals schneller einen Job gefunden habe? Ganz einfach: Ich war 10 Jahre jünger und die Wirtschaftslage war besser als heute!
In dem Alter und bei der heutigen Wirtschaftslage eine Stelle zu finden ist sehr schwierig, leider will das kein Stellenvermittlungsbüro zugeben. Sie versprechen einem das Blaue vom Himmel herunter: „Nein, nein, Sie sind überhaupt nicht zu alt.“ Oder: „Mit Ihren Qualifikationen werden Sie schnell wieder eine Stelle finden.“ Den Vogel abgeschossen hat allerdings die Filiale eines bekannten Stellenvermittlungsbüros. Ich habe mich dort um eine Temporärstelle beworben, wo Französischkenntnisse verlangt wurden. Per Mail hat mir die Dame mitgeteilt, dass ich sie anrufen solle. Als ich sie dann an einem Mittwoch angerufen habe, hat sie mir mitgeteilt, es sei schade, dass ich mich nicht früher gemeldet hätte, sie hätten sehr lange jemanden für eine andere Stelle mit guten Französisch-kenntnissen gesucht, nun sei die Stelle leider bereits vergeben. Ich habe ihr dann entgegnet, dass ich mich für die Temporärstelle beworben hätte. Sie hat mir dann gesagt: „Wenn Sie bis Freitag nichts von mir hören, kommen Sie für diese Stelle nicht in Frage.“ Während des ganzen Telefonates hat mir mein Gefühl gesagt, dass mich die Dame von A – Z angelogen hat. Natürlich habe ich bis Freitag nichts gehört. Am Montag habe ich ihr ein Mail gesandt, mit der Frage, sie möge mir doch mitteilen, warum ich die Stelle nicht erhalten hätte. Sie hat es nicht einmal für nötig gefunden mir zu antworten! Zwei Tage später habe ich ihr gemailt, sie möchte meine Unterlagen vernichten, ich verzichte auf eine Zusammenarbeit mit ihrer Filiale. Mir scheint, dass die Stellenvermittlungsbüros kein Interesse haben, mich zu vermitteln, oder wissen sie, dass ich schwer vermittelbar bin und sagen es mir nur nicht (siehe oben)?
Als ich an einem Donnerstagnachmittag einkaufen ging, habe ich einen Bekannten von mir getroffen, er war früher Personalchef. Nach einem längeren Gespräch hat er mir bestätigt, dass ich für den Arbeitsmarkt zu alt sei. Ich sei eben näher bei 50 als bei 40, hat er mir gesagt. Schöne Aussichten, nicht?
Ich bin vielseitig interessiert. Damit ich die mir nun zur Verfügung stehend Zeit sinnvoll nutzen kann, habe ich mir einen Plan gemacht, was ich an welchem Morgen tun werde. Dieser Plan sieht folgendermassen aus:
Montag: Englisch lesen und schreiben
Dienstag: Deutsch
Mittwoch: Französisch lesen und schreiben
Donnerstag: Psychologiebuch lesen (Zimbardo)
Freitag: Studium des Biologiebuches von Neil A. Campbell. Dies ist das Buch, welches Biologiestudenten für ihr Studium benötigen. Es umfasst 1600 Seiten und ist 2kg schwer! Ein äusserst interessantes Buch!
Im Oktober 2009 habe ich an der Akademie St. Gallen mit der 3jährigen Weiterbildung zum Betriebswirtschafter HF begonnen. So musste ich obigen Plan dahingehend ändern, dass die Schulfächer Vorrang haben. Der geänderte Plan sieht nun folgendermassen aus:
Montag: Betriebswirtschaftliches Modell (anhand des St. Galler Management-Modells)
Dienstag: Volkswirtschaftslehre
Mittwoch: Unternehmenslogistik
Donnerstag: Finanz- und Rechnungswesen
Freitag: Organisation
Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, halte ich mich weiterhin an den alten Plan.
Ich würde nie am Mittag für mich alleine kochen (ausser am Sonntag), da ich dies auch als reine Zeitverschwendung empfinde. Es ist nicht so, dass ich nicht kochen könnte, aber ich esse nicht gerne alleine. In einem Restaurant hat es immer viele Leute, da gibt’s immer was zu beobachten, manchmal treffe ich auch jemanden, den ich kenne. Deshalb esse ich jeden Mittag in einem anderen Restaurant: Am Montag gehe ich mit einem ehemaligen Schulkollegen essen, am Dienstag war ich bis jetzt am Mittagstisch der Pfarrei am Dom. Da es ihn nicht mehr gibt, gehe ich jetzt im ‚Gschwend’ essen, am Mittwoch im Rest. Schwarzen Adler, am Donnerstag bei meinen Eltern, am Freitag nehme ich mein Mittagessen im KBZ Kreuzbleiche ein, weil dort um 13 Uhr mein Weiterbildungskurs beginnt.
Am Nachmittag bin ich im B & I (Beratung und Information, gehört zum RAV) anzutreffen, wo ich mein E-Mail Konto leere und Bewerbungen schreibe. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch mit den einen oder anderen Personen dort. So sehen meine Tage aus, eigentlich nicht spektakulär. Mir ist wichtig, dass ich eine Struktur habe. Ich bemühe mich auch, abends zeitig schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Ich weiss ja nie, wann ich wieder eine Stelle habe. Da ist eine Tagesstruktur schon von Vorteil. Ich glaube nicht, dass ich ein typischer Arbeitsloser bin, denn ich kann mich sehr gut beschäftigen (siehe oben!) Physik, Chemie und Astronomie interessieren mich auch. Da ich mich nun weiterbilde, hat sich dieses Thema von selbst erledigt. Es gibt einen Spruch, der lautet: Wer arbeiten will, findet auch Arbeit. Ich finde diesen Spruch total daneben, denn ich will ja arbeiten und habe auch bereits mehr als 100 Bewerbungen geschrieben. Aber was soll ich machen, wenn man mich nicht arbeiten lässt?
Mit Hilfe des B& I habe ich einen Flyer kreiert (ich suche, ich biete), den ich meinen Kollegen und den Dozenten an der Akademie in St. Gallen gemailt oder per Post geschickt habe. Diesen Flyer werde ich an ausgewählte Firmen senden und anfangs März werde ich ein Stelleninserat veröffentlichen (so ich bis dann noch keine Stelle habe).
Eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch, aber es gibt Tage, da fühle ich mich so nutzlos, ich frage mich dann, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn hat. Zum Glück sind diese Phasen jeweils sehr kurz, eben: Ich bin ein Stehauf-männchen. Allerdings werde ich im Frühjahr 2010 ausgesteuert sein, sollte ich bis dann keine Stelle gefunden haben. Das macht mir langsam aber sicher Sorgen, da die Wirtschaftsprognosen noch nicht allzu rosig sind.
Trotzdem bin ich jede Woche motiviert, um neue Bewerbungen zu schreiben, es könnte ja sein, dass ich gerade dank dieser einen Bewerbung eine neue Stelle habe! Darum mein Rat an alle: Gebt niemals auf und macht das Beste aus jeder Situation!
Roger
Teer
Vor vierzehn Jahren hat sie ein Gedicht geschrieben, das für sie auch heute noch Gültigkeit besitzt. Es handelt vom Widerspruch der Moderne, die sich mit Teer immer neue Verkehrswege erschliesst, gleichzeitig aber die Wege zum Selbst verbaut. Lesen Sie das berührende Gedicht über den Befreiungskampf eines Strassenkindes.
Was wäre es schön,
könnte ich den schwarzen, zähflüssigen,
inzwischen verhärteten Teer,
der meine Haut, meine Seele –
dort, wo er sitzt – nicht atmen lässt,
einfach so abkratzen.
Man sagt, es sei normal,
allemal für Strassenkinder,
Teer an der Haut kleben zu haben.
Mit Teer würden die Strassen
des Lebens gepflastert,
die uns Menschen erst die Vielzahl
der Möglichkeiten eröffne,
neue Wege zu beschreiten.
Mich lähmt der Teer,
macht mir müde Glieder,
lässt mich nicht atmen.
In meine zarte Kinderhaut
brannte er tiefe Wunden.
Die Narben kann man
heute noch sehen.
Die Zeit heilt alle Wunden,
ha, ha, dass ich nicht lache!
Damals waren meine Fingernägel
noch zu weich und nicht lang genug,
um den verhassten Teer abzukratzen.
Dann wuchsen sie und
ich bekam bröckchenweise
den einen oder anderen Teerklumpen los.
Ich schien einzutauchen in die Leichtigkeit des Seins…
Strassenkind bleibt Strassenkind,
und so kamen,
die Haut begann zu atmen,
sich zu erneuern,
neue zähflüssige Teerschlacken hinzu.
Ich besuchte für ein Jahr eine Schamanin,
die mit viel Liebe und Spiritualität
meine verhärteten Teerklumpen,
die mich nicht atmen liessen,
mir die Freude der Leichtigkeit nahmen,
aufweichte und wegschwemmte.
Der Teer floss in den Boden
und floss bis zum Erdmittelpunkt.
Heute vermag ich es in zunehmendem Masse,
dem Teer auszuweichen,
auf dass er mich nicht mehr trifft.
Auch sind meine Fingernägel inzwischen
hart genug,
ich habe sie seit dem Besuch bei der Schamanin
auch nicht mehr geschnitten,
um neue Teerklumpen jederzeit
mit Geduld und Spucke
abkratzen zu können.
Hin und wieder,
die Zeiten mehren sich,
gelingt es mir sogar
frei zu atmen
und positive Energien
wahrzunehmen.
Silvia, geschrieben im Januar 1996
Was wäre es schön,
könnte ich den schwarzen, zähflüssigen,
inzwischen verhärteten Teer,
der meine Haut, meine Seele –
dort, wo er sitzt – nicht atmen lässt,
einfach so abkratzen.
Man sagt, es sei normal,
allemal für Strassenkinder,
Teer an der Haut kleben zu haben.
Mit Teer würden die Strassen
des Lebens gepflastert,
die uns Menschen erst die Vielzahl
der Möglichkeiten eröffne,
neue Wege zu beschreiten.
Mich lähmt der Teer,
macht mir müde Glieder,
lässt mich nicht atmen.
In meine zarte Kinderhaut
brannte er tiefe Wunden.
Die Narben kann man
heute noch sehen.
Die Zeit heilt alle Wunden,
ha, ha, dass ich nicht lache!
Damals waren meine Fingernägel
noch zu weich und nicht lang genug,
um den verhassten Teer abzukratzen.
Dann wuchsen sie und
ich bekam bröckchenweise
den einen oder anderen Teerklumpen los.
Ich schien einzutauchen in die Leichtigkeit des Seins…
Strassenkind bleibt Strassenkind,
und so kamen,
die Haut begann zu atmen,
sich zu erneuern,
neue zähflüssige Teerschlacken hinzu.
Ich besuchte für ein Jahr eine Schamanin,
die mit viel Liebe und Spiritualität
meine verhärteten Teerklumpen,
die mich nicht atmen liessen,
mir die Freude der Leichtigkeit nahmen,
aufweichte und wegschwemmte.
Der Teer floss in den Boden
und floss bis zum Erdmittelpunkt.
Heute vermag ich es in zunehmendem Masse,
dem Teer auszuweichen,
auf dass er mich nicht mehr trifft.
Auch sind meine Fingernägel inzwischen
hart genug,
ich habe sie seit dem Besuch bei der Schamanin
auch nicht mehr geschnitten,
um neue Teerklumpen jederzeit
mit Geduld und Spucke
abkratzen zu können.
Hin und wieder,
die Zeiten mehren sich,
gelingt es mir sogar
frei zu atmen
und positive Energien
wahrzunehmen.
Silvia, geschrieben im Januar 1996
Es geschah um Mitternacht
Er habe sich 20 Jahre lang im Kreis gedreht, erzählt der 41-jährige Mann, sei im Kantonsschulpark, in der Gassenküche oder auf der Gasse rumgehängt. Aber jetzt habe er sich entschlossen, einen Entzug im Tessin zu machen. Bevor er gehe, wolle er mir diese Geschichte geben, die er gestern aufgeschrieben habe.
Ich und eine Bekannte retteten einen Mischlingshund aus einer miserablen Haltung. Ich hatte gleich mehr Lebensfreude mit dem Hund. Ich ging wieder viel mehr aus dem Haus und ich erlebte schöne Stunden. Der Hund Sahra ist auch zu neuem Leben erwacht – bis zu jenem Tag, an dem ich vom Unglück verfolgt wurde. Als ich um Mitternacht noch schnell mit dem Hund Gassi ging, verfolgte Sahra einen Fuchs. Der Fuchs hatte Glück und kam vor dem Auto über die Strasse, aber mein neues Glück wurde vom Auto erfasst, der Autofahrer, der meines Hundes Leben hätte retten können, fuhr einfach weiter. Zuerst dachte ich, er habe Glück gehabt, es sei nichts Schlimmes passiert, denn als er zu mir kam, blutete er nicht schlimm, ein bisschen aus dem Maul. Aber als ich heimwärts ging, legte er sich plötzlich auf den Teer. Ich trug Sahra nach Hause. Sie trank ein bisschen Wasser und legte sich im Badezimmer auf den Badewannenteppich. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte um diese Zeit; gleich am Morgen wollte ich zum Tierarzt gehen. Ich schaute immer wieder nach meiner Liebsten, aber es sollte nicht sein. Sahra starb um ca. sieben Uhr.
Ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen und habe sie noch zwei Tage lang behalten, bis mein Kumpel, der auch einen Hund hat, mir sagte, man müsse sie in die Verbrennung bringen. Ich war sehr froh, als er dies übernahm und sie in diesen Container legte. Ich gab die Hoffnung nicht auf und sagte mir, jetzt ist sie im Hundehimmel.
Alfons
Ich und eine Bekannte retteten einen Mischlingshund aus einer miserablen Haltung. Ich hatte gleich mehr Lebensfreude mit dem Hund. Ich ging wieder viel mehr aus dem Haus und ich erlebte schöne Stunden. Der Hund Sahra ist auch zu neuem Leben erwacht – bis zu jenem Tag, an dem ich vom Unglück verfolgt wurde. Als ich um Mitternacht noch schnell mit dem Hund Gassi ging, verfolgte Sahra einen Fuchs. Der Fuchs hatte Glück und kam vor dem Auto über die Strasse, aber mein neues Glück wurde vom Auto erfasst, der Autofahrer, der meines Hundes Leben hätte retten können, fuhr einfach weiter. Zuerst dachte ich, er habe Glück gehabt, es sei nichts Schlimmes passiert, denn als er zu mir kam, blutete er nicht schlimm, ein bisschen aus dem Maul. Aber als ich heimwärts ging, legte er sich plötzlich auf den Teer. Ich trug Sahra nach Hause. Sie trank ein bisschen Wasser und legte sich im Badezimmer auf den Badewannenteppich. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte um diese Zeit; gleich am Morgen wollte ich zum Tierarzt gehen. Ich schaute immer wieder nach meiner Liebsten, aber es sollte nicht sein. Sahra starb um ca. sieben Uhr.
Ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen und habe sie noch zwei Tage lang behalten, bis mein Kumpel, der auch einen Hund hat, mir sagte, man müsse sie in die Verbrennung bringen. Ich war sehr froh, als er dies übernahm und sie in diesen Container legte. Ich gab die Hoffnung nicht auf und sagte mir, jetzt ist sie im Hundehimmel.
Alfons
Andere haben so wenig und ich so viel
Frau K., 59 Jahre alt, ist im St. Galler Rheintal in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Mit 17 Jahren begannen die gesundheitlichen Probleme. Sie fiel plötzlich in Ohnmacht und konnte sich danach an gar nichts mehr erinnern. Nach langwierigen Untersuchungen erhielt sie die Diagnose: Epilepsie. Dazu kamen Probleme mit den Muskeln. Frau K. spricht nicht gerne über ihre Krankheit.
Mit 19 Jahren reiste sie zu Ingenbohler Schwestern ins Tessin. Das hatte ihre Mutter so in die Wege geleitet. Frau K. lebte und arbeitete jahrelang in Klöstern und verschiedenen Einrichtungen. Ihr Gesicht beginnt zu strahlen, wenn sie von dieser Zeit erzählt. Im Tessin habe sie sich immer sehr wohl gefühlt, sagt sie. Vor 7 Jahren ist Frau K. in die Ostschweiz zurückgekehrt. Sie wohnt in einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung in St. Gallen und erhält eine IV- und EL-Rente. Sie hat wenig Erspartes auf ihrem Bankkonto. Vor einigen Wochen hat sie die Steuerrechnung und die Rechnung für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung erhalten. Mit ihrem knappen Einkommen hat sie Mühe diese Rechnungen zu begleichen. Sie hat daher nach einer Budgetberatung gefragt.
Aufgrund von Bankbelegen fällt auf, dass Frau K. regelmäßig von ihrem geringen Vermögen Geld abhebt und die Ersparnisse in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden. Frau K. lebt aber selber sehr bescheiden. Sie wohnt in einer günstigen Wohnung, fährt nie in die Ferien, geht nie auswärts essen, kauft günstige Stoffe ein, um ihre Kleider selber zu nähen … Sie erzählt: „Folgenden Luxus gönne ich mir: Ich gehe in die Gitarrenstunde und besuche einmal pro Jahr einen Nähkurs. Zudem unternehme ich etwa dreimal pro Jahr einen Tagesausflug nach Locarno, am liebsten im Frühling, wenn die Magnolien blühen!“
Im Gespräch sagt Frau K., sie hebe das Geld von ihrem Sparkonto ab, um Spenden zu tätigen.
„Ich habe so viel und andere haben so wenig. Das ist nicht recht. Die Kirchen in den kleineren Dörfern im Tessin haben das Geld dringend nötig für Restaurierungen. Da spende ich regelmäßig. Und dem Tierschutzverein und der Schweizerischen Vogelwarte gebe ich natürlich auch ein bisschen von meinem Ersparten. So wie wir mit den Viechern umgehen!
Zudem unterstütze ich die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft. Das ist mir ganz wichtig. Ich hatte da nämlich ein schlimmes Erlebnis als ich noch im Tessin lebte. Da wollte ein Priester, den ich gut kannte, im Lago Maggiore ein kleines Mädchen retten und dabei ist er ertrunken. Das war in der Nähe von Vira; da hat es ganz schlimme Strömungen!
Aber mit dem Spenden alleine ist es natürlich nicht getan. Ich bete gerne am Abend aus den Werken der Barmherzigkeit für die armen Seelen und für alle, die’s halt grad nötig haben. Ich beginne damit immer erst, wenn’s draußen schön ruhig geworden ist. Dieses Gebet dauert jeweils eine gute Stunde. Ich finde, länger brauche ich nicht zu beten, das wäre mir zu anstrengend. Eigentlich ist ja sowieso das ganze Leben ein Gebet.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Mit 19 Jahren reiste sie zu Ingenbohler Schwestern ins Tessin. Das hatte ihre Mutter so in die Wege geleitet. Frau K. lebte und arbeitete jahrelang in Klöstern und verschiedenen Einrichtungen. Ihr Gesicht beginnt zu strahlen, wenn sie von dieser Zeit erzählt. Im Tessin habe sie sich immer sehr wohl gefühlt, sagt sie. Vor 7 Jahren ist Frau K. in die Ostschweiz zurückgekehrt. Sie wohnt in einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung in St. Gallen und erhält eine IV- und EL-Rente. Sie hat wenig Erspartes auf ihrem Bankkonto. Vor einigen Wochen hat sie die Steuerrechnung und die Rechnung für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung erhalten. Mit ihrem knappen Einkommen hat sie Mühe diese Rechnungen zu begleichen. Sie hat daher nach einer Budgetberatung gefragt.
Aufgrund von Bankbelegen fällt auf, dass Frau K. regelmäßig von ihrem geringen Vermögen Geld abhebt und die Ersparnisse in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden. Frau K. lebt aber selber sehr bescheiden. Sie wohnt in einer günstigen Wohnung, fährt nie in die Ferien, geht nie auswärts essen, kauft günstige Stoffe ein, um ihre Kleider selber zu nähen … Sie erzählt: „Folgenden Luxus gönne ich mir: Ich gehe in die Gitarrenstunde und besuche einmal pro Jahr einen Nähkurs. Zudem unternehme ich etwa dreimal pro Jahr einen Tagesausflug nach Locarno, am liebsten im Frühling, wenn die Magnolien blühen!“
Im Gespräch sagt Frau K., sie hebe das Geld von ihrem Sparkonto ab, um Spenden zu tätigen.
„Ich habe so viel und andere haben so wenig. Das ist nicht recht. Die Kirchen in den kleineren Dörfern im Tessin haben das Geld dringend nötig für Restaurierungen. Da spende ich regelmäßig. Und dem Tierschutzverein und der Schweizerischen Vogelwarte gebe ich natürlich auch ein bisschen von meinem Ersparten. So wie wir mit den Viechern umgehen!
Zudem unterstütze ich die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft. Das ist mir ganz wichtig. Ich hatte da nämlich ein schlimmes Erlebnis als ich noch im Tessin lebte. Da wollte ein Priester, den ich gut kannte, im Lago Maggiore ein kleines Mädchen retten und dabei ist er ertrunken. Das war in der Nähe von Vira; da hat es ganz schlimme Strömungen!
Aber mit dem Spenden alleine ist es natürlich nicht getan. Ich bete gerne am Abend aus den Werken der Barmherzigkeit für die armen Seelen und für alle, die’s halt grad nötig haben. Ich beginne damit immer erst, wenn’s draußen schön ruhig geworden ist. Dieses Gebet dauert jeweils eine gute Stunde. Ich finde, länger brauche ich nicht zu beten, das wäre mir zu anstrengend. Eigentlich ist ja sowieso das ganze Leben ein Gebet.“
Brigitta Holenstein, Sozialarbeiterin
Als Schwarzer unter Weissen
Seit 20 Jahren lebt er in der Schweiz, aber die Hautfarbe ist ihm geblieben. Wie erlebt er die Spannung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Kulturen?
Ich erlebe nicht nur negative Reaktionen; es gibt Leute, die Freude daran haben, dass ich so gut Schweizerdeutsch spreche und mit Interesse nach meiner Geschichte fragen. Oft sind das Leute, die selber schon in Afrika oder Kenia in den Ferien waren und mir begeistert von ihrem Aufenthalt in meinem Land erzählen; das endet für mich zwar meistens ziemlich peinlich, weil diese Leute oft besser Bescheid wissen als ich.
Ich habe leider keinen Bezug mehr zu meinem Land Kenia, das letzte Mal war ich mit 9 Jahren in Kenia in den Ferien. Ich hätte als Kind die Gelegenheit gehabt, jeden Sommer nach Kenia in die Ferien zu gehen, aber das wollte ich nicht, weil ich mich als Kind mehr als Schweizer gefühlt habe als heute. Ich habe heute auch keinen Kontakt mehr zu meinen Landsleuten, weil ich kein Swahili mehr spreche. Eines Tages werde ich das vielleicht nachholen können.
Am liebsten würde ich mein Leben so gestalten, dass ich von Dezember bis März in Kenia überwintern und so der kalten Jahreszeit entfliehen könnte. Ich habe mich in all diesen Jahren leider nie an Schnee und Kälte gewöhnen können; ich bin halt ein Sonnenkind.
anonym
Ich erlebe nicht nur negative Reaktionen; es gibt Leute, die Freude daran haben, dass ich so gut Schweizerdeutsch spreche und mit Interesse nach meiner Geschichte fragen. Oft sind das Leute, die selber schon in Afrika oder Kenia in den Ferien waren und mir begeistert von ihrem Aufenthalt in meinem Land erzählen; das endet für mich zwar meistens ziemlich peinlich, weil diese Leute oft besser Bescheid wissen als ich.
Ich habe leider keinen Bezug mehr zu meinem Land Kenia, das letzte Mal war ich mit 9 Jahren in Kenia in den Ferien. Ich hätte als Kind die Gelegenheit gehabt, jeden Sommer nach Kenia in die Ferien zu gehen, aber das wollte ich nicht, weil ich mich als Kind mehr als Schweizer gefühlt habe als heute. Ich habe heute auch keinen Kontakt mehr zu meinen Landsleuten, weil ich kein Swahili mehr spreche. Eines Tages werde ich das vielleicht nachholen können.
Am liebsten würde ich mein Leben so gestalten, dass ich von Dezember bis März in Kenia überwintern und so der kalten Jahreszeit entfliehen könnte. Ich habe mich in all diesen Jahren leider nie an Schnee und Kälte gewöhnen können; ich bin halt ein Sonnenkind.
anonym
Die grosse Reise
Sie sei in Not, sagte sie am Telefon, aber sie könne nicht zu mir ins Büro kommen. Worum es denn ginge, fragte ich sie. Das könne sie am Telefon nicht sagen. Ich solle bei ihr vorbeikommen.
Säuerlicher Schweissgeruch beisst in die Nase. Geknüpfte Teppiche liegen am Boden, teilweise in zwei Lagen, und an der Wand hangen orthodoxe Heiligenbilder. Sie liegt im Bett wie ein gestrandeter Wal. Sie reicht mir ihre schweissfeuchte Hand, hält meine Hand fest, umfasst sie mit ihrer Linken. Sie schweigt und hält fest. Lange. Als ich meine Hand zurückziehen will, verstärkt sie ihren Druck, ich meinerseits auch und ziehe schliesslich die Hand aus ihrem schwabbelig-feuchten Griff.
„Ich habe Darmkrebs“, sagt sie und öffnet zum Beweis ihren Hosenbund. Unterhalb ihres Bauchnabels klebt ein Stoma.
„Wenn ich ihn lange nicht leere, platzt er. Deshalb konnte ich nicht zu Ihnen ins Büro kommen. Ich bin froh, dass Sie da sind … Bin ich gelb im Gesicht? Wissen Sie, immer, wenn es schlimmer wird mit dem Krebs, werde ich gelb.“
Bücher liegen auf ihrem Bett.
„Ich lese, um die Krankheit zu vergessen. Weg mit der Krankheit!“
Dann erzählt sie mir ihre Geschichte:
„Meine Mutter war Nonne. Mit 37 Jahren wurde sie schwanger. Das Kind war ich, geboren 1939 in der Nähe von Budapest. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, aber irgendwie haben sie sich trotzdem verstanden. Erst kam Hitler, dann kam Stalin. Stalin hat uns alles genommen, bis er endlich krepierte. Verstehen Sie, bis er endlich 1953 krepierte. Wir hatten wenig zu essen, 100 g Brot und einige Kartoffeln pro Tag und Person. Dann erhängte sich mein Vater, das war 1949. Ich heiratete einen Mann und zog mit ihm in die Schweiz. Ich arbeitete in Altersheimen und Restaurants. Dann starb mein Mann. Sein Bruder war alleine und ich war alleine. Also sagten die Verwandten: Warum heiratet ihr nicht? Und so heirateten wir. Aber er war gewalttätig. Wir schieden uns, er lebt jetzt in Ungarn, hat Kinder.
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Im Spital lag ich im selben Zimmer wie eine Italienerin, Giovanna, 39 Jahre alt. Sie hatte auch Darmkrebs, alles hatten sie ihr rausgenommen, aber ihr Bauch war dick, dick von Geschwülsten und Geschwüren. Wenn ich sterbe, werde ich dich beschützen, sagte sie. Das hat mir die Angst vor dem Tod genommen.
Bevor ich das Spital verliess, sagte sie zu mir, ich solle für sie beten, für ihre grosse, grosse Reise. Zwei Tage später, nachts um drei, erschien sie mir in weissem Gewand. Ich gehe auf die grosse, grosse Reise, sagte sie. Am Morgen rief mich ihr Mann an, sie sei gestorben, morgens um drei.“
Wir schweigen lange. Ich taste wie ein Blinder in einem Raum, in dem ich nur der Vergänglichkeit gewahr bin.
„Gehen Sie jetzt“, sagt sie.
Wie ich ihr die Hand zum Abschied reiche, zieht sie diese an ihr Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger auf ihre Wange.
„Pusserl.“
Ich küsse sie auf die schweissfeuchte, klebrige Wange, sie zieht mich mit beiden Händen zu sich herab und küsst mich. Lange hält sie mich fest. Langsam löse ich mich aus ihrer Umarmung. Sie strahlt mich an, immer noch meine Hand haltend. „Sie haben eine Schöne Seele! Ich sehe ihre Ausstrahlung, hellblau und rosa, hellblau und rosa.“
Im Fahrtwind auf dem Velo fühlen sich Gesicht und Wange klebrig an. Beim ersten Brunnen halte ich an und wasche mich. Eine schöne Seele? Hellblau und rosa, denke ich, sind die Farben des frühen Morgens.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Säuerlicher Schweissgeruch beisst in die Nase. Geknüpfte Teppiche liegen am Boden, teilweise in zwei Lagen, und an der Wand hangen orthodoxe Heiligenbilder. Sie liegt im Bett wie ein gestrandeter Wal. Sie reicht mir ihre schweissfeuchte Hand, hält meine Hand fest, umfasst sie mit ihrer Linken. Sie schweigt und hält fest. Lange. Als ich meine Hand zurückziehen will, verstärkt sie ihren Druck, ich meinerseits auch und ziehe schliesslich die Hand aus ihrem schwabbelig-feuchten Griff.
„Ich habe Darmkrebs“, sagt sie und öffnet zum Beweis ihren Hosenbund. Unterhalb ihres Bauchnabels klebt ein Stoma.
„Wenn ich ihn lange nicht leere, platzt er. Deshalb konnte ich nicht zu Ihnen ins Büro kommen. Ich bin froh, dass Sie da sind … Bin ich gelb im Gesicht? Wissen Sie, immer, wenn es schlimmer wird mit dem Krebs, werde ich gelb.“
Bücher liegen auf ihrem Bett.
„Ich lese, um die Krankheit zu vergessen. Weg mit der Krankheit!“
Dann erzählt sie mir ihre Geschichte:
„Meine Mutter war Nonne. Mit 37 Jahren wurde sie schwanger. Das Kind war ich, geboren 1939 in der Nähe von Budapest. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, aber irgendwie haben sie sich trotzdem verstanden. Erst kam Hitler, dann kam Stalin. Stalin hat uns alles genommen, bis er endlich krepierte. Verstehen Sie, bis er endlich 1953 krepierte. Wir hatten wenig zu essen, 100 g Brot und einige Kartoffeln pro Tag und Person. Dann erhängte sich mein Vater, das war 1949. Ich heiratete einen Mann und zog mit ihm in die Schweiz. Ich arbeitete in Altersheimen und Restaurants. Dann starb mein Mann. Sein Bruder war alleine und ich war alleine. Also sagten die Verwandten: Warum heiratet ihr nicht? Und so heirateten wir. Aber er war gewalttätig. Wir schieden uns, er lebt jetzt in Ungarn, hat Kinder.
Ich habe keine Angst vor dem Tod. Im Spital lag ich im selben Zimmer wie eine Italienerin, Giovanna, 39 Jahre alt. Sie hatte auch Darmkrebs, alles hatten sie ihr rausgenommen, aber ihr Bauch war dick, dick von Geschwülsten und Geschwüren. Wenn ich sterbe, werde ich dich beschützen, sagte sie. Das hat mir die Angst vor dem Tod genommen.
Bevor ich das Spital verliess, sagte sie zu mir, ich solle für sie beten, für ihre grosse, grosse Reise. Zwei Tage später, nachts um drei, erschien sie mir in weissem Gewand. Ich gehe auf die grosse, grosse Reise, sagte sie. Am Morgen rief mich ihr Mann an, sie sei gestorben, morgens um drei.“
Wir schweigen lange. Ich taste wie ein Blinder in einem Raum, in dem ich nur der Vergänglichkeit gewahr bin.
„Gehen Sie jetzt“, sagt sie.
Wie ich ihr die Hand zum Abschied reiche, zieht sie diese an ihr Gesicht und deutet mit dem Zeigefinger auf ihre Wange.
„Pusserl.“
Ich küsse sie auf die schweissfeuchte, klebrige Wange, sie zieht mich mit beiden Händen zu sich herab und küsst mich. Lange hält sie mich fest. Langsam löse ich mich aus ihrer Umarmung. Sie strahlt mich an, immer noch meine Hand haltend. „Sie haben eine Schöne Seele! Ich sehe ihre Ausstrahlung, hellblau und rosa, hellblau und rosa.“
Im Fahrtwind auf dem Velo fühlen sich Gesicht und Wange klebrig an. Beim ersten Brunnen halte ich an und wasche mich. Eine schöne Seele? Hellblau und rosa, denke ich, sind die Farben des frühen Morgens.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Perle im Atlantik
Eine Frau kommt mit der Hoffnung in die Schweiz, endlich das Land gefunden zu haben, wo Milch und Honig fliesst. Sie wird auf den harten Boden der Realität zurückgeholt.
Madeira! Kleine Dörfer, grosse Naturschutzgebiete, Wälder, Wasserfälle, grandiose Aussicht, überall üppiges Grün und Weite - hier sollten Sie wohnen!
In einem dieser kleinen Dörfer wohnt ein Mann mit seiner Frau. Sie bewirtschaften zusammen ein kleines Stück Land. Der Ertrag reicht gerade für sie und ihre zehn Kinder. In den Köpfen der Kinder wachsen Träume von einem anderen Land, von einem reichen Land. Eine der Töchter, volljährig, schon längst ein Mund zu viel am Esstisch, hört von einem Mann, der in der Schweiz in einem Monat so viel Geld verdient wie ihr Vater in einem Jahr. Ein Land, wo Milch und Honig fliesst. Dort will sie wohnen!
Sie reist ihm nach, sie heiratet ihn, sie bekommt ein Kind von ihm. Während sie als Hilfsköchin in einem Altersheim arbeitet, hütet ihre Freundin ihr Kind. Ihr Mann ist Bauarbeiter. Er kommt abends müde nach Hause, streckt vor dem Fernseher die Beine aus und lässt sich bedienen. Er riecht nach Staub und Teer, selten, wenn ihn die anderen Bauarbeiter dazu überredet haben, nach Bier.„Er wollte keine Frau“, erzählt sie, „er wollte jemanden, der für ihn kocht und die Wäsche macht. Wir waren ein explosives Gemisch, er, wenn er von der Arbeit nicht allzu müde war, heissblütig und reizbar, und ich stichelte stets, um mehr Nähe, mehr Geborgenheit zu bekommen.“Nach einigen Jahren kommt es zur Scheidung. Wo soll sie wohnen?
Sie zieht mit ihrem Kind in eine eigene Wohnung. Der Umzug kostet Geld, mehr als sie in einem Monat verdient, mehr als ihr Vater in einem halben Jahr verdient. Rechnungen flattern herein, die sie nicht bezahlen kann. Sie meldet sich beim Sozialdienst.
Wir ordnen gemeinsam die Rechnungen, setzen Prioritäten. Wir stellen ein Budget auf, es ist knapp, aber dank einer Überbrückungshilfe weiss sie, dass sie aus dem finanziellen Loch herauskommen wird. Das andere Loch bleibt: die Sehnsucht nach Nähe, nach Geborgenheit.
Ich frage sie, was ihr grösster Traum sei: Sie wolle Geld sparen und wieder zurück nach Madeira. Dort wolle sie leben.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Madeira! Kleine Dörfer, grosse Naturschutzgebiete, Wälder, Wasserfälle, grandiose Aussicht, überall üppiges Grün und Weite - hier sollten Sie wohnen!
In einem dieser kleinen Dörfer wohnt ein Mann mit seiner Frau. Sie bewirtschaften zusammen ein kleines Stück Land. Der Ertrag reicht gerade für sie und ihre zehn Kinder. In den Köpfen der Kinder wachsen Träume von einem anderen Land, von einem reichen Land. Eine der Töchter, volljährig, schon längst ein Mund zu viel am Esstisch, hört von einem Mann, der in der Schweiz in einem Monat so viel Geld verdient wie ihr Vater in einem Jahr. Ein Land, wo Milch und Honig fliesst. Dort will sie wohnen!
Sie reist ihm nach, sie heiratet ihn, sie bekommt ein Kind von ihm. Während sie als Hilfsköchin in einem Altersheim arbeitet, hütet ihre Freundin ihr Kind. Ihr Mann ist Bauarbeiter. Er kommt abends müde nach Hause, streckt vor dem Fernseher die Beine aus und lässt sich bedienen. Er riecht nach Staub und Teer, selten, wenn ihn die anderen Bauarbeiter dazu überredet haben, nach Bier.„Er wollte keine Frau“, erzählt sie, „er wollte jemanden, der für ihn kocht und die Wäsche macht. Wir waren ein explosives Gemisch, er, wenn er von der Arbeit nicht allzu müde war, heissblütig und reizbar, und ich stichelte stets, um mehr Nähe, mehr Geborgenheit zu bekommen.“Nach einigen Jahren kommt es zur Scheidung. Wo soll sie wohnen?
Sie zieht mit ihrem Kind in eine eigene Wohnung. Der Umzug kostet Geld, mehr als sie in einem Monat verdient, mehr als ihr Vater in einem halben Jahr verdient. Rechnungen flattern herein, die sie nicht bezahlen kann. Sie meldet sich beim Sozialdienst.
Wir ordnen gemeinsam die Rechnungen, setzen Prioritäten. Wir stellen ein Budget auf, es ist knapp, aber dank einer Überbrückungshilfe weiss sie, dass sie aus dem finanziellen Loch herauskommen wird. Das andere Loch bleibt: die Sehnsucht nach Nähe, nach Geborgenheit.
Ich frage sie, was ihr grösster Traum sei: Sie wolle Geld sparen und wieder zurück nach Madeira. Dort wolle sie leben.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Maximalpigmentiert
Folgende Schilderungen eines Klienten zeigen, wie ein Kenianer sein Anderssein in der Schweiz erlebt:
„Es ist nicht immer einfach, in meiner Haut zu stecken. Ich kam als Dreijähriger von Kenia in die Schweiz. Seitdem habe ich alles erfüllt, was von mir verlangt wurde. Dies war nicht immer leicht, weil ich der erste und der einzige maximalpigmentierte Junge im Kindergarten und in der Schule war. Für mich war es „normal“, dass alle um mich herum minimalpigmentiert waren. Probleme gab es nur dann, wenn ich als Negerli oder ähnlich betitelt wurde, was jedoch zum Glück nicht sehr oft vorkam. In der Schule und im Kindergarten galt ich lange Zeit als der Stärkste. Öfters musste ich in der Schule nachsitzen und es gab überdurchschnittlich viele Gespräche mit den Lehrern, bei denen auch mein Vater anwesend sein musste. Eigentlich war ich aber ein ruhiges und beliebtes Kind und ohne Grund ging ich nie auf Mitschüler los! In der Oberstufe wurde ich dann noch ruhiger, und ich merkte, dass ich mit Ignorieren und einem müden Lächeln viel weiter komme. Die beste Schulzeit erlebte ich in der Berufsschule – diese lief problemlos. Doch seit ich erwachsen bin, sieht alles wieder anders aus. Ich bin nicht mehr das „härzige Negerli“, sondern einfach ein schwarzer Mann.
Mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen – sollen die Leute doch denken, ich sei ein Asylbewerber, ein Drogendealer oder was auch immer! Manchmal kommt auch der kleine Isaac in mir wieder zum Vorschein, doch nur noch auf verbaler Ebene. Ich geniesse die Situationen sehr, in denen ich Leuten, die in Hörweite über mich gesprochen haben, in akzentfreiem Schweizerdeutsch sagen kann, dass ich jedes Wort einwandfrei verstanden habe und amüsiere mich, in die erschrockenen Gesichter zu blicken ..."
anonym
„Es ist nicht immer einfach, in meiner Haut zu stecken. Ich kam als Dreijähriger von Kenia in die Schweiz. Seitdem habe ich alles erfüllt, was von mir verlangt wurde. Dies war nicht immer leicht, weil ich der erste und der einzige maximalpigmentierte Junge im Kindergarten und in der Schule war. Für mich war es „normal“, dass alle um mich herum minimalpigmentiert waren. Probleme gab es nur dann, wenn ich als Negerli oder ähnlich betitelt wurde, was jedoch zum Glück nicht sehr oft vorkam. In der Schule und im Kindergarten galt ich lange Zeit als der Stärkste. Öfters musste ich in der Schule nachsitzen und es gab überdurchschnittlich viele Gespräche mit den Lehrern, bei denen auch mein Vater anwesend sein musste. Eigentlich war ich aber ein ruhiges und beliebtes Kind und ohne Grund ging ich nie auf Mitschüler los! In der Oberstufe wurde ich dann noch ruhiger, und ich merkte, dass ich mit Ignorieren und einem müden Lächeln viel weiter komme. Die beste Schulzeit erlebte ich in der Berufsschule – diese lief problemlos. Doch seit ich erwachsen bin, sieht alles wieder anders aus. Ich bin nicht mehr das „härzige Negerli“, sondern einfach ein schwarzer Mann.
Mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen – sollen die Leute doch denken, ich sei ein Asylbewerber, ein Drogendealer oder was auch immer! Manchmal kommt auch der kleine Isaac in mir wieder zum Vorschein, doch nur noch auf verbaler Ebene. Ich geniesse die Situationen sehr, in denen ich Leuten, die in Hörweite über mich gesprochen haben, in akzentfreiem Schweizerdeutsch sagen kann, dass ich jedes Wort einwandfrei verstanden habe und amüsiere mich, in die erschrockenen Gesichter zu blicken ..."
anonym
Zwischen den Schmerzen
Manchmal streifen einen Schicksale – in wenigen Sätzen nur – die erahnen lassen, wie viel Leid dahinter verborgen liegt. Kürzlich kam eine Frau, die in Polen aufgewachsen war, zu mir in die Beratung.
„Sie sind in Polen geboren“, sage ich und fahre fort, „mein Bruder hat kürzlich eine Radtour den masurischen Seen entlang gemacht. Er ist begeistert gewesen.“
Natürlich. In die Ressourcen kommen. Einen gemeinsamen „Raum“ schaffen. Wir.
Sie komme nicht von dort, sondern sei in der Nähe der russischen Grenze aufgewachsen. Ihre Mutter sei 1935 geboren. Sie sei noch ein kleines Kind gewesen, als ihre Familie zuerst von den Deutschen und dann von den Russen vertrieben worden seien. Ihr Grossvater habe in einer Fabrik gearbeitet, in der sie Bomben herstellten. An einem Morgen seien anstatt zwanzig Arbeiter nur drei gekommen. Die anderen seien niedergemacht worden.
Ihre Mutter habe früh geheiratet und fünf Kinder bekommen. Als das jüngste dreijährig war, verlor sie ihren Mann. Sie brachte die Kinder alleine durch. Sie habe viel gearbeitet, immer gearbeitet. Jetzt sei sie krank. Sie habe immer etwas, mal hier, mal dort.
„Wenn ich sie nächste Woche besuche, wird sie nur ganz kurz Freude haben. Ganz kurz nur zwischen den Schmerzen“, sagt sie.
Wir. Ein anderes Wir, als ich erschaffen wollte. Nicht aus dem Tourismus-Bereich, nicht aus der Schönheit von Landschaften. Sondern aus Mitgefühl.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
„Sie sind in Polen geboren“, sage ich und fahre fort, „mein Bruder hat kürzlich eine Radtour den masurischen Seen entlang gemacht. Er ist begeistert gewesen.“
Natürlich. In die Ressourcen kommen. Einen gemeinsamen „Raum“ schaffen. Wir.
Sie komme nicht von dort, sondern sei in der Nähe der russischen Grenze aufgewachsen. Ihre Mutter sei 1935 geboren. Sie sei noch ein kleines Kind gewesen, als ihre Familie zuerst von den Deutschen und dann von den Russen vertrieben worden seien. Ihr Grossvater habe in einer Fabrik gearbeitet, in der sie Bomben herstellten. An einem Morgen seien anstatt zwanzig Arbeiter nur drei gekommen. Die anderen seien niedergemacht worden.
Ihre Mutter habe früh geheiratet und fünf Kinder bekommen. Als das jüngste dreijährig war, verlor sie ihren Mann. Sie brachte die Kinder alleine durch. Sie habe viel gearbeitet, immer gearbeitet. Jetzt sei sie krank. Sie habe immer etwas, mal hier, mal dort.
„Wenn ich sie nächste Woche besuche, wird sie nur ganz kurz Freude haben. Ganz kurz nur zwischen den Schmerzen“, sagt sie.
Wir. Ein anderes Wir, als ich erschaffen wollte. Nicht aus dem Tourismus-Bereich, nicht aus der Schönheit von Landschaften. Sondern aus Mitgefühl.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Einmal Hölle und Zurück
Angefangen hat alles damit, dass ein alter Kumpel ein paar Tage bei mir gewohnt hat. Mittlerweile war er Heroin-Dealer geworden, um seinen täglichen Konsum zu finanzieren. Als ich eines Tages wiedermal nichts zu „kiffen“ hatte und nicht schlafen konnte, entschloss ich mich, es einmal zu probieren.
Im Nachhinein frage ich mich ständig, wie es soweit kommen konnte, und was ich mir dabei überlegt habe. Ich war immer gegen Heroin und mochte Leute nicht, die süchtig waren. Jetzt weiss ich: auch ich bin nur ein Mensch, und nicht immun gegen Verlockungen des Lebens. Ja, genau, auch ich – der heroinverachtende Nigthstalker weiss jetzt, wie es ist, süchtig zu sein und jeden Tag dem Stoff hinterherzurennen.
Angefangen hat alles damit, dass ein alter Kumpel ein paar Tage bei mir gewohnt hat. Mittlerweile war er Heroin-Dealer geworden, um seinen täglichen Konsum zu finanzieren. Als ich eines Tages wiedermal nichts zu „kiffen“ hatte und nicht schlafen konnte, entschloss ich mich, es einmal zu probieren.
Ich schlief wie ein Baby. Fest entschlossen nicht süchtig zu werden, konsumierte ich jeden Abend nur ein bisschen, um schlafen zu können. Doch schon bald kiffte ich nicht mehr, sondern kaufte nur noch jeden Tag Heroin. Endlich war ich nicht mehr kiff-süchtig, dafür war ich nun jeden Tag auf der Gasse und kaufte Heroin.
Ich verlor meine Freundin, meine Freunde und meine Selbstachtung. Ich fing an zu klauen, betteln und bescheissen, nur, um Stoff kaufen zu können. Mein Leben war am Ende. Dann folgten drei Entzüge und später zwei Rückfälle.
Jetzt bin ich clean, doch kiffe wieder. Ich habe mich eineinhalb Jahre im Kreis gedreht und bin jetzt wieder am Anfang. Ich weiss jetzt, dass man nicht alles mal ausprobieren sollte, und niemand immun gegen Verlockungen ist. Ich habe wieder eine Freundin, die ich liebe und die mir Kraft gibt und mich vor einem erneuten Absturz bewahrt. Ich liebe sie, mein Gras und meinen Hund und möchte nie mehr in diese Hölle zurück.
Ich hoffe, Sie konnten was lernen.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Im Nachhinein frage ich mich ständig, wie es soweit kommen konnte, und was ich mir dabei überlegt habe. Ich war immer gegen Heroin und mochte Leute nicht, die süchtig waren. Jetzt weiss ich: auch ich bin nur ein Mensch, und nicht immun gegen Verlockungen des Lebens. Ja, genau, auch ich – der heroinverachtende Nigthstalker weiss jetzt, wie es ist, süchtig zu sein und jeden Tag dem Stoff hinterherzurennen.
Angefangen hat alles damit, dass ein alter Kumpel ein paar Tage bei mir gewohnt hat. Mittlerweile war er Heroin-Dealer geworden, um seinen täglichen Konsum zu finanzieren. Als ich eines Tages wiedermal nichts zu „kiffen“ hatte und nicht schlafen konnte, entschloss ich mich, es einmal zu probieren.
Ich schlief wie ein Baby. Fest entschlossen nicht süchtig zu werden, konsumierte ich jeden Abend nur ein bisschen, um schlafen zu können. Doch schon bald kiffte ich nicht mehr, sondern kaufte nur noch jeden Tag Heroin. Endlich war ich nicht mehr kiff-süchtig, dafür war ich nun jeden Tag auf der Gasse und kaufte Heroin.
Ich verlor meine Freundin, meine Freunde und meine Selbstachtung. Ich fing an zu klauen, betteln und bescheissen, nur, um Stoff kaufen zu können. Mein Leben war am Ende. Dann folgten drei Entzüge und später zwei Rückfälle.
Jetzt bin ich clean, doch kiffe wieder. Ich habe mich eineinhalb Jahre im Kreis gedreht und bin jetzt wieder am Anfang. Ich weiss jetzt, dass man nicht alles mal ausprobieren sollte, und niemand immun gegen Verlockungen ist. Ich habe wieder eine Freundin, die ich liebe und die mir Kraft gibt und mich vor einem erneuten Absturz bewahrt. Ich liebe sie, mein Gras und meinen Hund und möchte nie mehr in diese Hölle zurück.
Ich hoffe, Sie konnten was lernen.
Herzlichst
Ihr Nightstalker
Kaffeestube an Weihnachten
Jeder Mensch ist Mit-Autor des einen Buches. Wenn ein Mensch stirbt, wird nicht ein Kapitel aus dem Buch herausgerissen, sondern in eine tiefgründigere Sprache übersetzt. Und jedes einzelne Kapitel muss übersetzt werden. Dies schrieb John Donne im 17. Jahrhundert. Die Bedeutung seiner Worte sind mir an Weihnachten in der Kaffeestube wieder bewusst geworden: Jeder Mensch mit seiner Geschichte, die nicht verloren geht, sondern stets neu übersetzt werden muss.
Auf den gerillten Biberschwanzziegeln des Daches, Eiskristalle
wie winzige Menhire, die jemand über Nacht dorthin gesetzt hat;
im schmalen Sonnenstreifen funkeln sie für wenige Minuten lang.
Ob sie mir eine Karte schreiben dürfe, fragte sie mit leuchtenden Augen aus einem mit Sommersprossen übersäten Gesicht.
„Selbstverständlich“, sagte ich und schrieb meine Adresse in der mir schönst möglichen Schrift, in weiten und gerundeten Bögen.
Seit zwei Jahren wohne sie wieder bei ihren Eltern. Das Wohnheim, in dem sie gelebte habe, sei geschlossen worden.
„Ich habe die Menschen dort richtig lieb gewonnen. Ich wäre vor lauter Trauer am liebsten im Boden versunken, als ich gehen musste.“
Plötzlich spürte ich ihre Trauer.
In den Boden versinken.
Wo es dunkel ist.
Gleichzeitig erahnte ich, welche Bedeutung es für sie haben könnte, jemandem, der das Leuchten in ihren Augen wahrgenommen hat, eine Karte zu schreiben.
„Sie müssen aber Geduld haben“, sagte sie mit mädchenhaftem Lächeln, „bis Sie eine Karte erhalten.“
Auf dem Dachgestänge, welches den Schnee am Rutschen hindert,
ein Eiskristall, das hell funkelt, im Gang er Sonne aber übergangslos
die Grundfarben durchspielt und nach wenigen Minuten verglimmt.
Er habe im Dom Weihwasser geholt und dabei das Plakat mit der offenen Kaffeestube entdeckt. Da sei er schnell reingekommen.
„Seit meine Frau vor sechs Jahren gegangen ist ...“
„Ist sie gestorben?“
„Nein.“
Er lächelte ironisch und fügte hinzu: „Sie wollte sich selbst verwirklichen ... Hätte die Gebenedeite Mutter Maria je ihre Familie verlassen, um sich selbst zu verwirklichen? Wo doch die Verwirklichung im Kind selbst liegt“, empörte er sich.
Inzwischen verstünden sie sich gut, morgen feierten sie Weihnachten gemeinsam mit den Kindern.
Es blieb lange Zeit still. Um die Beklemmung zu durchbrechen, fragte ich ihn, was er denn sonst im Leben mache.
„Ich bin pensioniert.“
„Tatsächlich? Sie sehen aber sehr rüstig aus für einen pensionierten Mann!“
„Wissen Sie, man sieht nur von aussen heran, aber nicht hinein.“
Vor sechs Jahren, ja, es sei Monate nach der Trennung gewesen, habe er sich plötzlich so komisch gefühlt, irgendwie sei ihm übel gewesen. Er habe sich ins Bett gelegt und im Magen einen Klumpen gespürt, als habe er Fondue gegessen und danach kaltes Wasser getrunken. Am nächsten Morgen habe er den Arzt angerufen, der habe ihn von der Arztpraxis direkt in den Notfall bringen lassen. Es sei ein Herzinfarkt gewesen und er habe noch am gleichen Tag einen Bypass erhalten.
„Vor drei Jahren musste ich mich wieder operieren lassen: Raucherbein, eine typische Diabetikerkrankheit. Sie mussten mir eine künstliche Arterie einsetzen. Im Neuen Jahr muss ich wieder in den Spital. Vielleicht müssen sie mir einen Herzschrittmacher einsetzen ... Da rauchst du nicht, da trinkst du nicht, du frisst auch nicht unter dem Haag durch – und jetzt das.“
Die Einsamkeit, nachts, von Glockenschlag zu Glockenschlag, Angst vor dem Klumpen im Magen, Angst, das Bein könnte abfaulen, Angst, das Herz könnte plötzlich stillstehen.Die Strassenlampen löschen, der Schatten des Fensterkreuzes an der Decke ist verschwunden, diffuses Licht bleibt im Sonnenvorhang hängen.
Angst vor dem Verglimmen ohne dass jemand das Licht, das Spektrum des eigenen Lichts, überhaupt wahrgenommen hätte.
„Irgendwann bin ich trotzdem eingeschlafen. Ich weiss nicht, wie lange ich liegen geblieben bin. Was sollte ich, am Weihnachtstag, alleine? Schliesslich bin ich trotzdem aufgestanden, wollte mich mit geweihtem Wasser bekreuzigen – aber das Weihwassergefäss mit der heiligen Mutter Gottes war leer.“
Wenn du nachts durch die Stadt gehst, leuchten sie vom Teer,
die Eiskristalle, als gingest du über einen Sternenhimmel,
dessen Sternenbilder mit jedem Schritt sich verwandeln.
Wegen ihrer fortgeschrittenen Polyarthritis kann sie die Stöcke nicht mehr halten; sie braucht horizontal geführte Unterarmstützen, die sie mit einem Klettverschluss befestigt. Wenn es sehr kalt ist, kann sie ihre Haustüre nicht öffnen, dann muss sie warten ...
„ ... bis ein Gentleman mir die Türe öffnet -
Sagen Sie, bin ich unfreundlich? Kürzlich im Bus hat mich eine angeschnauzt, ich könne sie auch in einem anständigen Ton fragen. Ich stand im Gang zwischen den Sitzreihen und wusste, der Bus fährt gleich ab. Da wandte ich mich an die erstbeste Frau, die ich sitzen sah – mag sein, dass es ein wenig barsch klang, unfreundlich sogar, aber ich hatte doch Angst, ich falle hin, wenn der Bus losfährt, und purzle durch den Gang.“
Vor der Haustüre warten, bis jemand die Türe öffnet, im Bus warten, bis jemand aufsteht, morgens warten, bis die Pflegefachfrau von der Spitex kommt. Immer einen freundlichen Ton finden. Immer stark bleiben im Hilfe erbitten. Immer sich bedanken. Und an Weihnachten in einer Kaffeestube alleine an einem Tisch sitzen.
„Sagen Sie, bin ich unfreundlich?“
Sie überziehen die Ziegel mit hauchdünner weisser Schicht,
die Eiskristalle, an anderen Stellen des Dachs wachsen
sie zu Splittern empor: Welcher Luftströmungen wegen?
Mit leicht vorgebeugtem Oberkörper und einer dicken Glasbrille auf der Nase, die in er Wärme anlief, betrat er die Kaffeestube. Erst jetzt bemerkte ich seinen Rucksack und den Mann hinter ihm, der älter war und zur Begrüssung nur kurz Augenkontakt mit mir aufnahm, um gleich wieder auf den Boden zu schauen.
Ob sie hier übernachten könnten, fragte der Mann mit der Brille in gebrochenem Englisch. Er putzte seine Brille und setzte sie wieder auf.
Wir seien eine Kaffeestube, antwortete ich, aber sie sollten doch hereinkommen, einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen.
„Ich komme Ungarn“, erzählte er. „Ungarn schlecht. Ich Automechaniker, verdiene zweihundert bis zweihundertfünfzig Euro im Monat. Wenig, sehr wenig. Ich gespart, nach Portugal gefahren, Arbeit suchen, Spanien, Frankreich, Schweiz, aber keine Arbeit finden. Ich überall zuhause, aber ohne Arbeit?“
Sie hätten nur noch wenig Geld, ein Hotel in St. Gallen sei viel zu teuer. Gestern seien sie in der Weihnachtsmesse gewesen, das sei schön gewesen, sie hätten zwar kein Wort verstanden aber die Lichter und Wärme hätten ihnen wohl getan. Sie seien wohl die einzigen im Dom gewesen, die gespürt hätten, wie warm die anderen Menschen geben. Danach seien sie durch die Stadt geirrt, hätten einen warmen Platz gesucht, ja, wenn sie nur ein bisschen von dem Stroh gehabt hätten, das für die Krippen in den Schaufenstern verwendet wird. Im Bahnhof hätten sie sich auf eine Bank gelegt, seien dann aber von dort wieder vertrieben worden.Der ältere Mann sagte kein Wort, schaute nur auf den Teller, der inzwischen leer war.Sie seien sich unterwegs begegnet, er komme auch aus Ungarn, spreche aber kein Wort Englisch oder Deutsch. Er sei Lastwagenfahrer, suche auch Arbeit.
„Ich überall zuhause. Mutter mag mich nicht, Vater kenne ich nicht. Meine Grossmutter habe ich vor zehn Tagen besucht, und wieder losgereist, über Wien. Jede Haltestelle ausgestiegen, weil Kondukteur mich erwischt. Ich kein Geld für Billett. Und jetzt hier.“
In der Herberge zur Heimat war noch ein Zimmer frei für zwei Personen. Sie bedankten sich herzlich, der ältere Mann mit Kopfnicken, und verabschiedeten sich nach dem zweiten Stück Kuchen. Sie seien müde, sie wollten sich jetzt nur hinlegen und schlafen.
Bei stabiler Hochdrucklage sind die Temperaturen leicht angestiegen,
die Eiskristalle verschwunden, aber zwischen Grasbüscheln liegen sie zusammengeklumpt, Grashalme mit dünner Eisschicht umschliessend
Mit neun sei sie bei einem Wettrennen von der Kletterstange gefallen, sie hätte tot sein können. Stattdessen sei sie im Rollstuhl gelandet, habe alles wieder lernen müssen: aufstehen, sich anziehen, gehen, einfach alles. Die Ärzte hätten ihr ein Jahr vorausgesagt, sie habe es in einem halben geschafft. Mit sechzehn habe sie auf einem Bauernhof gearbeitet, mit Metzgerei und Restaurant. Mit zwanzig habe sie geheiratet. Ihr Mann habe eine kleine Firma gehabt, viel mehr als eine Werkbank sei es nicht gewesen; er habe Teile gedreht für grössere Firmen. Sie habe fünf Kinder grossgezogen, gekocht, gewaschen und ihrem Mann in der Firma geholfen, Lieferscheine geschrieben und später die Büros geputzt. Als dank dafür habe er sich eine andere angelacht. Der Jüngste sei zwanzig gewesen, als sie sich habe scheiden lassen. Mit dem zweiten Mann habe sie nicht viel mehr Glück gehabt. Er sei zwar ein netter gewesen und sie hätten ganz schön was zusammengespart, aber nach drei Jahren Ehe sei ausgekommen, dass er in seinem Herkunftsland bereits eine Familie habe. Vor einem Jahr sei er in sein Land gereist, als ob er gespürt hätte, dass er bald sterben würde. Er habe einen Herzstillstand gehabt, sei plötzlich tot umgefallen. Ihr gehe es zwar gut, aber eben, mit dem Alter liessen die Kräfte nach und die verschiedenen Operationen seien auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
„Aber Morgen“, sagte sie lächelnd, „morgen bin ich bei meinem jüngsten Sohn eingeladen. Er kocht besser als seine Frau. Ich habe eben bei der Erziehung darauf geachtet, dass sie putzen, waschen und kochen können.“
Jeder Augenblick ist von dem einen Autor des einen Buches.
Wenn der Augenblick vergangen ist, ist er nicht ausgelöscht.
Er setzt über den Strom des Vergehens, indem er neu sich übersetzt.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Auf den gerillten Biberschwanzziegeln des Daches, Eiskristalle
wie winzige Menhire, die jemand über Nacht dorthin gesetzt hat;
im schmalen Sonnenstreifen funkeln sie für wenige Minuten lang.
Ob sie mir eine Karte schreiben dürfe, fragte sie mit leuchtenden Augen aus einem mit Sommersprossen übersäten Gesicht.
„Selbstverständlich“, sagte ich und schrieb meine Adresse in der mir schönst möglichen Schrift, in weiten und gerundeten Bögen.
Seit zwei Jahren wohne sie wieder bei ihren Eltern. Das Wohnheim, in dem sie gelebte habe, sei geschlossen worden.
„Ich habe die Menschen dort richtig lieb gewonnen. Ich wäre vor lauter Trauer am liebsten im Boden versunken, als ich gehen musste.“
Plötzlich spürte ich ihre Trauer.
In den Boden versinken.
Wo es dunkel ist.
Gleichzeitig erahnte ich, welche Bedeutung es für sie haben könnte, jemandem, der das Leuchten in ihren Augen wahrgenommen hat, eine Karte zu schreiben.
„Sie müssen aber Geduld haben“, sagte sie mit mädchenhaftem Lächeln, „bis Sie eine Karte erhalten.“
Auf dem Dachgestänge, welches den Schnee am Rutschen hindert,
ein Eiskristall, das hell funkelt, im Gang er Sonne aber übergangslos
die Grundfarben durchspielt und nach wenigen Minuten verglimmt.
Er habe im Dom Weihwasser geholt und dabei das Plakat mit der offenen Kaffeestube entdeckt. Da sei er schnell reingekommen.
„Seit meine Frau vor sechs Jahren gegangen ist ...“
„Ist sie gestorben?“
„Nein.“
Er lächelte ironisch und fügte hinzu: „Sie wollte sich selbst verwirklichen ... Hätte die Gebenedeite Mutter Maria je ihre Familie verlassen, um sich selbst zu verwirklichen? Wo doch die Verwirklichung im Kind selbst liegt“, empörte er sich.
Inzwischen verstünden sie sich gut, morgen feierten sie Weihnachten gemeinsam mit den Kindern.
Es blieb lange Zeit still. Um die Beklemmung zu durchbrechen, fragte ich ihn, was er denn sonst im Leben mache.
„Ich bin pensioniert.“
„Tatsächlich? Sie sehen aber sehr rüstig aus für einen pensionierten Mann!“
„Wissen Sie, man sieht nur von aussen heran, aber nicht hinein.“
Vor sechs Jahren, ja, es sei Monate nach der Trennung gewesen, habe er sich plötzlich so komisch gefühlt, irgendwie sei ihm übel gewesen. Er habe sich ins Bett gelegt und im Magen einen Klumpen gespürt, als habe er Fondue gegessen und danach kaltes Wasser getrunken. Am nächsten Morgen habe er den Arzt angerufen, der habe ihn von der Arztpraxis direkt in den Notfall bringen lassen. Es sei ein Herzinfarkt gewesen und er habe noch am gleichen Tag einen Bypass erhalten.
„Vor drei Jahren musste ich mich wieder operieren lassen: Raucherbein, eine typische Diabetikerkrankheit. Sie mussten mir eine künstliche Arterie einsetzen. Im Neuen Jahr muss ich wieder in den Spital. Vielleicht müssen sie mir einen Herzschrittmacher einsetzen ... Da rauchst du nicht, da trinkst du nicht, du frisst auch nicht unter dem Haag durch – und jetzt das.“
Die Einsamkeit, nachts, von Glockenschlag zu Glockenschlag, Angst vor dem Klumpen im Magen, Angst, das Bein könnte abfaulen, Angst, das Herz könnte plötzlich stillstehen.Die Strassenlampen löschen, der Schatten des Fensterkreuzes an der Decke ist verschwunden, diffuses Licht bleibt im Sonnenvorhang hängen.
Angst vor dem Verglimmen ohne dass jemand das Licht, das Spektrum des eigenen Lichts, überhaupt wahrgenommen hätte.
„Irgendwann bin ich trotzdem eingeschlafen. Ich weiss nicht, wie lange ich liegen geblieben bin. Was sollte ich, am Weihnachtstag, alleine? Schliesslich bin ich trotzdem aufgestanden, wollte mich mit geweihtem Wasser bekreuzigen – aber das Weihwassergefäss mit der heiligen Mutter Gottes war leer.“
Wenn du nachts durch die Stadt gehst, leuchten sie vom Teer,
die Eiskristalle, als gingest du über einen Sternenhimmel,
dessen Sternenbilder mit jedem Schritt sich verwandeln.
Wegen ihrer fortgeschrittenen Polyarthritis kann sie die Stöcke nicht mehr halten; sie braucht horizontal geführte Unterarmstützen, die sie mit einem Klettverschluss befestigt. Wenn es sehr kalt ist, kann sie ihre Haustüre nicht öffnen, dann muss sie warten ...
„ ... bis ein Gentleman mir die Türe öffnet -
Sagen Sie, bin ich unfreundlich? Kürzlich im Bus hat mich eine angeschnauzt, ich könne sie auch in einem anständigen Ton fragen. Ich stand im Gang zwischen den Sitzreihen und wusste, der Bus fährt gleich ab. Da wandte ich mich an die erstbeste Frau, die ich sitzen sah – mag sein, dass es ein wenig barsch klang, unfreundlich sogar, aber ich hatte doch Angst, ich falle hin, wenn der Bus losfährt, und purzle durch den Gang.“
Vor der Haustüre warten, bis jemand die Türe öffnet, im Bus warten, bis jemand aufsteht, morgens warten, bis die Pflegefachfrau von der Spitex kommt. Immer einen freundlichen Ton finden. Immer stark bleiben im Hilfe erbitten. Immer sich bedanken. Und an Weihnachten in einer Kaffeestube alleine an einem Tisch sitzen.
„Sagen Sie, bin ich unfreundlich?“
Sie überziehen die Ziegel mit hauchdünner weisser Schicht,
die Eiskristalle, an anderen Stellen des Dachs wachsen
sie zu Splittern empor: Welcher Luftströmungen wegen?
Mit leicht vorgebeugtem Oberkörper und einer dicken Glasbrille auf der Nase, die in er Wärme anlief, betrat er die Kaffeestube. Erst jetzt bemerkte ich seinen Rucksack und den Mann hinter ihm, der älter war und zur Begrüssung nur kurz Augenkontakt mit mir aufnahm, um gleich wieder auf den Boden zu schauen.
Ob sie hier übernachten könnten, fragte der Mann mit der Brille in gebrochenem Englisch. Er putzte seine Brille und setzte sie wieder auf.
Wir seien eine Kaffeestube, antwortete ich, aber sie sollten doch hereinkommen, einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen.
„Ich komme Ungarn“, erzählte er. „Ungarn schlecht. Ich Automechaniker, verdiene zweihundert bis zweihundertfünfzig Euro im Monat. Wenig, sehr wenig. Ich gespart, nach Portugal gefahren, Arbeit suchen, Spanien, Frankreich, Schweiz, aber keine Arbeit finden. Ich überall zuhause, aber ohne Arbeit?“
Sie hätten nur noch wenig Geld, ein Hotel in St. Gallen sei viel zu teuer. Gestern seien sie in der Weihnachtsmesse gewesen, das sei schön gewesen, sie hätten zwar kein Wort verstanden aber die Lichter und Wärme hätten ihnen wohl getan. Sie seien wohl die einzigen im Dom gewesen, die gespürt hätten, wie warm die anderen Menschen geben. Danach seien sie durch die Stadt geirrt, hätten einen warmen Platz gesucht, ja, wenn sie nur ein bisschen von dem Stroh gehabt hätten, das für die Krippen in den Schaufenstern verwendet wird. Im Bahnhof hätten sie sich auf eine Bank gelegt, seien dann aber von dort wieder vertrieben worden.Der ältere Mann sagte kein Wort, schaute nur auf den Teller, der inzwischen leer war.Sie seien sich unterwegs begegnet, er komme auch aus Ungarn, spreche aber kein Wort Englisch oder Deutsch. Er sei Lastwagenfahrer, suche auch Arbeit.
„Ich überall zuhause. Mutter mag mich nicht, Vater kenne ich nicht. Meine Grossmutter habe ich vor zehn Tagen besucht, und wieder losgereist, über Wien. Jede Haltestelle ausgestiegen, weil Kondukteur mich erwischt. Ich kein Geld für Billett. Und jetzt hier.“
In der Herberge zur Heimat war noch ein Zimmer frei für zwei Personen. Sie bedankten sich herzlich, der ältere Mann mit Kopfnicken, und verabschiedeten sich nach dem zweiten Stück Kuchen. Sie seien müde, sie wollten sich jetzt nur hinlegen und schlafen.
Bei stabiler Hochdrucklage sind die Temperaturen leicht angestiegen,
die Eiskristalle verschwunden, aber zwischen Grasbüscheln liegen sie zusammengeklumpt, Grashalme mit dünner Eisschicht umschliessend
Mit neun sei sie bei einem Wettrennen von der Kletterstange gefallen, sie hätte tot sein können. Stattdessen sei sie im Rollstuhl gelandet, habe alles wieder lernen müssen: aufstehen, sich anziehen, gehen, einfach alles. Die Ärzte hätten ihr ein Jahr vorausgesagt, sie habe es in einem halben geschafft. Mit sechzehn habe sie auf einem Bauernhof gearbeitet, mit Metzgerei und Restaurant. Mit zwanzig habe sie geheiratet. Ihr Mann habe eine kleine Firma gehabt, viel mehr als eine Werkbank sei es nicht gewesen; er habe Teile gedreht für grössere Firmen. Sie habe fünf Kinder grossgezogen, gekocht, gewaschen und ihrem Mann in der Firma geholfen, Lieferscheine geschrieben und später die Büros geputzt. Als dank dafür habe er sich eine andere angelacht. Der Jüngste sei zwanzig gewesen, als sie sich habe scheiden lassen. Mit dem zweiten Mann habe sie nicht viel mehr Glück gehabt. Er sei zwar ein netter gewesen und sie hätten ganz schön was zusammengespart, aber nach drei Jahren Ehe sei ausgekommen, dass er in seinem Herkunftsland bereits eine Familie habe. Vor einem Jahr sei er in sein Land gereist, als ob er gespürt hätte, dass er bald sterben würde. Er habe einen Herzstillstand gehabt, sei plötzlich tot umgefallen. Ihr gehe es zwar gut, aber eben, mit dem Alter liessen die Kräfte nach und die verschiedenen Operationen seien auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
„Aber Morgen“, sagte sie lächelnd, „morgen bin ich bei meinem jüngsten Sohn eingeladen. Er kocht besser als seine Frau. Ich habe eben bei der Erziehung darauf geachtet, dass sie putzen, waschen und kochen können.“
Jeder Augenblick ist von dem einen Autor des einen Buches.
Wenn der Augenblick vergangen ist, ist er nicht ausgelöscht.
Er setzt über den Strom des Vergehens, indem er neu sich übersetzt.
Bernhard Brack, Sozialarbeiter
Man hat mir meinen Sohn genommen
Seit drei Jahren habe sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Sie zählt auf: Geburtstag, Muttertag, Weihnachten, Geburtstag, Muttertag - seit drei Jahren habe sie ihn nicht mehr gesehen. Der Anwalt in Bern habe ihr gesagt, man könne einem Elternteil den Zugang zu seinem Kind nicht verwehren. Er habe sich für sie eingesetzt. Gestern habe sie ihren Sohn wieder gesehen, aber anstatt Weihnachten und Muttertag in einem sei ihre Begegnung schrecklich gewesen. Sie erzählt:
Er verfluchte mich.
Neben ihm stand eine Frau, die sagte, sie sei seine Mutter.
Er ist beeinflusst worden, die Erwachsenen haben ihn verdorben.
Ich kämpfe um meinen Sohn. Nicht ohne meinen Sohn! Die Gemeindehelferin ist gegen mich, die Polizei ist gegen mich, meine Mann will mich nicht mehr sehen… Gegen mich ist sein Anwalt.
Ich habe Zahnschmerzen, schon seit langem, aber sie sagen, zum Zahnarzt in der Gemeinde müsse ich gehen oder gar nicht. Mein Zahnarzt in Zürich kennt aber mein Gebiss. Mein Anwalt in Bern sagt, das können sie nicht tun, das verstosse gegen das Gesetz... Alle sind gegen mich, ausser dem Anwalt in Bern, dem Zahnarzt in Zürich.
Amerika. Ich sollte zurück nach Amerika. Aber ich will mein Kind. Auf der Botschaft in Bern sagen sie... Verstehen Sie? Sie haben mir mein Kind genommen! Ich muss nach Bern reisen, aber niemand bezahlt mir das Billet. Bezahlen sie mir das Billet!
Was hat ihnen die Gemeindehelferin erzählt? Ich hätte auch meine Chancen gehabt? Ich hätte eine eigene Wohnung erhalten und das Bett angezündet? Ich hätte von vielen sozialen Stellen Geld erhalten? Ich hätte mich geweigert, eine betreute Wohnform anzunehmen? Das ist eine Meinung. Danke. Warten Sie, ich möchte ihnen eine Geschichte erzählen:
Ich frage Jesus: Wie gross ist deine Liebe?
So gross, antwortet Jesus, breitet seine Arme aus und stirbt.
Ist das nicht eine schöne Geschichte?
anonym
Er verfluchte mich.
Neben ihm stand eine Frau, die sagte, sie sei seine Mutter.
Er ist beeinflusst worden, die Erwachsenen haben ihn verdorben.
Ich kämpfe um meinen Sohn. Nicht ohne meinen Sohn! Die Gemeindehelferin ist gegen mich, die Polizei ist gegen mich, meine Mann will mich nicht mehr sehen… Gegen mich ist sein Anwalt.
Ich habe Zahnschmerzen, schon seit langem, aber sie sagen, zum Zahnarzt in der Gemeinde müsse ich gehen oder gar nicht. Mein Zahnarzt in Zürich kennt aber mein Gebiss. Mein Anwalt in Bern sagt, das können sie nicht tun, das verstosse gegen das Gesetz... Alle sind gegen mich, ausser dem Anwalt in Bern, dem Zahnarzt in Zürich.
Amerika. Ich sollte zurück nach Amerika. Aber ich will mein Kind. Auf der Botschaft in Bern sagen sie... Verstehen Sie? Sie haben mir mein Kind genommen! Ich muss nach Bern reisen, aber niemand bezahlt mir das Billet. Bezahlen sie mir das Billet!
Was hat ihnen die Gemeindehelferin erzählt? Ich hätte auch meine Chancen gehabt? Ich hätte eine eigene Wohnung erhalten und das Bett angezündet? Ich hätte von vielen sozialen Stellen Geld erhalten? Ich hätte mich geweigert, eine betreute Wohnform anzunehmen? Das ist eine Meinung. Danke. Warten Sie, ich möchte ihnen eine Geschichte erzählen:
Ich frage Jesus: Wie gross ist deine Liebe?
So gross, antwortet Jesus, breitet seine Arme aus und stirbt.
Ist das nicht eine schöne Geschichte?
anonym
Ist das Schicksal kooperativ?
Nachdem ich den jungen Mann gebeten habe, das nächste Mal die Unterlagen mitzubringen – ich dachte an seinen Ausweis, offene Rechnungen usw. –, schickt er mir gleich seine Akten zu. Es war ihm offensichtlich wichtig, dass ich verstehe, wie er in seine Notlage geraten ist.
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine „Heimkarriere“. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen auf bei unserer Mutter. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an: „Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du bist, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsene Personen zu und fragte sie: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen an. Um einen grösseren Coup zu landen, sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich auch wieder, Menschen zu begegnen - ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast – und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige sie ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet. Hier der …
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, alleine zu sein.
Letzte Weihnachten feierten wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe - und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihn zwar kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich die Vaterrolle übernommen hatte, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob ich die Klippe meines 25-igsten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und für etwas zu essen reicht es noch. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld, aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder aufstellen und den Leuten erzählen über Blut und abgeschlagene Köpfe. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
anonym
Was steht in den Akten? Heimkarriere? Eigenartiges Wort. Bei Karriere denkt man an einen gesellschaftlichen Aufstieg. Eigentlich sollte es karrieren-los oder heimat-los heissen.
Auch meine Schwester durchlief eine „Heimkarriere“. Jetzt hat sie sich aufgefangen, eine Stelle bei der Post gefunden.
Wir wuchsen auf bei unserer Mutter. Ich muss ein sehr quengeliges, widerborstiges Kind gewesen sein, jedenfalls schrie meine Mutter mich einmal an: „Wenn ich gewusst hätte, was für ein Kind du bist, hätte ich dich abgetrieben!“ Ich ging auf andere erwachsene Personen zu und fragte sie: „Was heisst abtreiben?“ Damals war ich drei- oder vierjährig.
Ich wurde von meiner Mutter oft geschlagen, bis die Vormundschaftsbehörde intervenierte und mich in ein Internat steckte.
Ich fing mit kleinen Einbrüchen an. Um einen grösseren Coup zu landen, sperrten wir jemanden an einem versteckten Ort ein und forderten Lösegeld.
Ich wurde von Heim zu Heim gereicht, widersetzte mich allen Strukturen, allen Einschränkungen, und landete schliesslich in einem Heim für Schwererziehbare. Das einzig Interessante dort waren die Geschichten über Fluchtversuche. Zwei-, dreimal habe ich es auch versucht. Wenn du die Mauern hinter dir lässt, wächst mit jedem Meter das Gefühl von Freiheit und Macht. Du wirst unbekümmert, getraust dich auch wieder, Menschen zu begegnen - ohne Angst erkannt zu werden. Du gehst in eine grössere Stadt, suchst Anschluss bei den Leuten, mit denen du gekifft und Dinge gedreht hast – und bleibst in einer Polizeirazzia hängen.
Im Heim lernte ich jemanden kennen, der in der Freizeit Warhammer-Figuren bemalte. Sie wissen nicht, was das ist? Es gibt viele Kataloge über sie, warten Sie, ich zeige sie ihnen. Hier der dreiköpfige Titaurus mit Totenkopfgurt, bis zu den Zähnen bewaffnet. Hier der …
Ich habe begonnen, diese Figuren zu bemalen. Zuhause stehen sie bereit für die Schlacht. Angst? Nein. Ich bin dem dreiköpfigen Titaurus schon in meinen Träumen begegnet, habe ihm auf die Hand geschlagen und gesagt: “Give me five!“
Angst habe ich nur davor, meinen Hund im Strassenverkehr zu verlieren oder dass er von der Polizei erschossen wird. Mein Hund ist immer bei mir, er schläft in meinem Bett und gibt mir warm. Ich hasse es, alleine zu sein.
Letzte Weihnachten feierten wir zum ersten Mal gemeinsam Weihnachten, meine Mutter, meine Schwester und ich. Weihnachtsbaum, Kerzenlicht, Krippe - und wir wussten nicht, was wir uns sagen sollten. Das heisst, wir hätten schon gewusst was, aber die Worte enthielten Sprengstoff und deshalb schwiegen wir angesichts der brennenden Kerzen.
In einigen Monaten werde ich 25 Jahre alt. Mein Vater ist mit 25 Jahren in einer Bar in Neuseeland erschossen worden. Ich hatte ihn zwar kaum gekannt, die Nachricht von seinem Tod aber traf mich wie ein Faustschlag nach dem Pausengong im Boxkampf. Mein Grossvater starb mit 32 Jahren und mein Cousin, der für mich die Vaterrolle übernommen hatte, starb auch sehr jung.
Manchmal frage ich mich, ob ich die Klippe meines 25-igsten Geburtstags überspringen werde. Ich lebe weit unter dem Existenzminimum, aber für Hundefutter und für etwas zu essen reicht es noch. Die Ämter sagen, ich sei nicht kooperativ, deshalb gebe es nicht mehr Geld, aber sagen Sie, war das Schicksal kooperativ mit mir? Kooperativ ist ein typisches Wort für Leute, die Karriere gemacht haben.
Meine Vision? Ich möchte einmal eine Ausstellung machen mit meinen Warhammer-Figuren, Schlachtfelder aufstellen und den Leuten erzählen über Blut und abgeschlagene Köpfe. Und dann möchte ich endlich Arbeit finden, eine feste Anstellung haben und eine Familie gründen. Ja, das ist mein grösster Traum, eine Familie gründen.
anonym
Der Rosenbergtunnel
Sind Sie auch schon einmal durch den Rosenbergtunnel gefahren? Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wer sind die Menschen, die ihn gebaut haben? Woher kamen sie, wie haben sie gelebt?
Geboren bin ich in einem kleinen Dorf etwa achtzig Kilometer von Split entfernt. Ich habe in meiner Kindheit von meinen Eltern echte Liebe erfahren. Am liebsten ging ich in den Religionsunterricht. Alle Leute im Dorf sagten, dass ich einmal Pfarrer werde, aber ich habe die Schule oft geschwänzt und ging lieber Fussball spielen.
In der Hoffnung, als Matrose anzuheuern, reiste ich nach Triest. Ich lebte bei einer alter Frau in Untermiete, verdiente ein wenig Geld, indem ich Holzsäcke zu den Häusern trug bis mein Rücken blutig war. Die alte Frau pflegte mich, ich brachte ihr dafür Wein in grossen Flaschen. Sie kochte die feinste Minestrone mit fagioli.
Ich fand Arbeit auf Schleppschiffen, sogenannte Remorker, die Plattformen bedienten. Pro Plattform brauchte es drei Remorker: einer im Hafen beim Aufladen, einer an der Plattform beim Abladen und einer unterwegs.
Endlich konnte ich auf einem Tanker anheuern mit 100'000 Tonnen Ladegewicht (Schweröl). Das Schlimmste war, die Tanks zu reinigen. Es stank schrecklich und man brachte das schmierige Öl kaum aus Händen und Gesicht.
Einmal sind wir in einen Sturm geraten. Wir arbeiteten im Schiffsheck im Maschinenraum, der Kapitän war vorne in seiner Steuerkabine. Wir riefen ihm zu, er solle den Kurs wechseln. Als wir sahen, dass er nichts unternahm, banden wir uns zu dritt aneinander: Wenn es einen ins Meer riss, sollen alle sterben. Wir kämpften uns über eine schmale Gehbrücke bis zum Kapitän. Ehrlich gesagt, die Anwesenheit seiner Frau hat ihm das Leben gerettet. Er wurde dann in Philadelphia verhaftet.
Ich musste etwa sechs Monate warten auf das nächste Schiff. Ein Freund schlug mir vor, in die Schweiz zu gehen. Ich habe als Schlosser angefangen beim Bau des Rosenbergtunnels, als Saisonnier. Da habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Wegen ihr bin ich in der Schweiz geblieben und nicht mehr zurück auf das Schiff gegangen.
Einmal war es eiskalt, es lag ein Meter Schnee. Wir mussten unbedingt die Kupplung eines Kokums (Muldenkipper) wechseln. Vor Kälte liefen mir die Tränen herab, die mir auf den Wangen gefroren. Aber wir gaben nicht auf, bis wir die Kuppelung repariert hatten.
Ich schlief in einer Barake mit einem Kollegen in einem Zimmer, wir assen in der Kantine. Wir waren alle gute Kumpels. Anfangs gab es Vorurteile und Beschimpfungen, bis mich die Leute kennenlernten. Dann war ich jeweils willkommen.
Ich fand eine Stelle als Hilfsmonteur für Heizungen, zuerst temporär. Als ich die feste Anstellung bekam, war ich so voller Freude, dass ich es meinem Arbeitskollegen erzählte. Dieser verdiente weniger als ich, wurde deshalb wütend und verlangte ein Gespräch mit dem Personalchef. Danach wurde mir der Lohn gekürzt mit dem Versprechen, dass dies nur kurzfristig sei, so quasi für den Hausfrieden. Jahrelang wartete ich vergebens auf den versprochenen Lohn. Ich fehlte extra am Arbeitsplatz, bis ich die fristlose Kündigung erhielt – aber Arbeitskollegen habe ich nie im Stich gelassen.
Nach dreissig Jahren hier in der Schweiz habe ich keine Perspektiven mehr. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie nach Kroatien zu kommen und dort zu warten, bis mich Gott zu sich ruft. Ich bin gewohnt, Menschen zu helfen, jetzt kann ich nicht einmal mehr mir helfen. Wenn ich den Mann, der neben mir im Spitalbett lag mit einem amputierten Bein, in der Stadt betteln sehe, kann ich ihm nichts geben. Das bricht mir das Herz.
Ich habe nichts mehr der Depression entgegenzusetzen. Früher gabs überall Arbeit, man konnte arbeiten, wenn man wollte, Geld verdienen, schöne Kleider kaufen, etwas Feines essen – aber jetzt bin ich nur noch allen eine Last.
Meine Mutter ist eine so liebe Mutter. Wenn ich wieder einmal zuhause war, sass sie stundenlang am Bett und streichelte mir den Kopf.
„Mutter, höre auf, mich immer anzustaunen“, sagte ich zu ihr.
Sie legte die Hände auf ihr Gesicht und schaute durch die Finger: „Ich kann nicht anders, jetzt, wo du wieder einmal da bist.“
„Geh doch schlafen“. Nicht wegen mir sagte ich das, ich hatte es gerne, aber wegen ihr, sie musste doch auch wieder einmal schlafen.
Mein Vater war streng. Einmal spielten wir Fussball, der Ball landete im Garten des Nachbarn. Der war so wütend, dass er den Fussball zerstach. Ich wollte mich rächen, stahl ihm einen Sack Mineralsalz, den man streute, damit das Gemüse besser wächst. Aber der Sack hatte ein Loch und der Nachbar brauchte nur der Spur zu folgen, um mich zu erwischen. Vater befahl mir, auf dem Treppenabsatz zu knien mit aufrechten Zehenspitzen – ich durfte nicht weinen – während er mit dem Nachbarn sprach.
Ich möchte nach Kroatien, in die Nähe meines Grabes. Meine Angehörigen sollen nicht teures Geld zahlen müssen, um mich nach Kroatien zurückzubringen. Und irgendwann holt mich Gott. Ich stehe voll hinter Gott, wenn er sagt, es ist Zeit, dann ist es Zeit abzutreten.
anonym
Geboren bin ich in einem kleinen Dorf etwa achtzig Kilometer von Split entfernt. Ich habe in meiner Kindheit von meinen Eltern echte Liebe erfahren. Am liebsten ging ich in den Religionsunterricht. Alle Leute im Dorf sagten, dass ich einmal Pfarrer werde, aber ich habe die Schule oft geschwänzt und ging lieber Fussball spielen.
In der Hoffnung, als Matrose anzuheuern, reiste ich nach Triest. Ich lebte bei einer alter Frau in Untermiete, verdiente ein wenig Geld, indem ich Holzsäcke zu den Häusern trug bis mein Rücken blutig war. Die alte Frau pflegte mich, ich brachte ihr dafür Wein in grossen Flaschen. Sie kochte die feinste Minestrone mit fagioli.
Ich fand Arbeit auf Schleppschiffen, sogenannte Remorker, die Plattformen bedienten. Pro Plattform brauchte es drei Remorker: einer im Hafen beim Aufladen, einer an der Plattform beim Abladen und einer unterwegs.
Endlich konnte ich auf einem Tanker anheuern mit 100'000 Tonnen Ladegewicht (Schweröl). Das Schlimmste war, die Tanks zu reinigen. Es stank schrecklich und man brachte das schmierige Öl kaum aus Händen und Gesicht.
Einmal sind wir in einen Sturm geraten. Wir arbeiteten im Schiffsheck im Maschinenraum, der Kapitän war vorne in seiner Steuerkabine. Wir riefen ihm zu, er solle den Kurs wechseln. Als wir sahen, dass er nichts unternahm, banden wir uns zu dritt aneinander: Wenn es einen ins Meer riss, sollen alle sterben. Wir kämpften uns über eine schmale Gehbrücke bis zum Kapitän. Ehrlich gesagt, die Anwesenheit seiner Frau hat ihm das Leben gerettet. Er wurde dann in Philadelphia verhaftet.
Ich musste etwa sechs Monate warten auf das nächste Schiff. Ein Freund schlug mir vor, in die Schweiz zu gehen. Ich habe als Schlosser angefangen beim Bau des Rosenbergtunnels, als Saisonnier. Da habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Wegen ihr bin ich in der Schweiz geblieben und nicht mehr zurück auf das Schiff gegangen.
Einmal war es eiskalt, es lag ein Meter Schnee. Wir mussten unbedingt die Kupplung eines Kokums (Muldenkipper) wechseln. Vor Kälte liefen mir die Tränen herab, die mir auf den Wangen gefroren. Aber wir gaben nicht auf, bis wir die Kuppelung repariert hatten.
Ich schlief in einer Barake mit einem Kollegen in einem Zimmer, wir assen in der Kantine. Wir waren alle gute Kumpels. Anfangs gab es Vorurteile und Beschimpfungen, bis mich die Leute kennenlernten. Dann war ich jeweils willkommen.
Ich fand eine Stelle als Hilfsmonteur für Heizungen, zuerst temporär. Als ich die feste Anstellung bekam, war ich so voller Freude, dass ich es meinem Arbeitskollegen erzählte. Dieser verdiente weniger als ich, wurde deshalb wütend und verlangte ein Gespräch mit dem Personalchef. Danach wurde mir der Lohn gekürzt mit dem Versprechen, dass dies nur kurzfristig sei, so quasi für den Hausfrieden. Jahrelang wartete ich vergebens auf den versprochenen Lohn. Ich fehlte extra am Arbeitsplatz, bis ich die fristlose Kündigung erhielt – aber Arbeitskollegen habe ich nie im Stich gelassen.
Nach dreissig Jahren hier in der Schweiz habe ich keine Perspektiven mehr. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie nach Kroatien zu kommen und dort zu warten, bis mich Gott zu sich ruft. Ich bin gewohnt, Menschen zu helfen, jetzt kann ich nicht einmal mehr mir helfen. Wenn ich den Mann, der neben mir im Spitalbett lag mit einem amputierten Bein, in der Stadt betteln sehe, kann ich ihm nichts geben. Das bricht mir das Herz.
Ich habe nichts mehr der Depression entgegenzusetzen. Früher gabs überall Arbeit, man konnte arbeiten, wenn man wollte, Geld verdienen, schöne Kleider kaufen, etwas Feines essen – aber jetzt bin ich nur noch allen eine Last.
Meine Mutter ist eine so liebe Mutter. Wenn ich wieder einmal zuhause war, sass sie stundenlang am Bett und streichelte mir den Kopf.
„Mutter, höre auf, mich immer anzustaunen“, sagte ich zu ihr.
Sie legte die Hände auf ihr Gesicht und schaute durch die Finger: „Ich kann nicht anders, jetzt, wo du wieder einmal da bist.“
„Geh doch schlafen“. Nicht wegen mir sagte ich das, ich hatte es gerne, aber wegen ihr, sie musste doch auch wieder einmal schlafen.
Mein Vater war streng. Einmal spielten wir Fussball, der Ball landete im Garten des Nachbarn. Der war so wütend, dass er den Fussball zerstach. Ich wollte mich rächen, stahl ihm einen Sack Mineralsalz, den man streute, damit das Gemüse besser wächst. Aber der Sack hatte ein Loch und der Nachbar brauchte nur der Spur zu folgen, um mich zu erwischen. Vater befahl mir, auf dem Treppenabsatz zu knien mit aufrechten Zehenspitzen – ich durfte nicht weinen – während er mit dem Nachbarn sprach.
Ich möchte nach Kroatien, in die Nähe meines Grabes. Meine Angehörigen sollen nicht teures Geld zahlen müssen, um mich nach Kroatien zurückzubringen. Und irgendwann holt mich Gott. Ich stehe voll hinter Gott, wenn er sagt, es ist Zeit, dann ist es Zeit abzutreten.
anonym
Einblick in das Leben von Elvis Bollhalder
Mit sechzehn lebte er in einem Zelt am Waldrand, mit siebzehn wurde er Vater. Wie lebt er heute? Welche Chancen birgt sein Leben?
Wie ist die Geschichte entstanden? - Das erste Beratungsgespräch fand kurz nach der Trennung von seiner Freundin statt. Er fühlte sich als völliger Versager. Er erzählte mir aus seinem Leben wie um zu belegen, dass er stets nur versagt hatte. Ich staunte über die Fülle seiner Erfahrungen und fragte mich, wie ich als Sechzehnjähriger in einem Zelt am Waldrand gelebt und überlebt hätte. Meine Anregung, seine Geschichte aufzuschreiben, nahm er begeistert auf. Ich blieb skeptisch: Würde er sich wirklich dahinterklemmen?
An das nächste Gespräch kam er mit einem Notizblöcklein. Er diktierte, ich tippte ab. „Das ist die erste Geschichte, die ich schreibe“, sagte er voller Stolz.
Meine Mutter hat mich von zuhause rausgeworfen als ich sechzehn war, gerade als ich mit der Lehre begann. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also holte ich das Zelt aus dem Keller und ging in den Wald, baute dort mein Lager auf. Den Sommer über war es noch sehr einfach und schön warm, doch den Winter über musste ich Schlafsäcke aus anderen Kellern klauen und Jacken, damit ich nicht frieren musste. Esswaren musste ich auch irgendwie besorgen, also bat ich meine Kollegin darum und sie brachte mir Nüsse und Chips und was sie sonst noch auftreiben konnte. Ich habe mich voll asozial gefühlt. Obwohl ich in der Lehre war, hätte ich mich am liebsten in einem Loch verkrochen, so sehr schämte ich mich. Da ich keine Unterstützung von der Familie hatte, blieb mir aber nichts anderes übrig. Es machte mich eine Weile richtig kaputt, so zu leben, aber ich blieb optimistisch und führte meine Lehre weiter. Ich liess mich von nichts abbringen, war jedoch leicht reizbar wegen meiner Lebenssituation. Dann kam eine Überrraschung: mein kleiner Sohn kam auf die Welt, als ich siebzehn war. Er war ein richtiger Segen für mich, aber leider kamen mit dem Segen auch viele Probleme und Ausgaben. Darum gab ich die Lehre auf und ging jobben als Bauisolierer-Hilfsarbieter, um meiner Freundin und meinem Kleinen etwas bieten zu können. Als das Kind nach einem Jahr die Brust nicht mehr brauchte, nahmen sie es uns weg, weil meine Freundin zu jung war. Und das geschah, als ich achtzehn war. Es ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mich am liebsten getötet, so scheisse ging es mir damals. Ich gab den Job auf, verliess meine Freundin und fing an zu dealen mit Gras, bis die Polizei dahinterkam und mich erwischte. Es kamen noch mehr Probleme auf mich zu. Ich hatte Gerichtsverhandlungen, bekam Bewährung auf zwei Jahre und während dieser Zeit entschloss man sich dafür, dass ich kein Sorgerecht mehr habe. Als ich das erfuhr, war es beinahe mein Untergang. Ich entschloss mich, ein Jahr lang nichts zu tun und mich neu zu orientieren. Dann kam der Moment, als ich dachte, es muss weitergehen. Das hiess für mich, dass ich zuerst einmal von den Drogen weg musste. Also habe ich ein halbes Jahr lang einen Entzug gemacht und in diesem Entzug habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Sie half mir, wo sie nur konnte. Das baute mich auf und brachte mich dazu, dass ich es schaffte, dieses halbe Jahr durchzustehen. Dann hiess es, meine Freundin gehe an die Kunstschule in St. Gallen. Ich dachte mir, ich begleite sie und fange neu an. Ich ging mit ihr nach St. Gallen und wie man sagt, aller Anfang ist schwer. Der Anfang war wirklich schwer. Ich hatte nämlich keine Wohnung und keine Sozialhilfe, also musste ich bei der Freundin leben und das war nicht gut für unsere Beziehung, weil ich nichts tat den ganzen Tag. Meine Freundin machte Schluss mit mir, weil sie mich nicht mehr richtig liebte. Nachdem das geschehen war, ging ich zu meinem Kollegen, den ich in St. Gallen kenntengelernt hatte. Der bot mir an, mich unter seiner Adresse beim Sozialamt anzumelden. Das war eine gute Chance, von da an bekam ich wenigstens Sozialgelder, um zu überleben. Mein Kollege hatte nur ein Zimmer, doch ich wollte meinen Freiraum. Deshalb ging ich ins Obdachlosenheim. Es zieht mich zwar runter, wenn ich sehe, wie die Leute dort leben, aber dann dachte ich an meinen Sohn, also raffte ich mich auf und suchte eine Wohnungen und einen Job. Und da schau her, ich habe Glück, habe eine Wohnung gefunden und der Job ist auch sehr nah.
Ich will euch damit empfehlen, egal wie tief man ist und egal wie hoffnungslos es scheint, immer und immer wieder probieren, irgendwann schafft man sein Ziel.
Elvis Bollhalder
Wie ist die Geschichte entstanden? - Das erste Beratungsgespräch fand kurz nach der Trennung von seiner Freundin statt. Er fühlte sich als völliger Versager. Er erzählte mir aus seinem Leben wie um zu belegen, dass er stets nur versagt hatte. Ich staunte über die Fülle seiner Erfahrungen und fragte mich, wie ich als Sechzehnjähriger in einem Zelt am Waldrand gelebt und überlebt hätte. Meine Anregung, seine Geschichte aufzuschreiben, nahm er begeistert auf. Ich blieb skeptisch: Würde er sich wirklich dahinterklemmen?
An das nächste Gespräch kam er mit einem Notizblöcklein. Er diktierte, ich tippte ab. „Das ist die erste Geschichte, die ich schreibe“, sagte er voller Stolz.
Meine Mutter hat mich von zuhause rausgeworfen als ich sechzehn war, gerade als ich mit der Lehre begann. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also holte ich das Zelt aus dem Keller und ging in den Wald, baute dort mein Lager auf. Den Sommer über war es noch sehr einfach und schön warm, doch den Winter über musste ich Schlafsäcke aus anderen Kellern klauen und Jacken, damit ich nicht frieren musste. Esswaren musste ich auch irgendwie besorgen, also bat ich meine Kollegin darum und sie brachte mir Nüsse und Chips und was sie sonst noch auftreiben konnte. Ich habe mich voll asozial gefühlt. Obwohl ich in der Lehre war, hätte ich mich am liebsten in einem Loch verkrochen, so sehr schämte ich mich. Da ich keine Unterstützung von der Familie hatte, blieb mir aber nichts anderes übrig. Es machte mich eine Weile richtig kaputt, so zu leben, aber ich blieb optimistisch und führte meine Lehre weiter. Ich liess mich von nichts abbringen, war jedoch leicht reizbar wegen meiner Lebenssituation. Dann kam eine Überrraschung: mein kleiner Sohn kam auf die Welt, als ich siebzehn war. Er war ein richtiger Segen für mich, aber leider kamen mit dem Segen auch viele Probleme und Ausgaben. Darum gab ich die Lehre auf und ging jobben als Bauisolierer-Hilfsarbieter, um meiner Freundin und meinem Kleinen etwas bieten zu können. Als das Kind nach einem Jahr die Brust nicht mehr brauchte, nahmen sie es uns weg, weil meine Freundin zu jung war. Und das geschah, als ich achtzehn war. Es ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mich am liebsten getötet, so scheisse ging es mir damals. Ich gab den Job auf, verliess meine Freundin und fing an zu dealen mit Gras, bis die Polizei dahinterkam und mich erwischte. Es kamen noch mehr Probleme auf mich zu. Ich hatte Gerichtsverhandlungen, bekam Bewährung auf zwei Jahre und während dieser Zeit entschloss man sich dafür, dass ich kein Sorgerecht mehr habe. Als ich das erfuhr, war es beinahe mein Untergang. Ich entschloss mich, ein Jahr lang nichts zu tun und mich neu zu orientieren. Dann kam der Moment, als ich dachte, es muss weitergehen. Das hiess für mich, dass ich zuerst einmal von den Drogen weg musste. Also habe ich ein halbes Jahr lang einen Entzug gemacht und in diesem Entzug habe ich meine neue Freundin kennengelernt. Sie half mir, wo sie nur konnte. Das baute mich auf und brachte mich dazu, dass ich es schaffte, dieses halbe Jahr durchzustehen. Dann hiess es, meine Freundin gehe an die Kunstschule in St. Gallen. Ich dachte mir, ich begleite sie und fange neu an. Ich ging mit ihr nach St. Gallen und wie man sagt, aller Anfang ist schwer. Der Anfang war wirklich schwer. Ich hatte nämlich keine Wohnung und keine Sozialhilfe, also musste ich bei der Freundin leben und das war nicht gut für unsere Beziehung, weil ich nichts tat den ganzen Tag. Meine Freundin machte Schluss mit mir, weil sie mich nicht mehr richtig liebte. Nachdem das geschehen war, ging ich zu meinem Kollegen, den ich in St. Gallen kenntengelernt hatte. Der bot mir an, mich unter seiner Adresse beim Sozialamt anzumelden. Das war eine gute Chance, von da an bekam ich wenigstens Sozialgelder, um zu überleben. Mein Kollege hatte nur ein Zimmer, doch ich wollte meinen Freiraum. Deshalb ging ich ins Obdachlosenheim. Es zieht mich zwar runter, wenn ich sehe, wie die Leute dort leben, aber dann dachte ich an meinen Sohn, also raffte ich mich auf und suchte eine Wohnungen und einen Job. Und da schau her, ich habe Glück, habe eine Wohnung gefunden und der Job ist auch sehr nah.
Ich will euch damit empfehlen, egal wie tief man ist und egal wie hoffnungslos es scheint, immer und immer wieder probieren, irgendwann schafft man sein Ziel.
Elvis Bollhalder